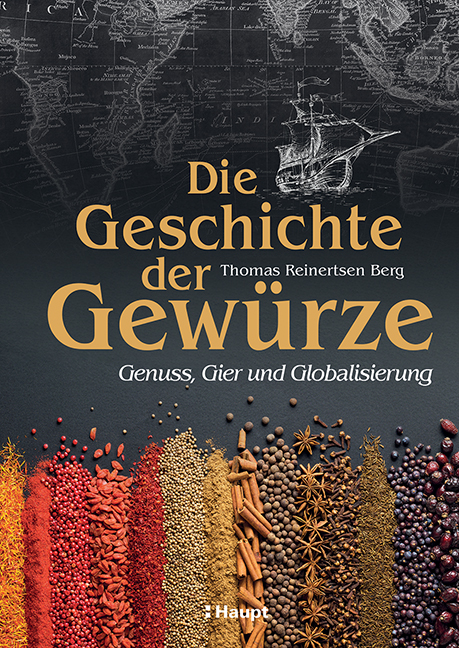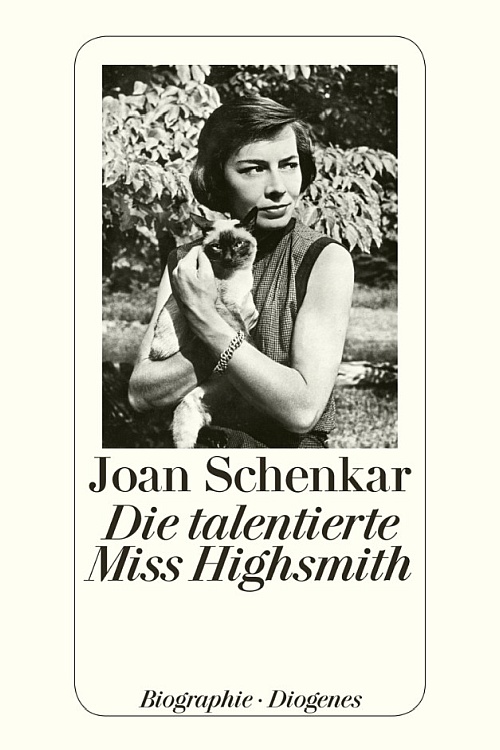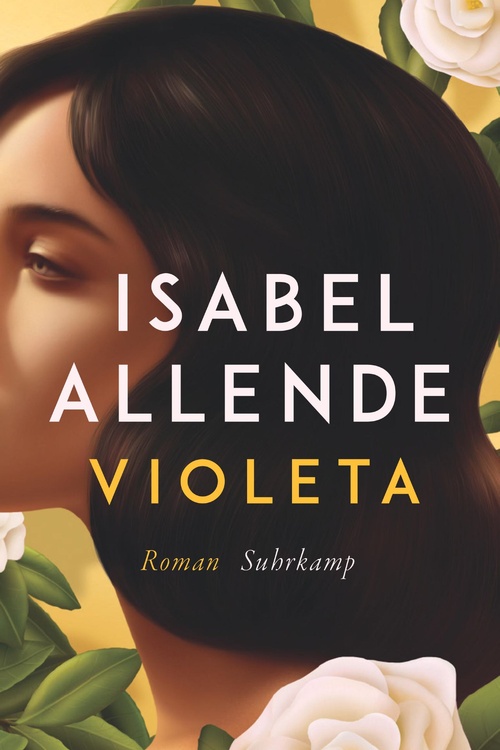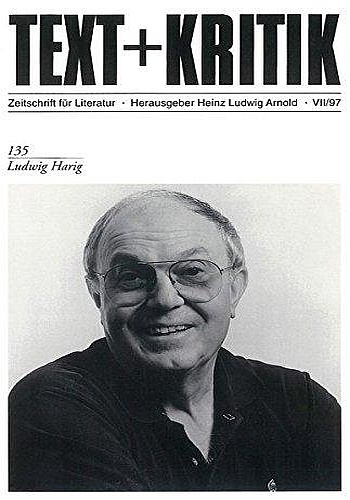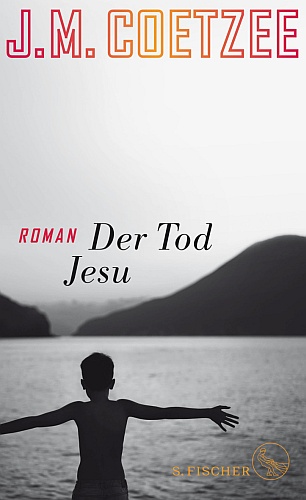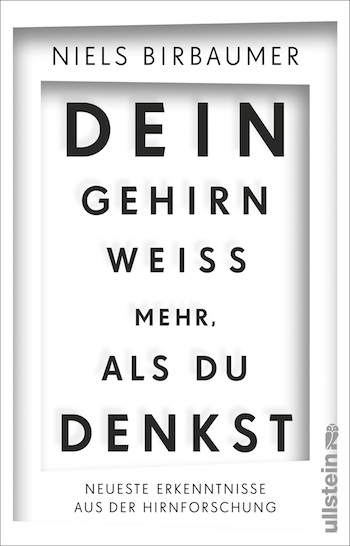»Ich habe mich dafür entschieden, einen Schritt zurückzutreten und Hannah Arendts Leben und Werk nahezu vollständig in ihrer Zeit darzustellen«, schreibt Thomas Meyer zu Beginn seiner neuen, grundlegenden und überraschenden Biografie über Hannah Arendt. Auf ihre Gegenwart »ließ sie sich in einer besonderen Weise ein, wie diese erste ganz auf Archivrecherchen beruhende Biografie belegt«, heißt es weiter. DIETER KALTWASSER hat das Buch gelesen
 Meyer ist Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schwerpunkt seiner Forschungen und Publikationen ist die Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Er hat mehrere Schriften Hannah Arendts ediert und gibt zudem eine zwölfbändige Studienausgabe ihrer Werke heraus.
Meyer ist Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schwerpunkt seiner Forschungen und Publikationen ist die Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Er hat mehrere Schriften Hannah Arendts ediert und gibt zudem eine zwölfbändige Studienausgabe ihrer Werke heraus.
Geboren wurde Hannah Arndt am 14. Oktober 1906 in Linden bei Hannover als einziges Kind des Ingenieurs Paul Arendt und seiner Frau Martha, geb. Cohn. Sie wächst in einem sozialdemokratischen jüdisch-assimilierten Elternhaus in Königsberg auf. Von 1924 bis 1928 studierte sie Philosophie, Theologie und Klassischen Philologie in Marburg, Freiburg im Breisgau und Heidelberg. Philosophie studierte sie in Marburg bei Martin Heidegger, in Freiburg bei Edmund Husserl und in Heidelberg bei Karl Jaspers, dem sie ihr Leben lang verbunden blieb.
Hannah Arendt saß in den Vorlesungen Heideggers, in deren Verlauf sie sich in Heidegger und vermutlich umgekehrt auch er sich in sie verliebte, erfahren wir vom Autor. Es war der Beginn einer eineinhalb Jahre währenden Beziehung. In Heidelberg promovierte sie bei Jaspers über den ›Liebesbegriff bei Augustin‹. In ihrer Heidelberger Zeit fühlte sie sich auch Benno von Wiese freundschaftlich verbunden, dem späteren Professor für Neuere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Bonn. Die Freundschaft endete wegen dessen frühen apologetischen Stellungnahmen zum Nationalsozialismus.
Martin Heidegger bekannte später, dass die brillante Studentin Hannah Arendt die Inspiration für sein philosophisches Hauptwerk ›Sein und Zeit‹ gewesen sei. »Die vorliegende Biografie rekonstruiert die Binnenperspektive«, schreibt Meyer, »Arendts Reaktionen auf Heidegger, die Diskussionen zwischen ihr und dem Ehepaar Jaspers.« Im September 1929 heiratete sie den Schriftsteller Günther Stern, der später vor allem unter dem Pseudonym Günther Anders bekannt wurde. Nach der Scheidung der dreijährigen Ehe heiratete sie 1929 den politologisch-philosophischen Autodidakten Heinrich Blücher.
Einen Schwerpunkt seiner neuen Arendt-Biografie legt der Biograf auf die praktischen Tätigkeiten der Philosophin, ein Gebiet, das in den vielen Biographien über die Starphilosophin ihrer Zeit häufig ausgeklammert wird oder zu kurz gerät. Der Biograph schildert zwei Lebensphasen Arendts, über die bislang wenig bekannt ist: die Jahre nach der Flucht aus Deutschland nach Frankreich von 1933 bis 1941 sowie die ersten Jahre in New York bis 1951. In den Jahren zwischen beiden Fluchten lebte sie überwiegend in Paris. Meyer versteht ihre Tätigkeiten dort als ihren politischen Aktivismus. Sie setzte sich mit ihrer Arbeit für die Kinder- und Jugend-Alijah beharrlich dafür ein, dass jüdische Kinder und Jugendliche in das damalige Mandatsgebiet Palästina in Sicherheit gebracht werden konnten.
Wie konkret die Tätigkeit Arendts in dieser Organisation war und worin genau die Arbeit bestand, schildert Meyer präzise und detailliert. Hierzu legt er erstmals seine ausführlichen zweijährigen Recherchen in den Archiven offen. Er thematisiert in seinem Buch vor allem den jüdischen Kontext, dem sich die Denkerin verpflichtet fühlte. Hier sind ihre Antisemitismus-Studien zusammen mit ihrer Analyse der jüdischen Assimilationsgeschichte zu nennen. Die Erfahrungen, die Arendt in Paris gemacht habe, seien für die Entwicklung ihres Werks zentral gewesen, schreibt Meyer. Weiter heißt es: »Ein wie auch immer geartetes Reflektieren muss einhergehen mit dem, was sie ›Soziale Arbeit‹ nennt, also dem aktiv werden, dem Beteiligtsein.«
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Hannah Arendt 1940 in das berüchtigte Internierungslager von Gurs verbracht. Sie konnte dem Lager und einer drohenden Deportation jedoch entkommen. Mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher, den sie auf der Flucht in Montauban wiedergetroffen hatte, ging es weiter nach Marseille und von dort nach Lissabon, von wo beide auf einem Schiff nach New York reisten. Unerlässlich war dabei die Hilfe des amerikanischen ›Emergency Rescue Committee‹ und des Amerikaners Varian Fry, den sie in Marseille trafen, ein an der Universität Harvard ausgebildeter Altphilologe und Journalist, der den Blüchers die rettenden Visa ausstellen konnte. Den Kontakt zu Fry, erfahren wir von Thomas Meyer, »stellte vermutlich der später als Sozialwissenschaftler berühmt gewordene Albert O. Hirschmann her.« Über Varian Fry »gelangten auch zahlreiche Bekannte der Blüchers in die freie Welt, neben Hans Sahl unter anderem Siegfried Kracauer […].«
Ab 1941 arbeitete Arendt als freie Autorin und als Lektorin, war Gastprofessorin in Princeton und Professorin an der University of Chicago und Geschäftsführerin der ›Jewish Cultural Reconstruction‹ in New York. In dieser Zeit entstand ihr politisches Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Ab 1967 lehrte Arendt an der New School for Social Research in New York.
Ihr Denken wurde zunehmend politischer, was für Hannah Arndt auch bedeutete, sich dem »Risiko der Öffentlichkeit« auszusetzen, wie sie es nannte. Sie wurde, und dies schildert der Biograph in einem zentralen Kapitel seines Buches detailliert, eine professionelle Medienintellektuelle. »Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophin«, sagte sie in dem 1964 ausgestrahlten Gespräch mit Günter Gaus in dessen Sendereihe ›Zur Person‹. Sie wurde einer großen Öffentlichkeit bekannt als Eichmann-Beobachterin in dem Jerusalemer Prozess 1961; ihr Bericht von der ›Banalität des Bösen‹ (und der Begriff als solcher) bleibt prägend bis heute. Einer der schärfsten Kritiker des Buches war ihr Freund, der Religionsphilosoph Gershom Scholem – und die öffentlich ausgetragene Kontroverse führte zum Zerwürfnis.
Anfang 2018 erschien aus Arendts Nachlass der 1967 fertiggestellte Essay ›Die Freiheit, frei zu sein‹, der wochenlang auf den Bestsellerlisten stand. Erklären lässt sich das neu erwachte Interesse damit, dass sich die aus NS-Deutschland geflüchtete jüdische Denkerin, die sich selbst als »politische Theoretikerin« verstand, mit Themen beschäftigte, die für uns von großer Aktualität sind: Die Lage von Geflüchteten, die Ursprünge politischer Gewalt, Totalitarismus und der Antisemitismus. Thomas Meyer ist es gelungen, durch intensive Archivarbeit und Quellenfunde eine neue Sicht auf Hannah Arendt zu eröffnen: Neben der brillanten Denkerin steht die unermüdliche Aktivistin, die jüdischen Kindern und Jugendlichen das Leben rettet.
Titelangaben
Hannah Arendt – Die Biografie
München: Piper Verlag 2023
528 Seiten, 28 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe