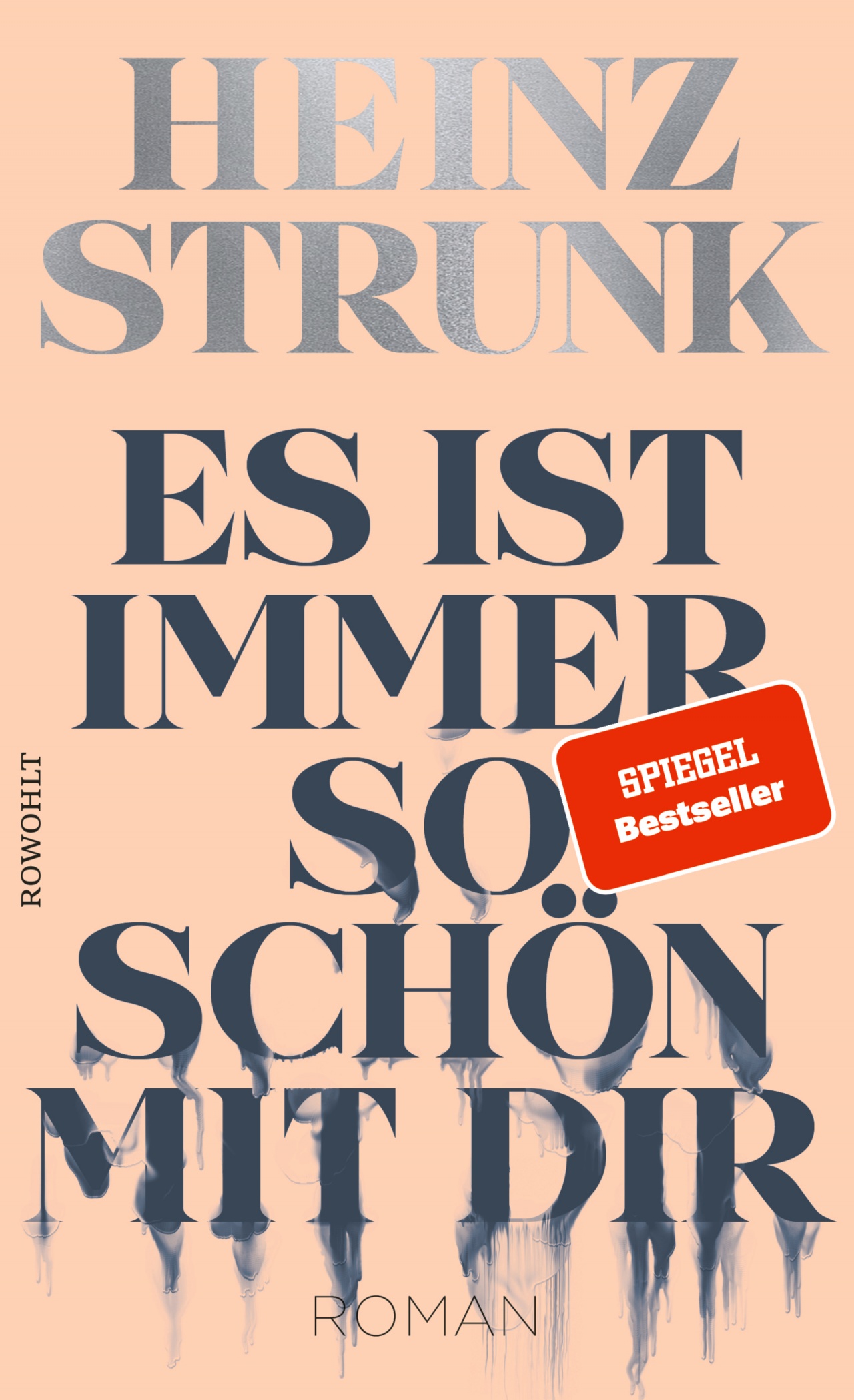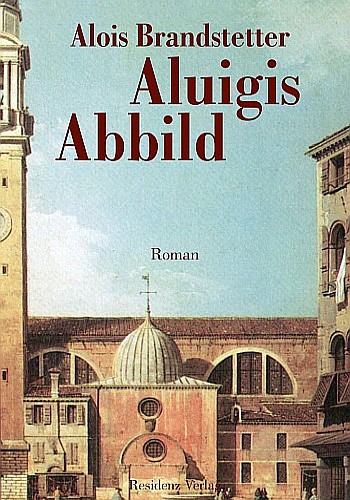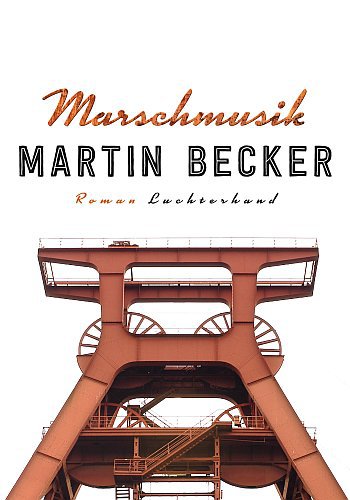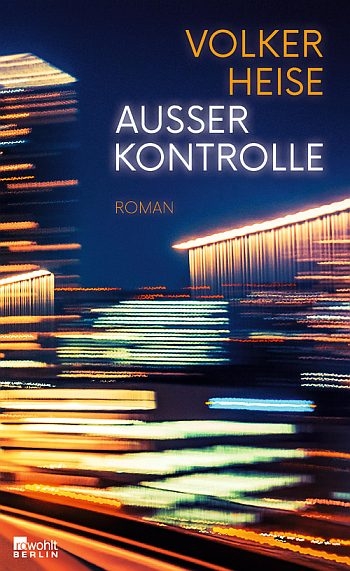»Ich glaube nicht, dass es nur ein dunkler Roman ist. Das Leben ist nicht linear. Natürlich handelt es sich bei Gewalt um etwas Düsteres, aber dennoch ist sie allgegenwärtig. Trotzdem geht es in diesem Roman auch viel um Zärtlichkeit. Aber es stimmt schon, es ist sicher ein Buch der Unbarmherzigkeit«, hatte die 34-jährige österreichische Schriftstellerin und Fotokünstlerin Valerie Fritsch in einem Interview über ihren Roman Zitronen erklärt. Von PETER MOHR
 Es ist ein Roman der absoluten Gegensätze: es geht um das kaum erklärbare Nebeneinander von Zärtlichkeit und Brutalität, von fürsorglicher Mutterliebe und kalter Ignoranz. Das ständige Pendeln zwischen diesen emotionalen Polen hat einen handfesten medizinischen Grund – die Hauptfigur Lilly Drach leidet am Münchhausen-Stellvertretersyndrom, bei dem gesunde Menschen an nahestehenden Personen Krankheiten vortäuschen oder sie absichtlich herbeiführen. Sie gefallen sich dann später in der Helferrolle.
Es ist ein Roman der absoluten Gegensätze: es geht um das kaum erklärbare Nebeneinander von Zärtlichkeit und Brutalität, von fürsorglicher Mutterliebe und kalter Ignoranz. Das ständige Pendeln zwischen diesen emotionalen Polen hat einen handfesten medizinischen Grund – die Hauptfigur Lilly Drach leidet am Münchhausen-Stellvertretersyndrom, bei dem gesunde Menschen an nahestehenden Personen Krankheiten vortäuschen oder sie absichtlich herbeiführen. Sie gefallen sich dann später in der Helferrolle.
»Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte oder niemand niemanden, nicht einmal unter seinem eigenen Dach«, heißt es über den Handlungsort in der niederösterreichischen Provinz. Niemand nimmt davon Notiz, dass Lilly Drach ihren Sohn August mit Pillen absichtlich krank macht – ein Kind, das wiederholt vom Vater, der später spurlos verschwindet, verprügelt wurde, ohne dass die Mutter interveniert hat.
Stattdessen sieht sich Mutter Lilly wiederholt Aufzeichnungen der Beisetzung von Lady Diana an. Autorin Valerie Fritsch gräbt ganz tief in der Seele dieser psychisch deformierten Frau. »Wenn das Haus brennt, wen würdest du retten, wenn du nur einen retten kannst, den Vater oder mich, aber er war schon klug genug, um zu ahnen, dass in der größeren Liebe ein Hinterhalt steckte«, heißt es im Roman. Zärtlich wird Lilly nur dann, wenn sie Augusts Blessuren pflegt. Sie schirmt ihn von der restlichen Dorfjugend ab und lässt ihn so zum lebensunfähigen Außenseiter werden.
Die sprunghafte Lilly lernt dennoch den Arzt Otto Ziedrich kennen, ein absolutes Gegenmodell zum verschwundenen Gatten – ein liebevoller, verständnisvoller und gebildeter Zeitgenosse. Aber auch der Mediziner wird ungeahnt zum »Opfer« in Lillys krankhaftem Intrigenspiel. Mit Hilfe eines gestohlenen Rezeptblocks und gefälschten Unterschriften organisiert die Mutter zahlreiche Medikamente, die sie ihrem Sohn heimlich verabreicht und ihn damit krank macht. Das löst eine starke Betroffenheit bei der Lektüre aus, ein Gefühl, das weit über das übliche Maß an Mitleid hinaus reicht.
Auf einer Reise in den Süden wendet sich die Handlung. Lilly kommt ihr mit den Medikamenten gefüllter Rucksack abhanden und – kein Wunder – Sohn August gesundet im sonnigen Süden und beim Duft reifer Zitronen. Der paranoiden Mutter gefällt dies nicht, sie versucht sogar, August eine Treppe hinunter zu stürzen.
Als sie in die Heimat zurückkehren, kommt der Mediziner dem gefährlichen Schwindel um die gefälschten Rezepte auf die Spur. Er bringt August in eine Großstadt – weit entfernt vom Ort der erlittenen Gewalt und weit entfernt von seiner kranken Mutter. Der Arzt verschweigt dem Jungen allerdings den Grund für seine überhastete Aktion.
Später erfindet sich der »elternlose«, völlig orientierungslose August immer wieder neue Biografien, er möchte sein eigenes Leben abstreifen, hinter sich lassen und Neues erkunden. Wirklicher Erfolg ist ihm bei diesen Ambitionen nicht beschieden.
Die Omnipräsenz der Bedrohung, der physischen und psychischen Gewalt, zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Valerie Fritschs Sprache ist drastisch und ohne Umschweife, die Gewalt wird durch mit viel Bedacht gewählten Worte beinahe körperlich spürbar.
Zitronen liefert auf unter 200 Seiten Stoff für mehrere Roman, ein bedrückendes Panorama zwischen Brutalität, Zärtlichkeit und krankhaften psychischen Irrungen. Ein Roman, der die Untiefen menschlicher Seelen beleuchtet – nicht als Nachttischlektüre geeignet.
Titelangaben
Valerie Fritsch: Zitronen
Berlin: Suhrkamp Verlag 2024
186 Seiten. 24.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe