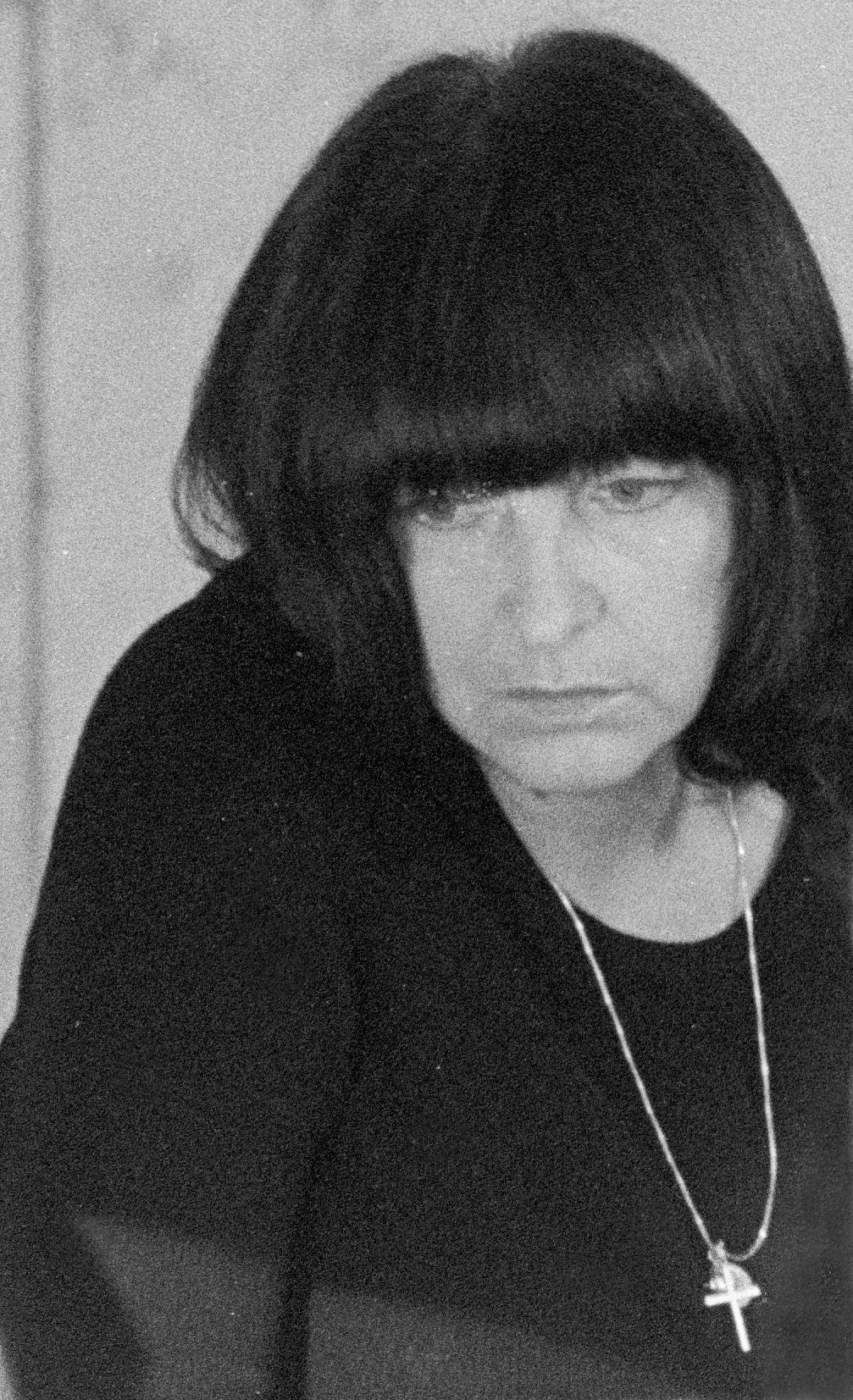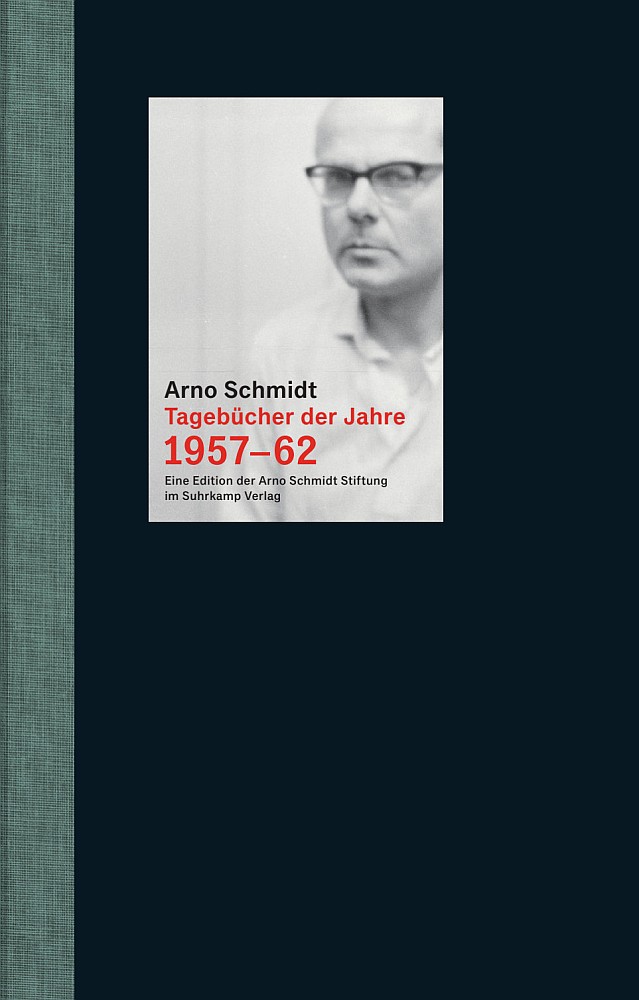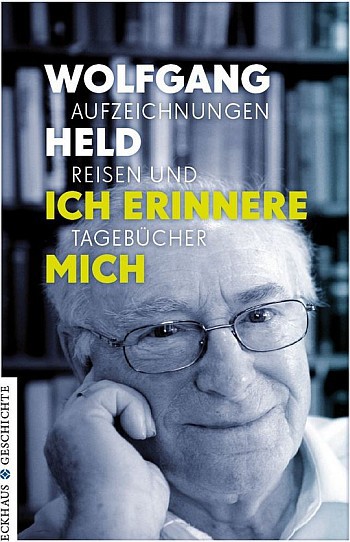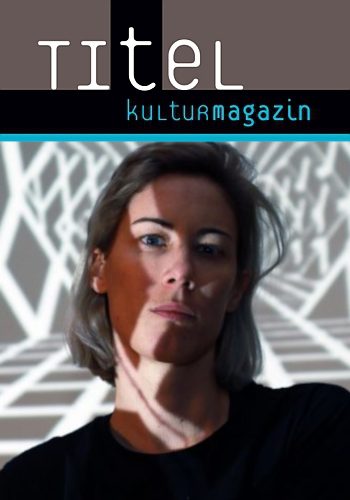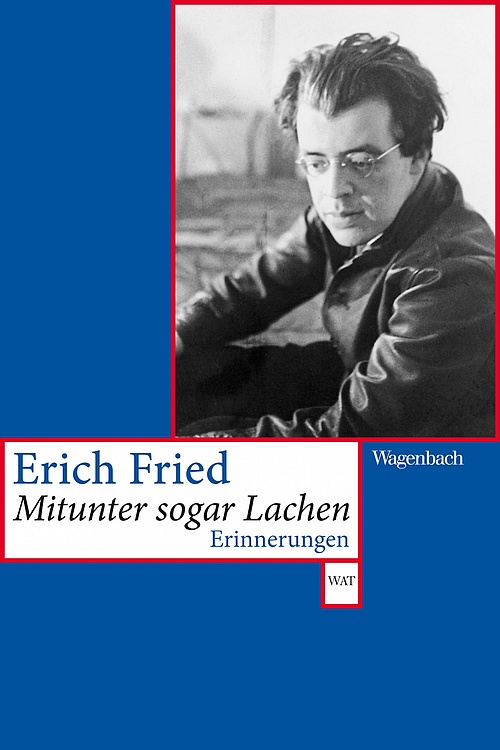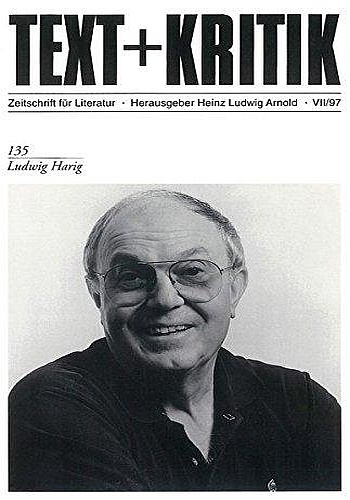DIETER KALTWASSER hat Kai Kauffmanns neue grundlegende Biographie über Friedrich Gottlob Klopstock gelesen.
 Am 2. Juli 2024 war Friedrich Gottlieb Klopstocks 300. Geburtstag. Er war zu seiner Zeit ein gefeierter Literaturstar, er war der berühmteste deutsche Dichter des 18. Jahrhunderts, heute ist sein Ruhm nahezu verblasst. Der Dichter der sog. Empfindsamkeit zog mit seinen Oden noch die Generation des »Sturm und Drang« in seinen Bann, darunter Herder, Goethe und Schiller. Selbst für Hölderlin war er noch ein Vorbild der eigenen Oden und Hymnen, so berichtet es der Autor dieser sehr lesenswerten neuen Biographie. In Goethes ›Leiden des jungen Werthers‹ fällt in Anspielung auf eine Ode des Dichters der ergriffene Ausruf: »Klopstock!« was heutige, den »Werther« lesende Deutschschüler verwirrt bis erheitert.
Am 2. Juli 2024 war Friedrich Gottlieb Klopstocks 300. Geburtstag. Er war zu seiner Zeit ein gefeierter Literaturstar, er war der berühmteste deutsche Dichter des 18. Jahrhunderts, heute ist sein Ruhm nahezu verblasst. Der Dichter der sog. Empfindsamkeit zog mit seinen Oden noch die Generation des »Sturm und Drang« in seinen Bann, darunter Herder, Goethe und Schiller. Selbst für Hölderlin war er noch ein Vorbild der eigenen Oden und Hymnen, so berichtet es der Autor dieser sehr lesenswerten neuen Biographie. In Goethes ›Leiden des jungen Werthers‹ fällt in Anspielung auf eine Ode des Dichters der ergriffene Ausruf: »Klopstock!« was heutige, den »Werther« lesende Deutschschüler verwirrt bis erheitert.
Schon als Schüler begann Klopstock sein Jesus-Epos »Der Messias«, die erste große Hexameter-Dichtung deutscher Sprache, an deren 20 Gesängen er 30 Jahre lang arbeitete. Kauffmann verknüpft in seiner Biographie Leben und Werk des Dichters – etwa, wie seine Gedichte zur Französischen Revolution »für den politischen Diskurs ein poetisches Medium« schufen. Doch auch die kulturpolitischen Programme seiner ›Deutschen Gelehrtenrepublik‹ sowie seine Schriften zur Sprache und Poetik werden anschaulich und in ihrem historischen Zusammenhang dargelegt.
Insbesondere Klopstocks Rechtschreib-Innovationen sorgten seinerzeit für Aufsehen. Herder schrieb empört über dessen »lächerliche und unsere ganze Nation beschimpfende Sprachverwirrung« und bemerkte spöttisch: »Der alte stolze Narr ist dem delirio nahe.« Dass Klopstocks radikaler Vorschlag gewöhnungsbedürftig war, den er 1778 unter dem Titel »Über die deütsche Rechtschreibung« publizierte, war für ihn kein plausibler Einwand: »Ich läugne äben so wenig, daß mein Auge durch alles dies Ungewöhnliche anfangs auch beleidigt wurde. Aber das war bald forbei. Jetzt se ich es gern so rein for mir, wi mans hört und spricht.«
Klopstock plädierte dafür, dass jedes Wort so geschrieben werden sollte, wie es gehört wird. Gleiche Laute sollten immer durch denselben Buchstaben dargestellt werden (also f niemals mit v). Überflüssige Buchstaben sollten entfallen, etwa das h aus Thal (ganz schön radikal, oder?).
Auch lehnte Klopstock eine landschaftlich geprägte Orthografie ab, von welcher Herkunft auch immer, und bestand laut Kauffmann darauf, dass sich in einem »Vermittlungsprozess zwischen den regionalen Mundarten eine nationale Hochsprache herausgebildet habe, die auch weiterhin die Grundlage für die allgemeine Rechtschreibung in der »Büchersprache« des Deutschen sein müsse.« Klopstocks Vorschläge setzten sich bekanntlich nicht durch, und er selbst hat seine neue Variante der Rechtschreibung seit Mitte der 1780er Jahre nicht mehr angewandt.
Am Mittag des 14. März 1803 ist Friedrich Klopstock in Hamburg gestorben. Was dann geschah, so erfahren wir von Kai Kaufmann, »war eine Totenfeier, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hat. Sie glich einem Triumphzug, mit dem ein Dichterfürst geehrt wurde.« Seine Bestattung auf dem Friedhof in Ottensen kam einem Staatsbegräbnis gleich. Alle Glocken der Hamburger Kirchen läuteten. »Dem Leichenwagen folgten rund 100 Kutschen und, so berichtete die ›Hamburger Neue Zeitung‹, eine ›ungeheure Menge‹ von Menschen. Ihre Zahl wird auf 50.000 geschätzt.«
Kai Kauffmann mit seiner neuen grundlegenden Klopstock-Biographie ein äußerst facettenreiches, aber dennoch verständliches Buch geschrieben, an dem auch die chronologische Darstellung gefällt. Unbedingt lesen!
Titelangaben
Kai Kauffmann: Klopstock! Eine Biographie
Göttingen: Wallstein Verlag 2024
420 Seiten, 36
Reinschauen
| Inhaltsverzeichnis