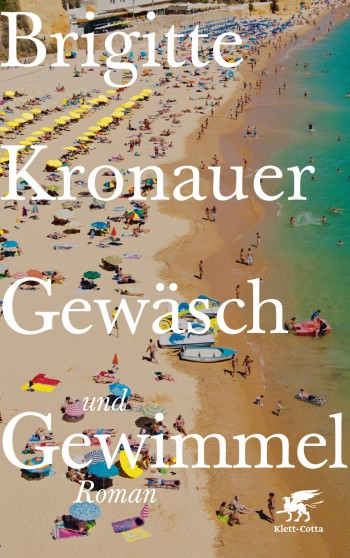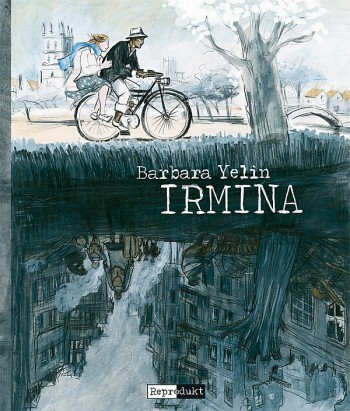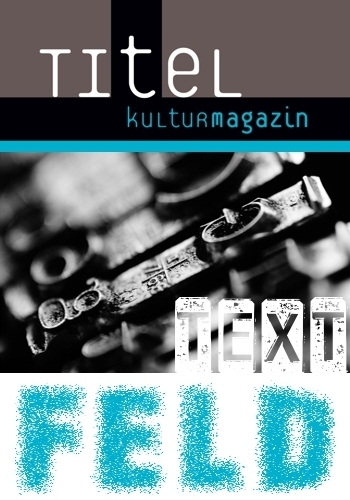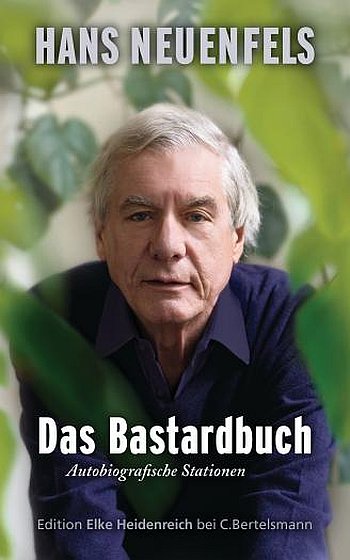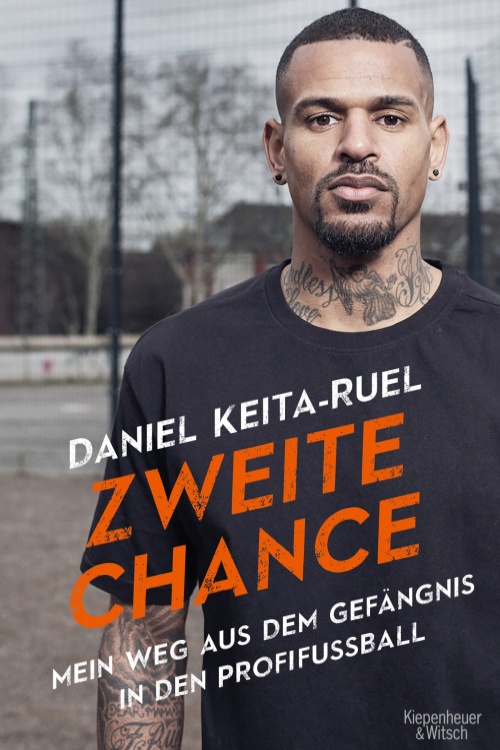»Eigentlich kann ich beim Schreiben den Kopf verlieren«, heißt es in einem der späten Gedichte von Friederike Mayröcker aus dem Jahr 2019. Der Suhrkamp Verlag hat nun pünktlich zum 100. Geburtstag einen opulenten Band mit Arbeiten aus der letzten Schaffensperiode vorgelegt – chronologisch angeordnet und mit einem respektvoll-klugen Nachwort von Marcel Beyer versehen. Von PETER MOHR
Ihre Kreativität war imponierend. Bis zuletzt hat die Grande Dame der österreichischen Literatur geschrieben und fast Jahr für Jahr »ihr letztes Buch« veröffentlicht. Im Herbst 2020 war noch der Band ›da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete‹ erschienen, in dem sie sich selbst als »Debütantin des Todes« bezeichnete.
»Wer Friederike Mayröcker liest, fühlt sich entführt in eine Wunderwelt, in einen unübersehbaren und letztlich unerklärlichen Zaubergarten«, hatte der damalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 2004 bei einem Empfang zu Ehren der bedeutenden Wiener Wortkünstlerin erklärt.
Dieser Zaubergarten der Sprache, den die Georg-Büchner-Preisträgerin des Jahres 2001 über mehr als 60 Jahren hegte und pflegte, war einerseits von urwüchsiger, beinahe archaischer Natur, andererseits aber auch geprägt von spielerischer Leichtigkeit und formalen Experimenten.
Die Begegnung mit Mayröckers opulentem Werk mutet wie ein Gang durch ein Labyrinth an – verschlungen und breit gefächert öffnen sich die bisweilen rätselhaften dichterischen Pfade. Mindestens ebenso geheimnisvoll wirkten ihre öffentlichen Auftritte in der bevorzugten schwarzen Kleidung.
In ihrem zum 90. Geburtstag veröffentlichten poetischen »Zettelkasten« fanden sich (nicht unbedingt typisch für die Dichterin) auch äußerst humorvolle Passagen. Da hieß es: »Keiner sonst liesz mich so schmachten, das sind die Ellipsen der Sprache ich meine das Kissen umarmend. Die Vorstellung hüpfender Ärsche bei Antonin Dvorák, fliegt es mir durch den Kopf.«
»Man weiß nicht, wohin man kommt – man lässt sich tagtäglich neu überraschen«, hatte Friederike Mayröcker, die am 20. Dezember 1924 in Wien als Tochter eines Volksschullehrers geboren wurde, ihr dichterisches Credo beschrieben. Spontaneität spielte in ihren Werken, die häufig aus einem Zettelkastensystem entstanden, eine mindestens ebenso große Rolle wie autobiografische und literarhistorische Motive (bevorzugt aus der Antike). Eugen Gomringer, Max Bense, HC Artmann und ihr langjähriger Lebensgefährte Ernst Jandl wurden zumeist als ihre literarischen Ahnen angeführt. Unübersehbar ist in ihren Prosawerken aber auch die Nähe zu Arno Schmidt, und darüber hinaus offenbaren sich Wurzeln, die in den Surrealismus reichen. Vor allem von der »subversiven Kraft« des jungen Salvador Dali fühlte sich der »Augenmensch« Mayröcker stark angesprochen. Darstellende Kunst war häufig die Inspirationsquelle für ihre Texte: »Ich fresse mich in sie hinein. Ja, ich verbohr mich buchstäblich in das Bild. Das kommt mir fast wie ein archäologischer Akt vor, bei dem sich mir verbal ein ungeheurer Horizont öffnet.«
Bei allem, was Friederike Mayröcker schrieb (es liegen knapp 100 Titel von ihr vor), war sie stets eine Grenzgängerin zwischen den literarischen Genres. Ihre lyrischen Momentaufnahmen von visuellen Eindrücken haben häufig stark deskriptiven Charakter, und ihre Prosa (›Das Herzzerreißende der Dinge‹ [1985], ›Stilleben‹ [1991] oder ›Lection‹ [1994]) liest sich wie eine assoziative Aneinanderreihung von poetisch verdichteten Aphorismen.
Friederike Mayröcker selbst hat einmal den Roman ›Brütt oder die seufzenden Gärten‹ (1998) als ihr wichtigstes Buch bezeichnet. Ein poetisches Opus Magnum, das aus Reflexionen, Dialogen und direkten Ansprachen an den Leser besteht und in dem die Autorin auch noch einmal nachhaltig ihre Meisterschaft als Hörspiel- und Theaterautorin unterstreicht. »Das Gedichte Schreiben ist so eine Art Aquarellieren, das Prosa Schreiben ist eine harte Kunst wie eine Skulptur Anfertigen«, hat Mayröcker selbst einmal die Genreunterschiede zu erklären versucht.
Der Dichter Ernst Jandl, mit dem sie über ein halbes Jahrhundert zusammenlebte und dem sie nach dessen Tod im Jahr 2000 ein unter die Haut gehendes ›Requiem‹ widmete, bezeichnete ihr Schreiben einmal als »das fortwährende Sprechen ihres Leibes«. Die mit vielen bedeutenden Preisen ausgezeichnete Friederike Mayröcker, die 1956 mit dem Band ›Larifari‹ debütierte, war als Person und mit ihrem umfangreichen Oeuvre zu einem monumentalen Gesamtkunstwerk geworden. Am 4. Juni 2021 ist die absolut singuläre Wortkünstlerin Friederike Mayröcker in Wien im Alter von 96 Jahren gestorben. Der vorliegende Band mit den späten Gedichten ist ein eindrucksvolles literarisches Vermächtnis – hoch poetisch, bisweilen rätselhaft und herrlich verspielt.
Friederike Mayröcker: Gesammelte Gedichte 2004-2021. Suhrkamp Verlag, Berlin 2024, 541 Seiten, 38 Euro
Friederike Mayröcker: Larifari. Illustriert und montiert von Nicolas Mahler. Insel Bücherei, Berlin 2024, 96 Seiten, 15 Euro