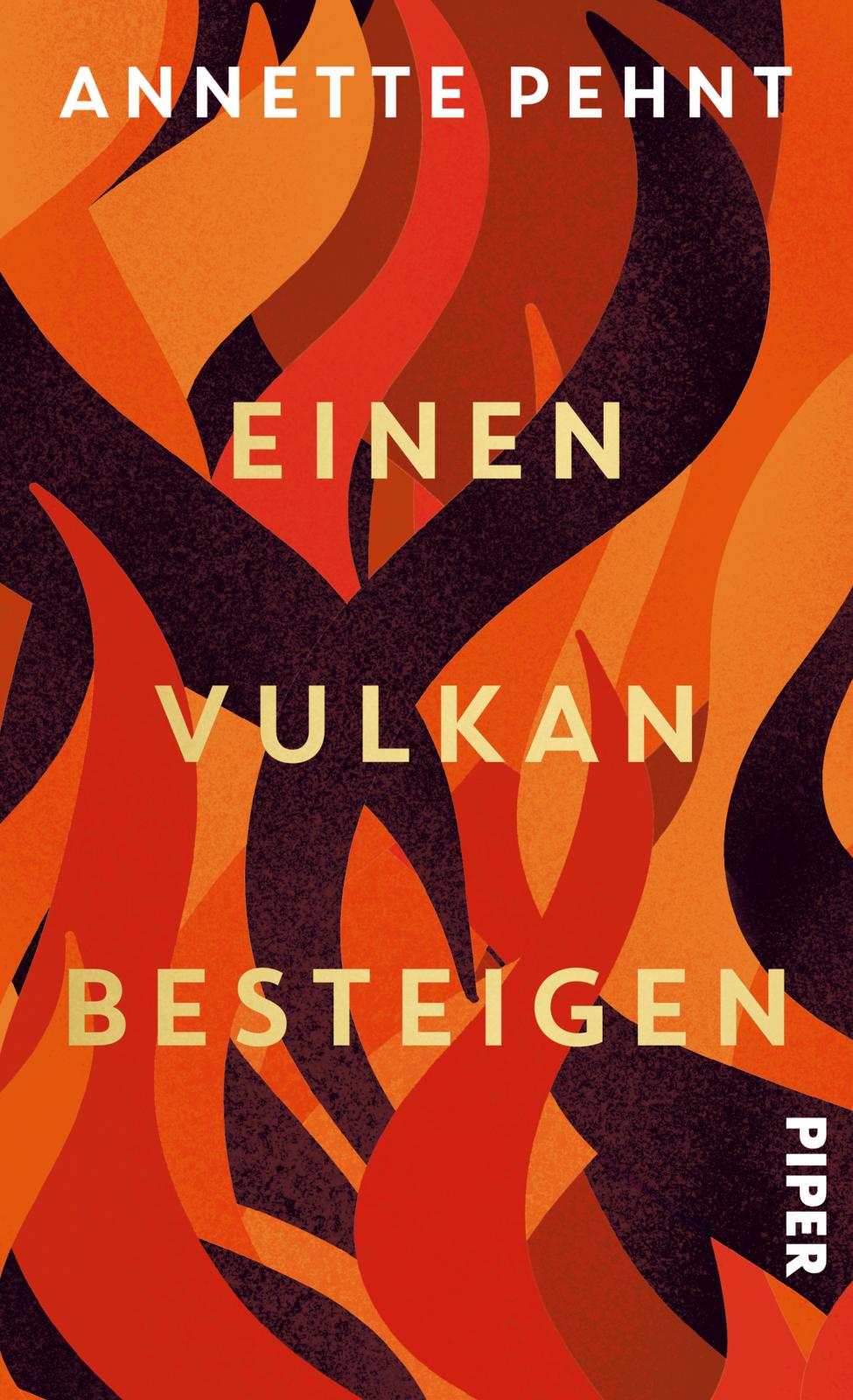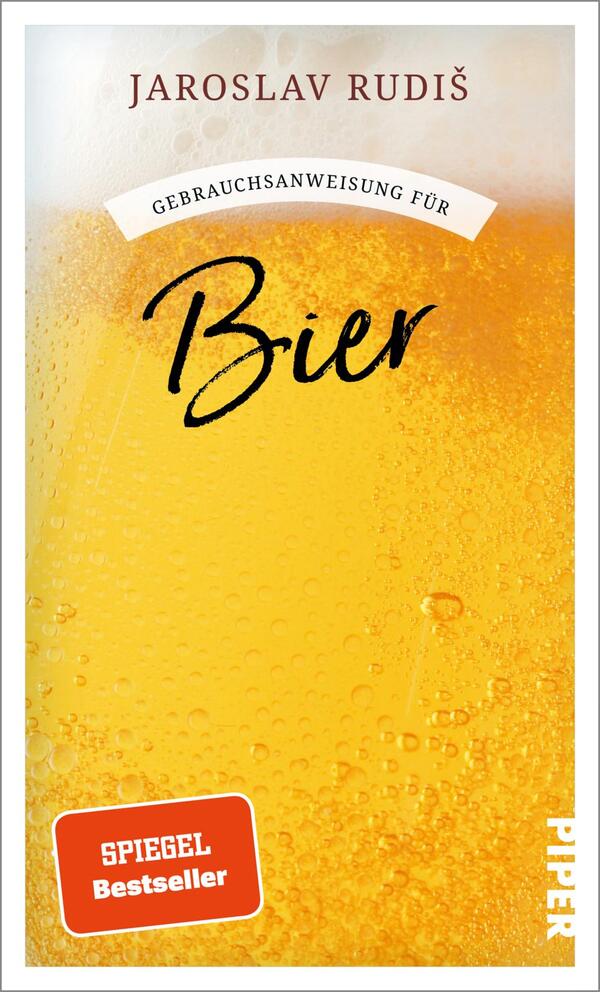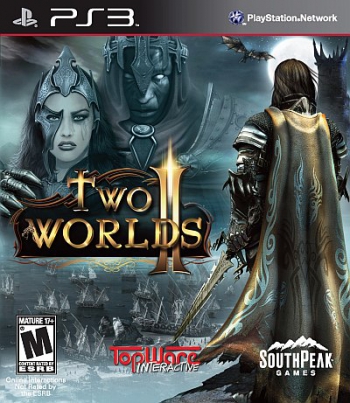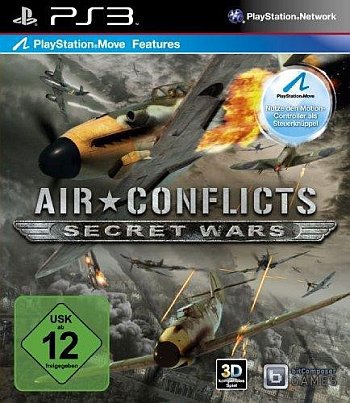Im Interview spricht RUDOLF THOMAS INDERST mit der Kulturwissenschaftlerin Lena Möller über die Geschichte und Bedeutung von Spielbüchern. Von moralischen Erziehungsinstrumenten über avantgardistische Literaturspiele bis hin zu Parallelen mit modernen Computerspielen zeigt Möller, wie stark interaktive Erzählungen unser Verständnis von Autonomie, Gesellschaft und Demokratie geprägt haben.
Rudolf Thomas Inderst: Guten Tag Lena Möller, vielen Dank, dass Sie sich für unser Gespräch über Ihr Buch ›Du entscheidest selbst! Die kulturelle Aushandlung von Wertvorstellungen in populären Spielbucherzählungen des 20. Jahrhunderts‹ (erschienen 2025 im Waxmann Verlag) Zeit nehmen. Bitte stellen Sie sich unseren Leser:innen kurz vor und beschreiben Sie Ihren Arbeitsalltag.
 Lena Möller: Ich freue mich sehr über die Einladung! Als Kulturwissenschaftlerin forsche und lehre ich seit sieben Jahren am Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg. Davor habe ich im Bachelor auch noch Geschichte studiert und im Master einen kleinen Zwischenstopp in Zürich am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturen eingelegt. Bei mir dreht sich alles um das historische und gegenwärtige kulturelle Alltagsleben der Menschen in Europa. Mein Arbeitsalltag sieht zum Beispiel so aus, dass ich Studierende in Themen- und Projektseminaren an unser Fach heranführe. Wir untersuchen, nach welchen unsichtbaren Regeln Menschen im Alltag zusammenleben und wie sie die Welt, die sie umgibt, wahrnehmen und gestalten. Dabei habe ich mich auf die Erzählforschung, die Populärkulturforschung und die Welt des Spiels spezialisiert. Ich beschäftige mich etwa mit spielbaren Erzählungen in analogen und digitalen Kontexten, dem kulturhistorischen Wandel von Märchenmotiven oder Krimirätseln, dem Erzählen über Erinnerungsorte und unterschiedlichen Formen der Alltagskommunikation.
Lena Möller: Ich freue mich sehr über die Einladung! Als Kulturwissenschaftlerin forsche und lehre ich seit sieben Jahren am Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg. Davor habe ich im Bachelor auch noch Geschichte studiert und im Master einen kleinen Zwischenstopp in Zürich am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturen eingelegt. Bei mir dreht sich alles um das historische und gegenwärtige kulturelle Alltagsleben der Menschen in Europa. Mein Arbeitsalltag sieht zum Beispiel so aus, dass ich Studierende in Themen- und Projektseminaren an unser Fach heranführe. Wir untersuchen, nach welchen unsichtbaren Regeln Menschen im Alltag zusammenleben und wie sie die Welt, die sie umgibt, wahrnehmen und gestalten. Dabei habe ich mich auf die Erzählforschung, die Populärkulturforschung und die Welt des Spiels spezialisiert. Ich beschäftige mich etwa mit spielbaren Erzählungen in analogen und digitalen Kontexten, dem kulturhistorischen Wandel von Märchenmotiven oder Krimirätseln, dem Erzählen über Erinnerungsorte und unterschiedlichen Formen der Alltagskommunikation.
Ihr Buchtitel beginnt mit dem Versprechen »Du entscheidest selbst!«. Inwiefern ist dieses Versprechen Ihrer Analyse nach trügerisch oder zumindest vorbelastet? Werden Leser:innen wirklich zu freien Autor:innen ihrer eigenen Geschichte, oder navigieren sie lediglich ein vorgegebenes System von »richtigen« und »falschen« Pfaden?
Spielbücher spielen im wahrsten Sinne mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Handlungsautonomie und den Grenzen, die durch das Medium selbst gesetzt sind – nicht selten mit einer Prise Humor. Genommen werden können ja nur die Wege, die von den Autor:innen zuvor angelegt worden sind. Die vollkommene Freiheit ist im Spielbuch eine Illusion. Das gilt auch für Computerspiele, die am Ende ebenfalls nur das ermöglichen, was die Programmarchitektur zulässt. Aktuell ist es spannend, dass sich die Grenzen durch den Einsatz generativer KI immer weiter verschieben. Wie viel Handlungsfreiheit lässt sich etwa erzeugen, wenn narrative Grundstrukturen im Moment des Spielens generiert werden?
Eine interessante Frage! Sie beschreiben zudem die »richtigen« und »falschen« Pfade als Metapher für den Lebensweg. Wie hat sich diese Metapher im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt? Ist der »falsche« Pfad heute vielleicht sogar der interessantere geworden, der mehr über unsere Gesellschaft aussagt als der »richtige«?
Das Motiv der Suche nach dem bestmöglichen Ausgang über richtige und falsche Pfade ist in der Erzähltradition eng mit dem Lebensweg des Menschen und den Maßstäben für ein gelungenes Leben verknüpft. Vor dem 20. Jahrhundert waren Spielbücher in der Form gesammelter Spielvorschläge stark moralerzieherisch ausgerichtet. Sie sollten nicht nur unterhalten, sondern auch christliche und bürgerliche Tugenden rund um eine rechte Lebensweise vermitteln. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm das Spielbuch dann unter dem Einfluss der Psychoanalyse eine neue Gestalt an. Statt eines moralischen Zeigefingers bot es vermehrt Rat, wie man das Beste aus sich herausholen kann. International tauchten immer mehr Spielbücher auf, die als spielbare Erzählung konzipiert sind. Sie spiegeln die Suche einer jungen Generation nach dem eigenen Platz im Leben in einer Welt, in es immer mehr Alternativen zu einem klar vorgefertigten Lebensweg gibt. Die 1950er und 1960er Jahre waren dann die Zeit vieler avantgardistischer Literaturspiele. Spielbücher befruchteten sich mit experimentellen Romanen, Rollenspielen und der frühen Computerprogrammierung. Der große internationale Durchbruch des Mediums in der Populärkultur gelang aber erst in den 1970er Jahren. Dabei hatten vor allem die Choose Your Own Adventures – eine Reihe spielbarer Abenteuergeschichten – maßgeblich Anteil daran, dass es ein Jahrzehnt später zu einem richtigen Spielbuch-Boom kam. In dieser neuen Spielbuchgeneration ging es vor allem um die eigene Selbstverwirklichung und das Entdecken fremder Welten. Statt Tugendhaftigkeit, Fleiß und Selbstoptimierung gewannen andere Werte an Bedeutung: »Glaub an dich, gehe Risiken ein und trau dich, du selbst zu sein!« Das sind Botschaften, die auch Disney und Dreamworks bis heute in ihren Geschichten verarbeiten. Darin wird ein neuer Wertepluralismus sichtbar. Der »falsche« Pfad kommt uns heute menschlicher vor. Wir identifizieren uns stärker mit den widersprüchlichen und auch mal scheiternden Figuren. Sie erinnern uns daran, dass zwischen »richtig« und »falsch« eine große Spanne liegt. Entsprechend finden wir Angebote anschlussfähiger, die möglichst viele Schattierungen bieten.
Das Spielbuch wird oft als Vorläufer des Computerspiels gesehen. Sehen Sie in modernen Open-World- oder narrativen Games (wie z. B. von Telltale Games oder in RPGs) eine Weiterführung oder gar eine Pervertierung der ursprünglichen Idee des Spielbuchs? Was ist der fundamentalste Unterschied?
Es gibt oft das Missverständnis, dass ein Medium das andere ablöst. Die Geschichte der Spielbücher ist aber eine Geschichte der wechselseitigen Befruchtung. Das sieht man sehr schön am interaktiven Netflix-Film ›Bandersnatch‹ aus dem Jahr 2018, der auf einer Meta-Ebene mit der Pfadstruktur eines Spielbuchs spielt und mit viel Retro-Nostalgie auf die Choose Your Own Adventures verweist. Umgekehrt gibt es viele analoge Spielbücher, die auf Filmen, Serien, Hörspielen und Computerspielen basieren. Natürlich haben sich die Möglichkeiten des interaktiven Erzählens im Zuge technischer Entwicklungssprünge immer weiter vervielfältigt. Der größte Unterschied liegt sicherlich darin, dass grafikbasierte Computerspiele seit den 1980er Jahren die fiktiven Welten auch visuell zum Leben erweckten und damit eine ganz neue immersive Erfahrung ermöglichten. Hinzu kommen die komplexeren Architekturen. Ich denke da sofort an das preisgekrönte Computerrollenspiel ›Baldurs Gate 3‹, das 2023 im Bereich des Interactive Storytellings ganz neue Maßstäbe gesetzt hat.
Ihre Arbeit verbindet Literaturwissenschaft, Kulturgeschichte und Game Studies. Vor welche besonderen methodischen Herausforderungen stellt einen ein solch hybrides Medium, das sich weder rein textuell noch rein ludisch analysieren lässt, wie Daniel Martin Feige und ich in den letzten Jahren bei der Arbeit mit unseren Autor:innen an unserem Handbuch Computerspiele. 50 zentrale Titel immer wieder herausgefunden haben?
Man muss sich auf jeden Fall von einigen Illusionen verabschieden. Ich kann nicht die gesamte internationale Kulturgeschichte der Spielbücher abbilden und sollte auch nicht nach dem ältesten Spielbuchvertreter der Welt suchen – so verführerisch das wäre. Angesichts einer Fülle an toller interdisziplinärer Fachliteratur musste ich aufpassen, nicht meinen kulturwissenschaftlichen Fokus aus den Augen zu verlieren. Wir erforschen in unserem Fach, wie sich komplexe kulturelle Zusammenhänge und Entwicklungen in konkreten Phänomenen des Alltags niederschlagen. Das heißt, ich konzentriere mich auf ausgewählte Spielbuchreihen und untersuche anhand einer spezifischen Fragestellung, was sie mir über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Wertvorstellungen ihrer Zeit erzählen. Dann kann ich auch im zeitlichen, räumlichen und sozialen Vergleich Entwicklungen nachvollziehen.
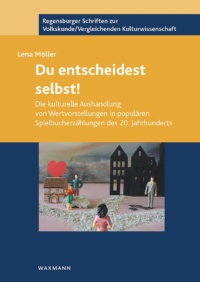 Was hat Sie persönlich am meisten überrascht, als Sie die Entwicklung dieser Spielebücher nachgezeichnet haben? Gab es ein besonders kurioses, einleuchtendes oder amüsantes Beispiel für einen »falschen« Pfad, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Was hat Sie persönlich am meisten überrascht, als Sie die Entwicklung dieser Spielebücher nachgezeichnet haben? Gab es ein besonders kurioses, einleuchtendes oder amüsantes Beispiel für einen »falschen« Pfad, das Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Mich hat wirklich fasziniert, dass es in den 1960er Jahren schon so viele Experimente gab, interaktive Erzählungen computerbasiert umzusetzen. Besonders fies fand ich ein Spielbuch aus dem Jahr 1968 mit dem übersetzten Titel The Art of Asking Your Boss for a Raise des französischen Schriftstellers Georges Perec. Es lehnt sich bewusst an die Navigationspfade eines Computersystems an. Man schlüpft in die Rolle eines Büroangestellten, der versucht, bei seinem Chef eine Gehaltserhöhung einzufordern. Der Witz ist, dass das Spielbuch in einem Labyrinth aus allen möglichen Schleifen mündet, sodass der arme Angestellte sein Ziel nie erreicht. Schöner kann man den Menschen als kleines Rädchen im Getriebe der kapitalistischen Arbeitswelt nicht darstellen.
Abschließend: Wenn Sie selbst ein modernes Spielbuch nach Ihren Forschungserkenntnissen konzipieren müssten – welches gesellschaftliche Dilemma unserer Zeit wäre Ihrer Meinung nach perfekt dafür geeignet, es in »richtigen« und »falschen« Pfaden zu explorieren?
Ich denke, das demokratiebildende Potenzial interaktiver Erzählungen wird häufig unterschätzt. Die Möglichkeit, frei zu wählen, Handlungsoptionen abzuwägen und Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen ist für mich gelebte Demokratie. Ich fände es spannend, den Alltag in einem TV-Sender zum Schauplatz zu machen. Auf was für Anweisungen hört die Moderation im Ohr und wo weicht sie von den Vorgaben ab? Handelt es sich hier um eine Verschwörungstheorie oder um eine seriöse Info mit Nachrichtenwert? Das fände ich spannend!
Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft!
Titelangaben
Lena Möller: Du entscheidest selbst!
Die kulturelle Aushandlung von Wertvorstellungen in populären Spielbucherzählungen des 20. Jahrhunderts.
Münster: Waxmann Verlag 2025
420 Seiten 44,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Inhaltsverzeichnis
Weiterlesen
| Lena Möller: Zur Lehrstuhlwebseite
| Lena Möllers Profil auf der Seite des Waxmann-Verlags