Nach mehreren Bänden Tagebüchern von Alice Schmidt sind jetzt auch die Tagebücher von Arno Schmidt erschienen. Es sind oft nur knappe Notizen, aber zusammen mit den erläuternden Kommentaren fächern sie eine interessante und nicht einfache Persönlichkeit auf, die ein grandioses Werk hinterließ. In einer großformatigen Kladde schrieb Arno Schmidt fünf Jahre lang ein eigenes Tagebuch, es gibt Aufschluss über sein Arbeitsethos, persönliche Nöte und seine finanzielle Lage. GEORG PATZER hat es gelesen.
 Viele Jahre lang schrieb Alice Schmidt Tagebuch, ab 1948, und das war eine wunderbare Entscheidung für uns Nachlebenden. Denn was sie notierte, ist nicht nur ein präziser Bericht über die Not der Nachkriegsjahre, sondern gibt auch wunderbar Aufschluss über das Werden des Schriftstellers Arno Schmidt. Es war seine Idee, sie schrieb im September 1948: »A. schlägt mir Tagebuchführung vor + Gedanke zündet.« Schön sind ihre Tagebücher auch, weil sie einen eigenen Ton hat, indem sie oft ziemlich frisch erzählt, was ihr und ihnen passierte, wie sie miteinander lebten und darbten und wie sie ihren Mann in seinen Arbeiten unterstützte. Oft übernahm er ja auch Passagen aus ihrem Tagebuch und benutzte sie für seine Romane. Ziemlich abrupt bricht sie ihre Eintragungen am 3. Juli 1956 ab, warum, »läßt sich nicht zweifelsfrei eruieren«, schreibt Susanne Fischer, die ihre Tagebücher herausgegeben und kommentiert hat und jetzt auch Arno Schmidts Tagebücher. Erst 1965 nahm Alice ihr Tagebuch allmählich wieder auf, schrieb aber unregelmäßig.
Viele Jahre lang schrieb Alice Schmidt Tagebuch, ab 1948, und das war eine wunderbare Entscheidung für uns Nachlebenden. Denn was sie notierte, ist nicht nur ein präziser Bericht über die Not der Nachkriegsjahre, sondern gibt auch wunderbar Aufschluss über das Werden des Schriftstellers Arno Schmidt. Es war seine Idee, sie schrieb im September 1948: »A. schlägt mir Tagebuchführung vor + Gedanke zündet.« Schön sind ihre Tagebücher auch, weil sie einen eigenen Ton hat, indem sie oft ziemlich frisch erzählt, was ihr und ihnen passierte, wie sie miteinander lebten und darbten und wie sie ihren Mann in seinen Arbeiten unterstützte. Oft übernahm er ja auch Passagen aus ihrem Tagebuch und benutzte sie für seine Romane. Ziemlich abrupt bricht sie ihre Eintragungen am 3. Juli 1956 ab, warum, »läßt sich nicht zweifelsfrei eruieren«, schreibt Susanne Fischer, die ihre Tagebücher herausgegeben und kommentiert hat und jetzt auch Arno Schmidts Tagebücher. Erst 1965 nahm Alice ihr Tagebuch allmählich wieder auf, schrieb aber unregelmäßig.
Ein halbes Jahr später, am 1. Januar 1957, beginnt Arno Schmidt selbst mit einem Tagebuch und führt es bis zum 31. Dezember 1962. Und das ist völlig anders. Denn Schmidt erzählt nicht oder nur selten, seine Eintragungen sind meist von einer rigorosen Knappheit und Kürze: Sie beginnen stets mit Notizen über das Wetter, etwa »Morgens +4 1/2, Regen: Tief!!: Wunderbar! / hält den ganzen Tag über an« am 4. Januar 1957 oder »Morgens kühl / Mittags heiß, mit Wolken / Nachmittags Cumuli / Abends wieder klar« am 24. Juli 1959.
Danach kommen kurze Notizen über die Post, Arbeiten von ihm und seiner Frau, Geldsendungen, Spaziergänge, Träume, Besuche, selten etwas Politisches und zwischendurch immer auch wieder einmal Privates, über Krankheiten, die Grippe oder seine Herzbeschwerden. Einiges, was immer wiederkehrt, ist in Abkürzungen oder Zeichnungen notiert: N steht für ein Nickerchen, P für Post, ein Pfeil nach unten für Schlaftabletten, ein Glas für Alkoholkonsum, und schließlich L für Liebe, besser: Sex (mit dem Zusatz, wo, also: Tisch oder Matratze), O für Onanieren. Warum er vor allem letzteres wie ein Buchhalter notiert hat, ist nicht ganz klar, auch wenn Fischer in ihrem Vorwort schreibt: »Da eines von Schmidts Themen bei der Analyse literarischer Werke – wenigstens ab Sitara und der Weg dorthin, dann vor allem in Zettel’s Traum – der Einfluß sexueller Dispositionen und Erlebnisse war, kann seine Akribie in diesem Bereich kaum überraschen.« Andere Deutungen wären denkbar. Zumal die Frequenz in diesen Jahren stark abnahm und er mit spürbarem Entsetzen auch seine Angst vor Impotenz notierte, wenn »es« mal nicht klappte, etwa am 27.2.1960: »L – geht nicht! Impotent gearbeitet!« Da war er noch nicht mal 50 Jahre alt.
Überhaupt: Frau Fischer. Was sie in jahrelanger Arbeit an Kommentaren zu diesen Tagebucheinträgen geschrieben hat, ist schon ein Nobelpreis wert, leider gibt es keinen für Herausgebertum. Denn ohne ihre Kommentare wären die meisten Einträge unverständlich oder uninteressant. Drei willkürlich herausgegriffene Beispiele: Am 17. Januar 1957 notiert Arno Schmidt:
P: Andersch (nimmt ›Goethe‹) / 3 Nachtprogramme an SFB / N: 2 / Einkaufen:
Hemd; Bücher über die franz. Revol. Thiers & Kropotkin; Kipling; Strafgesetzbuch /
Lilli summt alles sauber u. badet / setzen uns ins Bett {ich lese Kropotkin, Lilli
Zeitung}
Oder am 9.4. 1960:
Murxen (halb betäubt. Grippe—Anfang?). – Lilli Haushalt usw. / P.: Krawehl (+ 1 Telegramm); Goverts (Vertrag Faulkner); Michels; Bücherliste (über Becks); Rowohlt 32.–;
Angebot Albert Lucian (teuer!) / Antworten Goverts + Krawehl entwerfen – kompliziert
Und am 1.8.1960:
Lilli + Frau P. Haushalt. – Ich döse + murxe. / P.: 450.– Ffm; Ankündigung Rheinpfalz;
Drucksache (?); Buch + Brief S. Fischer—Verlag: Übersetzungsangebot + Erzählung
f. Sammelband / N / Dösen + blättern – vor allem Karl May – Lilli unten Faulkner /
Noch Bilder ansehen; zumal die ›Reise Wilhelmstein‹ / Dann schlafen. – Lilli heftet
noch Post ab.
Als Schmidt-Leser sind einem die meisten Namen geläufig, Goverts, Krawehl, Michels, Andersch, aber erst die Kommentare erläutern, was so ein schnell hingeworfener Name in diesem Zusammenhang bedeutet: Dass Andersch die Erzählung »Goethe und Einer seiner Bewunderer« in seiner Zeitschrift »Texte und Zeichen« abdrucken wird, dass Schmidt »Treffpunkt für Zauberer«, »Dya-Na-Sore« und »Wieland oder die Prosaformen« wegschickt: angenommen wurde Treffpunkt für Zauberer (Sendung auf SFB 1 am 4.10.1957). Dass Schmidt den Übersetzungsvertrag für »New Orleans Sketches« ohne Einwände unterzeichnet und am 10.4. abschickt, dass Wilhelm Michels ihn über Buchbestellungen informiert. Und Krawehl? Fischer kommentiert:
Krawehl bestätigte per Telegramm die Annahme von Kaff und erläuterte die Bedingungen (Vorschuß und Vorschußverrechnung, Publikationsfrist) im Brief (Ernst Krawehl an A. S., 8.4.1960). Schmidt drängte in seiner Antwort auf die Publikation im Jahr 1960 und wollte gleichzeitig einen Vertrag über Belphegor für 1961 abschließen; notfalls wegen des schwierigen Kaff-Satzes auch in umgekehrter Reihenfolge (A. S. an Ernst Krawehl, 9.4.1960, DLA).
So wird aus hingeworfenen Namen eine Geschichte. Danke, Frau Fischer.
Deutlich wird an diesen beiden Stellen eines der Hauptthemen des Tagebuchs: Schmidts Korrespondenz mit Verlagen, Lektoren und Redakteuren, denen er seine Arbeiten anbietet. Auch Honorare werden penibel aufgezeichnet. Und es wird auch deutlich, in welchem hohen Tempo Schmidt schrieb und übersetzte, weil er auch immer sein »Pensum« notierte. Übrigens war auch seine Frau Alice sehr fleißig, indem sie neben der Hausfrauentätigkeit seine Arbeiten ins Reine schrieb, korrekturlas und viel Post erledigte. Was ihm manchmal nicht schnell genug ging, immer wieder schrieb er entnervt, dass sie ihm zu langsam arbeitet, etwa bei seiner Collins-Übersetzung: »Lilli (in ihrer gemütlichen faulen Art, schreibt 2 Ss. Collins) (…) Auseinandersetzung Collins: ihre unglaubliche schlampige Arbeitsweise, ein Pensum von 3h über den ganzen Tag zu verteilen – ich mach das auch nicht mehr mit! Nie wieder!« Und einen Tag später: »28.7. Ich Collins Pensum – und dann, ab 10h sitzen und auf Alice’s letzte 6, 7 Seiten warten! / Um 17h immer noch: sie hat eben – heiter + unerschütterlich—sadistisch den ›Endspurt‹ begonnen – ich bin halb wahnsinnig ob all der seit 8 Tagen überall herumliegenden 20 Papierstapel!!!« So ganz scheint er nie verstanden zu haben, was er an ihr hatte: »(Lilli faselt: daß sie 40–50 % ausmachte, usw. (Dabei soll sie froh sein, daß …….).« (7.11.1958)
Dabei hatte sein Fleiß auch etwas Erzwungenes, nicht nur, dass er ein unerschütterliches Arbeitsethos hatte. In seiner Rede zur Verleihung des Goethe-Preises sagte er: »Sei es noch so unzeitgemäß und unpopulär; aber ich weiß, als einzige Panacee, gegen Alles, immer nur ›Die Arbeit‹ zu nennen; und was speziell das anbelangt, ist unser ganzes Volk, an der Spitze natürlich die Jugend, mit nichten überarbeitet, vielmehr typisch unterarbeitet: ich kann das Geschwafel von der ’40-Stunden-Woche‘ einfach nicht mehr hören: meine Woche hat immer 100 Stunden gehabt«.
Aber es trieb ihn natürlich auch die Notwendigkeit, seine Familie zu ernähren und dann vor allem seine Schulden bei Michels abzuzahlen, denn der hatte ihm ein Darlehen gewährt, mit dem die Schmidts das ersehnte Haus in der Abgeschiedenheit eines Dorfs, nämlich Bargfeld, kaufen konnten. Weswegen er Michels Besuche eigentlich nur ertrug: »P.: Michels (er ist manchmal ziemlich idiotisch! Ich erinnere mich, vorsichtshalber, des Geldes, das er mir geliehen hat (ansonsten müßte man alle Geduld mit dem Kaulquappen—Typ verlieren!))«. (29.9.1961) Auch die Tilgung des Kredits notierte Schmidt in seinem Tagebuch, bis 1962 war er zurückgezahlt. Er brach mit ihm sehr abrupt, nachdem Michels sich auch in Bargfeld ein Haus gekauft hatten.
Überhaupt: die Menschen. Sehr deutlich wird in diesem Tagebuch, wie sehr er es hasste, in seiner Ruhe und in seiner Arbeit unterbrochen zu werden. Vor allem die oft tagelangen Besuche von Michels gingen ihm deutlich auf die Nerven: »Michels kommen. Bilder, zumal Venedig (Haus d. Marco Polo). Viel Dreck geschwätzt« heißt es da, oder »die Kattau quatscht 1 Stunde / sofort anschließend Michels bis 10! (Dies Plappern ist das Allerekelhafteste; ich bin jedesmal danach reif für 4 Aspirin!)«. Und auch die Ausflüge, die Michels mit den Schmidt unternehmen, sind ihm nicht recht: ». Michels 11–17h30 Fahrt in den Odenwald – abscheulich langweilig! – Lilli natürlich begeistert«. (3.11.1956) Auch bei anderen Besuchern notiert er: »Schlotters von 16–2.30 = 10 ½ Stunden / Entsetzliches Geschwätz«. Oder über seinen Lektor: »Krawehl kommt, u. bringt – leider – viel Mist—Rezensionen (FAZ ↓), und die läppischen Antwortkarten des Verlages. Bis 19h viel Wind u. Dreck geschwätzt; wir belügen uns bis zur Langeweile. Endlich fährt er.«
Was verwundert, sind seine häufigen Ausfälle gegen seine Frau Alice, genannt Lilli, denn in ihren Tagebüchern kommen sie nicht vor. Das beginnt schon am 20.1.1957: »Lilli quält mich zu Tode mit ihrem verfluchten gefühllosen Zeitungsvorlesen: hat sie denn keine Ahnung, was Bücher schreiben heißt? Und so geht das seit Jahren!« oder am 24.1.: »Michels freche Schnauze; Lilli hilft ihm. (anschliessend stundenlange Ausfälle gegen mich).« Und zieht sich durch bis zu Gedanken an Trennung und Scheidung, so schreibt er »Abends schwerer Zank (über Lit. und mich: ich sei ›Diktator‹ usw. (…)) bis in Bruchnähe! Widerlich. Zeit Schlußmachen« am 11.1.1958, oder am 25.3.1960: »25.3. Lilli droht mit ›Scheidung‹. (Von mir aus!)«.
Weitere Aufreger für Schmidt sind etwa Alices Weigerung, mit ihm Sex zu haben, und das Essen. Oft notierte er, ob und wann sie ihm etwas kochte. Kulinarische Highlights waren es nie, aufschreibenswert war ihm kurioserweise Eisessen. Aber auch, wenn sie ihm eben nichts kochte, am 29.6. 1962 »(meist Gespräch vom ›Warm—Essen‹: Lilli macht sich einfach keine Vorstellung von meinem ständigen Hungergefühl!!)« und einen Tag später: »wieder kalt im Stehen etwas Fressen (es wird unerträglich!)«, auch im September 1959 »kein Essen (wieder bloß so im Stehen etwas Brot – wie 4 von 7 Wochentagen immer)« oder im September 1960: »›Essen im Stehen‹ (= Brot; wie an 4 von 7 Tagen in d. Woche – wenn ich ›Glück habe‹ ; sonst sind’s auch oft 5)«. Und noch am 21.12. 1962: »Hunger!!! (wie seit über 25 Jahren! Sch.)«. Von der heutigen Warte würde man sagen, dass er ja auch kochen könnte – aber Männer seiner und der nächsten Generation konnten das eben nur in den allerseltensten Fällen. Und es hört sich dann doch eher hartherzig an, wenn er die Trauer seiner Frau um die geliebte Katze Purzel nicht ernst nimmt und etwa am 29.12.1961 (aber auch öfter) notiert: »Lilli wimmert unaufhörlich wegen Purzel«.
Kurios sind seine häufigen Sätze »Lilli Haushalt«: Warum notiert er das? Oder die witzige Formulierung »Lilli summt« (sie staubsaugt) – hat ihn das gestört? Schön sind seine kurz hingeworfenen Beschreibungen der Natur, die er auf den täglichen Spaziergängen in und um Bargfeld beobachtete (inklusive Beschimpfungen der Bauern, beides kennt man aus seinen Romanen).
Nein, ein einfacher Mensch war Arno Schmidt nicht. Ein großer Schriftsteller, der sehr fleißig sein musste, um sich und seine Frau zu ernähren, um sich das Haus in Bargfeld kaufen zu können. Durch seine Tagebücher lernt man jetzt viele Facetten seiner Persönlichkeit kennen, die ihn nicht unbedingt sympathisch machen, die ihn aber in manchem kenntlich und auch menschlich erscheinen lassen. Im Rundfunkessay ›Die Meisterdiebe‹ sagte Schmidt: »Das Werk also funkelt: den schäbigen Rest, den Autor selbst nämlich, besieht man sich besser nicht!« Doch, man besehe sich ihn, und die Tagebücher sind dafür immer eine wunderbare Quelle.
Titelangaben
Arno Schmidt: Tagebücher der Jahre 1957-62
Herausgegeben von Susanne Fischer
Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung im Suhrkamp Verlag
Berlin: Suhrkamp 2025
800 Seiten, 68 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander



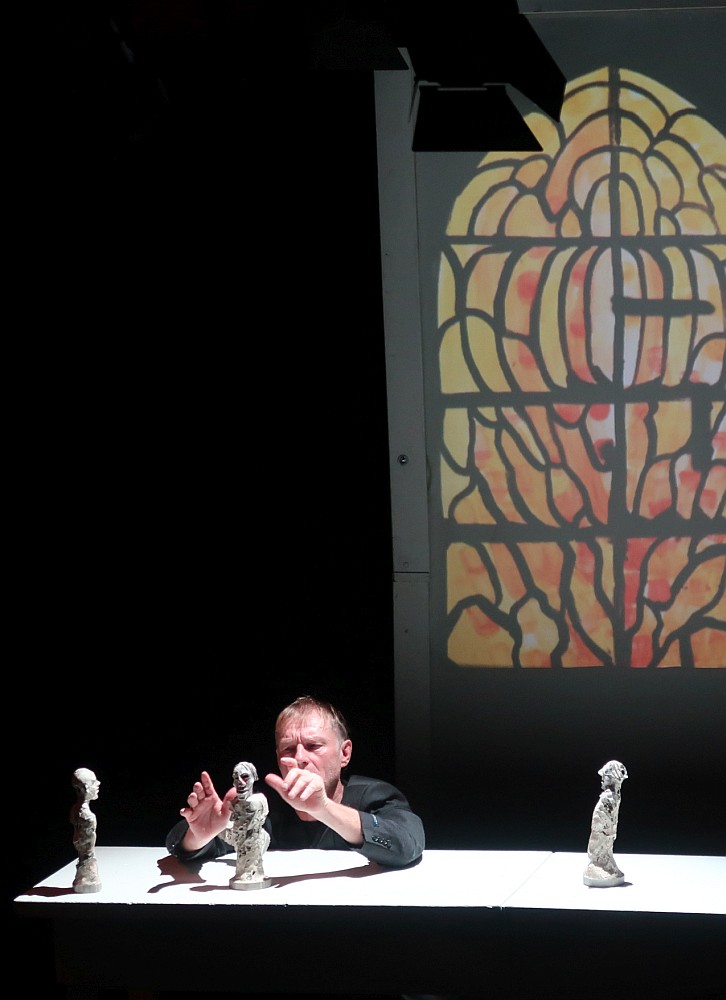

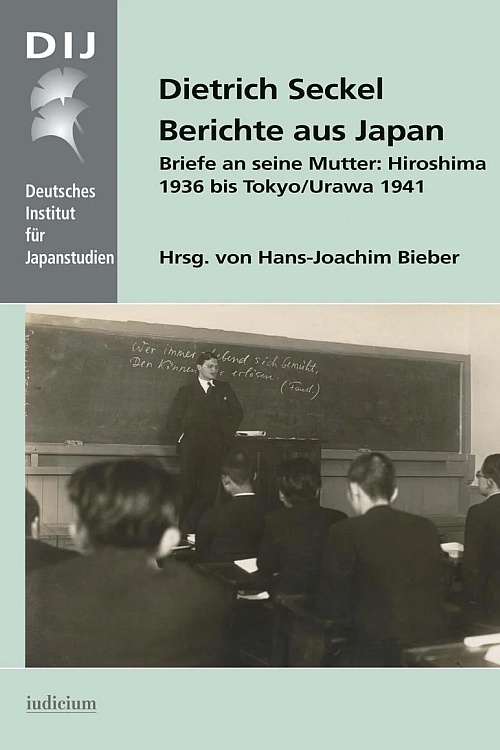




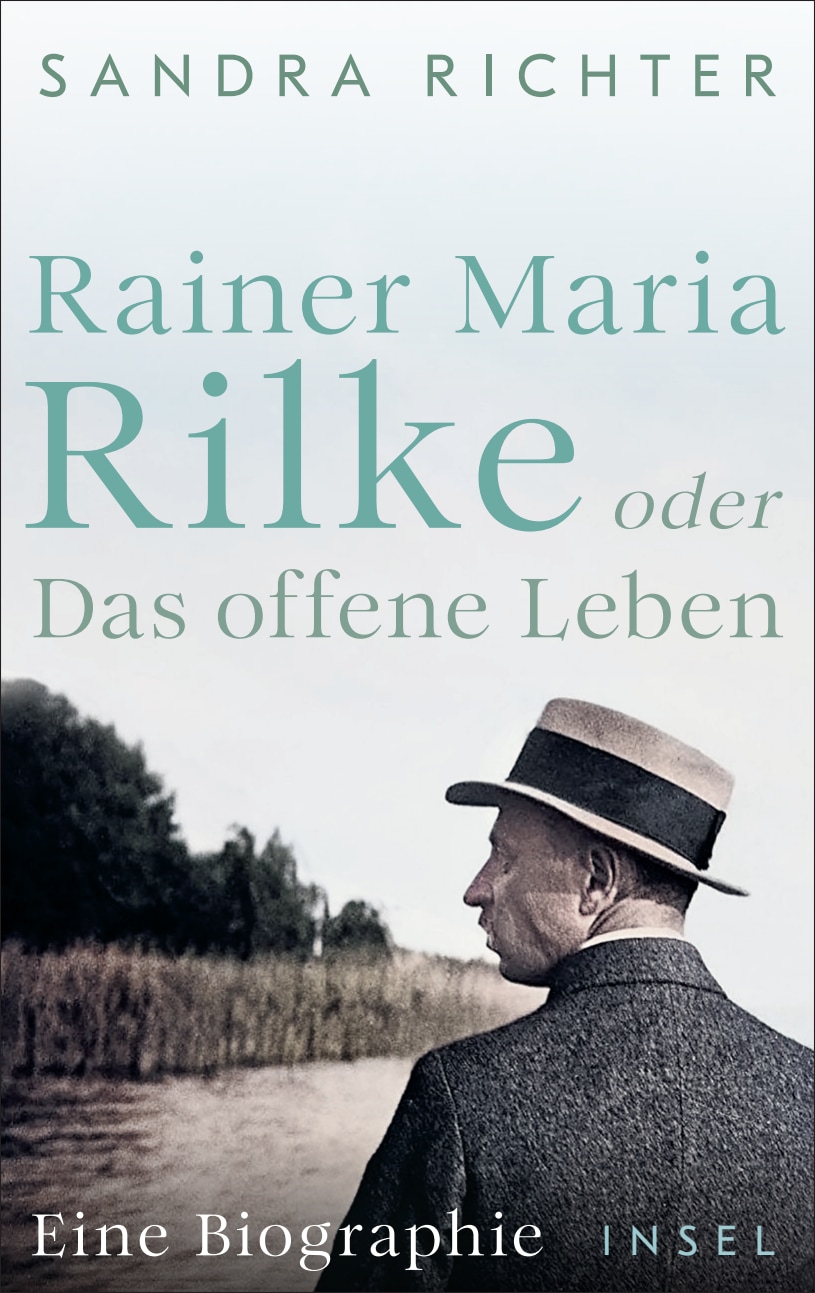
Wenn ich nur wüsste, wo ich das Ullstein-Bändchen über das „Tagebuch und den moderne Autor“ gelassen habe – im Beitrag, den er dort veröffentlicht hat, behauptet Arno Schmidt, wenn ich mich recht entsinne, es lediglich zu eher buchhalterischen Zwecken geführt zu haben. Interessant, dass es ihm auch dazu diente, Dampf abzulassen, wenn er sich über seine Mitarbeiterin in der Arno-&-Alice-Literaturproduktionsfirma ärgern musste. Ob ihn dies sympathisch oder gar menschlicher macht, wage ich nicht zu beurteilen. Ein Mensch, der die dunkle dumpfe Welt durch Kunst erhellt, hat bei mir immer einiges gut.
Danke für diese Besprechung. Man kommt an dem Werk nicht vorbei.
PS: Der Deutschlandfunk sendete eine Rezension, in der sich der Rezensent darüber beklagte, dass Schmidt den Mauerbau eher beiläufig zur Kenntnis nahm. Desweiteren beklagt er die nicht gerade freundlichen Ausbrüche Schmidts gegen seine Mitarbeiterin / Ehefrau Alice und hält das Tagebuch wohl für eine eher überflüssige Veröffentlichung. Die sehr viel interessantere Frage, warum ein Autor, der von Anfang an seine Veröffentlichungen kontrollierte, das Tagebuch nicht wegwarf oder sperrte, stellt er sich nicht.