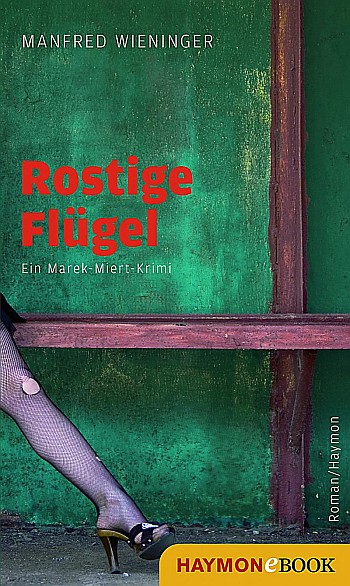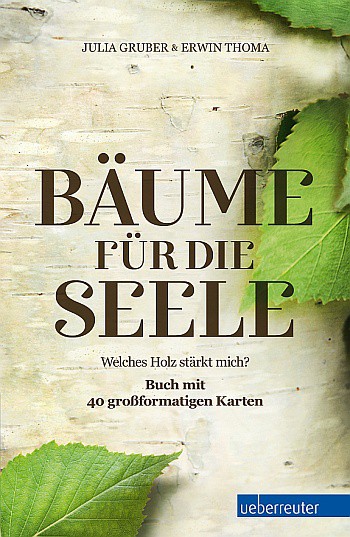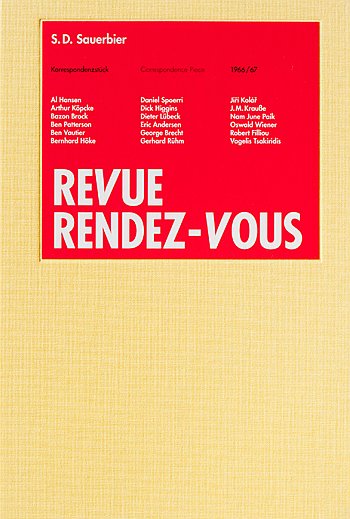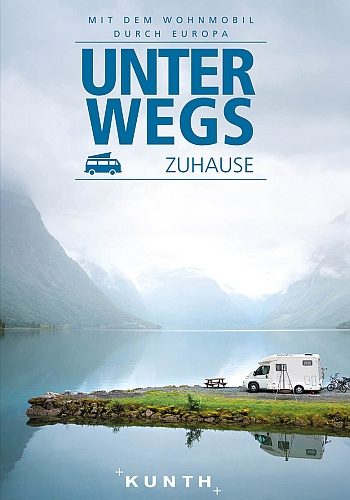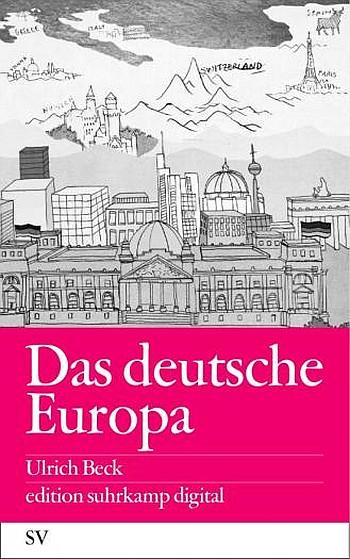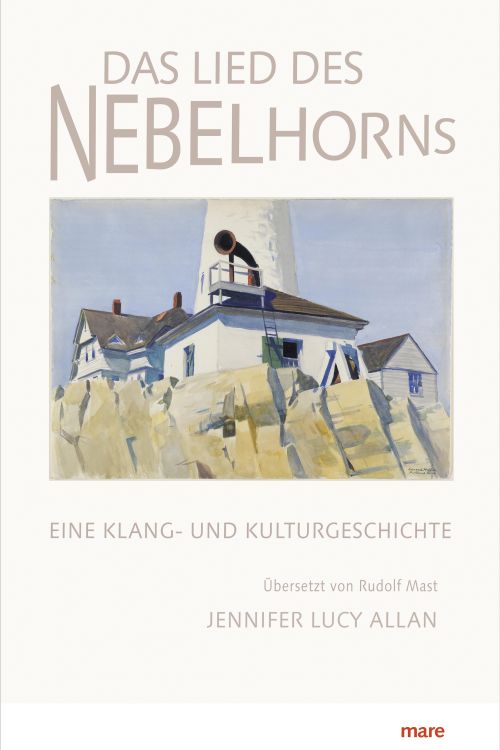Die Kulturkritik Galeanos und seine quasi journalistische Berichterstattung ausgesprochen narrativ daher. Schöne Geschichten um den Fußball, die schön sind, weil der Autor offenbar liebt, was er beschreibt. Von HOLGER SCHWAB
 Auf dem Buch-Cover ist der Blick aus einem Fußballstadion hinaus, über graue Berge hinweg in einen blass-blauen Himmel zu sehen. Außerdem ein paar Tausend Zuschauer und ein wenig Rasen. Vor und über allem anderen das Schwarz des Tribünendachs, das fast zwei Drittel der Fotografie einnimmt. Gesehen habe ich auf den ersten Blick etwas anderes: Ein UFO, eine fliegende Untertasse aus dem All in Richtung Erde unterwegs.
Auf dem Buch-Cover ist der Blick aus einem Fußballstadion hinaus, über graue Berge hinweg in einen blass-blauen Himmel zu sehen. Außerdem ein paar Tausend Zuschauer und ein wenig Rasen. Vor und über allem anderen das Schwarz des Tribünendachs, das fast zwei Drittel der Fotografie einnimmt. Gesehen habe ich auf den ersten Blick etwas anderes: Ein UFO, eine fliegende Untertasse aus dem All in Richtung Erde unterwegs.
Leuten, denen der Fußball bis heute ein unbekanntes Flugobjekt geblieben ist, werden Galeanos Buch wohl kaum in die Hände bekommen. Das ist schade, denn selbst im Falle hartnäckig fortdauernder Kick-Abneigung würden sie einige Dutzend schöne Geschichten gelesen haben, die schön sind, weil der Autor offenbar liebt, was er beschreibt. Hinzu kommt, dass er schreiben kann.
Thema in »Der Ball ist rund« ist die »Geschichte der Erinnerung und der Wirklichkeit des Fußballs«. Galeano versteht sein Buch als Reaktion auf eine erstaunliche Lücke: »Die offizielle Geschichtsschreibung nimmt den Fußball nicht zur Kenntnis. Die historischen Texte erwähnen ihn nicht, streifen ihn nicht einmal in Ländern, wo der Fußball ein wichtiger Ausdruck kollektiver Identität war und ist«.
Das mag zwar danach klingen, aber Galeano versucht gerade nicht, versäumte Arbeit akademischer Historiker nachzuholen. Von analytischem Abstand zum untersuchten Gegenstand ist wenig zu spüren. Von den vier im Klappentext erwähnten Identitäten des Autors (»Historiker, Schriftsteller, Journalist und Kulturkritiker«) macht deutlich die des Schriftstellers das Rennen. Geschichte zeigt sich hier vorwiegend in Geschichten. Entsprechend kommen auch die Kulturkritik Galeanos und seine quasi journalistische Berichterstattung ausgesprochen narrativ daher.
Der Autor ist in Südamerika (Uruguay) geboren. Wer auch nur ein wenig vom Thema versteht, weiß, dass der Fußball dieses Kontinents dem europäischen über Jahrzehnte hin vor allem eines Voraus hatte: Verspieltheit.
›Der Ball ist rund‹ feiert die Verspieltheit des Fußballs und ist selbst verspielt. Schon seine Aufmachung ist es: Fast jede seiner Seiten ziert ein kleines, schwarzes fast immer scherenschnittartiges Bild. Meist sind es Darstellungen freundlich altmodisch anmutender Fußballspieler in einzelnen Phasen unterschiedlicher Bewegungsabläufe mit und ohne Ball. Schon das gibt dem Buch etwas Fibelhaftes.
Wir lernen Fußballlesen. Wie seine Sprache (kann es sein, dass die Sprache südamerikanischer Autoren europäischen Lesern immer wieder altmodisch, wenn nicht sogar archaisch erscheint?) trägt auch die Gliederung zu diesem Eindruck bei: Kleinste, zum Teil nicht mal seitenlange Abschnitte, deren jeder eine eigene Überschrift trägt, welche meist ausgesprochen zuverlässig Auskunft gibt, worum es im Folgenden geht.
Galeano ERZÄHLT uns in winzigen Einheiten vom großen Spiel Fußball (hier gelingt es selbst noch dem Müdesten das Kapitel zu Ende zu lesen, bevor ihm die Augen zufallen, um dann anschließend traumhafte Spielzüge zu träumen: hervorragende Bettlektüre). Wovon wird erzählt?
Zu Beginn (Der Fußball, Der Spieler, Der Torwart, Der Star, Der Fußballfan, Der Fußballrowdy, Das Tor, Der Schiedsrichter, Das Stadion, Der Ball, etc. oder auch Die Ursprünge, Die Spielregeln und Die englische Invasion) gilt es, Grundlegendes abzuklären. Man erfährt, dass es die Göttin des Windes ist, die eines schönen Tages den misshandelten, missachteten Fuß des Mannes küsst und aus diesem Kuss der Fußballstar entsteht.
Dass der Fußballrowdy nie allein kommt, wenn er sich durch die Allmacht des Sonntags (bei uns wäre das eher die des Bundesliga-Samstags) für die Freudlosigkeit des Rests der Woche entlohnen lassen geht. Dass das Tor der Orgasmus des Fußballs ist. Dass es erst mit der zur Weltmeisterschaft 1938 eingeführten Blase mit Ventil möglich wird, schmerzfrei zu köpfen. Dass 1863 eine Fußballregel eingeführt wird, die lautet: »Die Fußtritte sind ausschließlich auf den Ball zu richten« und man 1871 den Torwart erfindet. Auch im weiteren Verlauf des Buches gibt es immer wieder diese Pendelbewegung zwischen (häufiger noch Gleichzeitigkeit von) Altbekanntem, das neu gesagt wird und so neues Leben erhält, und schlicht Informativem.
Feste Bestandteile werden Kurzüberblicke über den Verlauf sämtlicher Weltmeisterschaften inklusive noch kürzerer Überblicke über je parallele zeitgeschichtliche Ereignisse. Zu diesen zeitgeschichtlichen Ereignissen gehört bei jeder einzelnen (!) WM-Chronik seit 1962 die Nachricht, »gewöhnlich gut unterrichtete Kreise in Miami« prophezeiten den kurz bevorstehenden Sturz Fidel Castros. Auch hier ist Galeanos Blick südamerikanisch, was auch bedeutet: antiimperialistisch. Die Freude an der Beharrlichkeit Castros, die hier anklingt, scheint einer anderen verwandt: In der Beschreibung der sukzessiven Inbesitznahme und Veränderung des Fußballs – eines zunächst exklusiven Vergnügens der Kolonialherren, welches allenfalls mit den lokalen Eliten geteilt wurde -durch die lateinamerikanischen Habenichtse, kommt sie noch deutlicher zum Ausdruck.
Auch wenn er, was er sehr oft tut – und zwar meist nach Art eines Märchenerzählers im Trainingsanzug –, einzelne Spieler beschreibt, feiert er besonders die Underdogs, die der Fußball aus dem Elend ins Rampenlicht katapultiert (und manchmal auch wieder zurück). Solche Abschnitte heißen wie die Spieler oder »Tor durch …« (Piendibene, Atilio, Severino, Scarone, Zarra, Zizinho, Rahn, Di Stefano, Garrincha, Nilton, Puskas, Charlton, Gento, Beckenbauer, Maradona, etc. ). Sämtliche Spielerhymnen mit Überschrift beginnen mit den Worten »Es geschah …«.
Wie sich zur Freude über den doch immer nur einstweiligen und zunehmend einsameren Sieg Castros gegen den Geist der Zeit fast notwendig die Ahnung von der Aussichtslosigkeit dieses Kampfes gesellt, und sich mit ihr eine gewisse Melancholie einstellt, beschreibt Galeano auch den Fußball unterschwellig, aber zuweilen auch direkt als eine Art untergehendes Königreich. So findet er den Fußball, dem seine Bewunderung gilt, weniger in der näheren als in fernerer Vergangenheit, schon gar nicht aber in der Zukunft. »Die Geschichte des Fußballs ist eine traurige Reise von der Lust zur Pflicht«. Die Feinde dieses Fußballs, des Fußballspiels – von dem Albert Camus sagt, alles, was er über Moral wisse, habe er von ihm (auch das erfährt man hier – aber heißen ihm: Okkupation durch Nationalismus oder (mehr noch) durch Profit, Effizienz, Rentabilität, Perfektionierung der Physis (Schnelligkeit, Kraft), Risikoscheu und Fantasielosigkeit.
Wenn er sich ihnen auch, sei es in Gestalt der FIFA, des internationalen oder nationalen Fernsehens, oder mächtigen Sportartikelkonzerne wie Adidas voller gerechten Zorns zuwendet, so weiß er doch, dass seine Rolle die des Hundes ist, der den Mond anbellt: »Die Art des Spiels ist eine Form des Seins, die das jeweilige Profil jeder Gemeinschaft verrät …«.
Mit anderen Worten: Jede Gesellschaft hat den Fußball, den sie verdient.
| HOLGER SCHWAB
Titelangaben
Eduardo Galeano: Der Ball ist rund
Zürich: Unionsverlag 2000
272 Seiten, 9,90 Euro