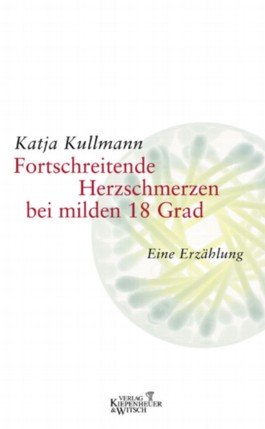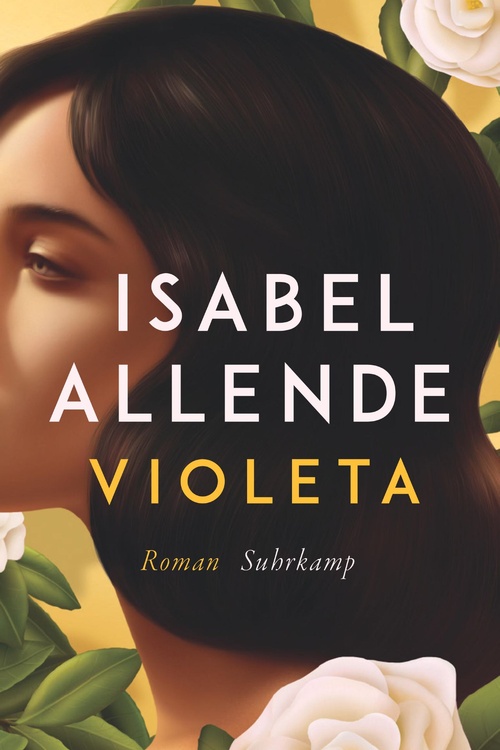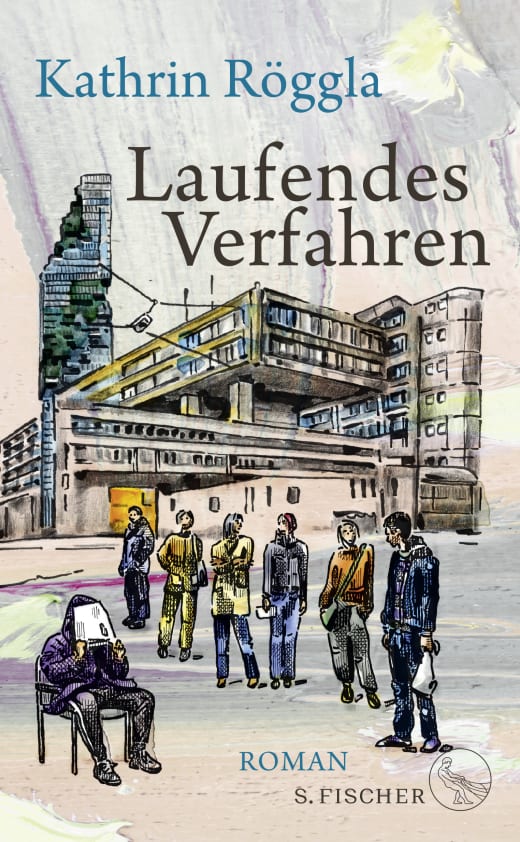In ihrem zweiten Roman ›Delphi‹ kreist Malin Schwerdtfeger um das Leben in fremden Kulturkreisen und um die Gratwanderung zwischen Außenseitertum und Anpassung. Von PETER MOHR
 »Erinnerungen sind wie unscharfe Filme«, heißt es in Malin Schwerdtfegers zweitem Roman »Delphi«, in dem die Autorin aus der Sicht eines bereits toten Mädchens die Odyssee einer Familie beschreibt. Handlungsauslöser ist ein uralter, nur wenige Minuten langer Super-8-Film. Die verschwommenen Sequenzen setzen einen überbordenden Erinnerungsmechanismus in Gang.
»Erinnerungen sind wie unscharfe Filme«, heißt es in Malin Schwerdtfegers zweitem Roman »Delphi«, in dem die Autorin aus der Sicht eines bereits toten Mädchens die Odyssee einer Familie beschreibt. Handlungsauslöser ist ein uralter, nur wenige Minuten langer Super-8-Film. Die verschwommenen Sequenzen setzen einen überbordenden Erinnerungsmechanismus in Gang.
Der Vater ist Archäologe, für ihn Passion und Profession zugleich; er zieht von Deutschland nach Athen und dann weiter nach Jerusalem – mit ihm seine Frau und die vier Kinder. So kreist dieser Roman in weit ausholenden erzählerischen Bögen vor allem um das Leben in fremden Kulturkreisen, um die Gratwanderung zwischen Außenseitertum oder Anpassung.
Die Kinder sind die Leidtragenden, denn der Vater ist stets unterwegs, und die überforderte Mutter fühlt sich in Jerusalem auf seltsame Weise von einem Kreis orthodoxer Juden angezogen, nennt sich fortan Schoschana und zieht in der Küche eine koschere Grenze. Die zum Judentum konvertierte Protestantin landet am Ende in einer psychiatrischen Klinik. Überhaupt geht es in diesem Roman ziemlich schräg zu.
Auch der in Friesland lebende Großvater kommt unheimlich daher. Er birgt Wasserleichen, um sie dann auf einem Privatfriedhof beinahe rituell beizusetzen. Die Schwelle zwischen Leben und Tod spielt schon durch die ungewöhnliche Ich-Erzählerin (»Ich wurde geboren, um zu sterben.«) eine ganz zentrale Rolle, überdies pendelt man durch den Beruf des Vaters und die antiken Handlungsschauplätze stets zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
Malin Schwerdtfeger, die 2000 mit den Erzählungen »Leichte Mädchen« debütierte, erzählt mit viel Liebe zum Detail von den unterschiedlichsten Schauplätzen, die sie offensichtlich aus eigenem Erleben kennt. Dennoch bleibt das Leben am Krisenherd Jerusalem zu Beginn der 90er Jahre seltsam idyllisch: »Unser Vater in seinem Subaru war eine Enklave der Neutralität.« Die beiden ältesten Kinder Linda und Robbie schwänzen dreimal pro Woche die Schule, um an der Universität Vorlesungen über Musikethnologie und Assyriologie zu besuchen.
Das ist eine wunderbare Geste der Völkerverständigung und ein Musterbeispiel für tugendhaften Bildungshunger, aber handeln so deutsche Teenager in einem fremden Kulturkreis?
Vieles an diesem Roman wirkt künstlich arrangiert, auch die fremden Schauplätze werden von einem folkloristischen Nebel eingehüllt. Großes hat Malin Schwerdtfeger im Sinn gehabt, über das »appollinische und dionysische Prinzip« in »Delphi« referierte sie kürzlich im Literarischen Colloquium in Berlin. Aber anscheinend hat die Autorin ihrem ambitionierten Werk selbst nicht so ganz über den Weg getraut, denn in den letzten Sätzen löst sie die Handlung selbst erklärend auf. »Ich muß mich nicht erinnern. Ich bin die Erinnerung«, lässt sie die im Kindesalter verstorbene Ich-Erzählerin resümieren.
Titelangaben
Malin Schwerdtfeger: Delphi
Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag 2004
296 Seiten, 18,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander