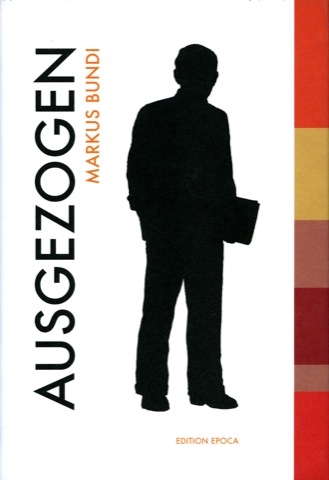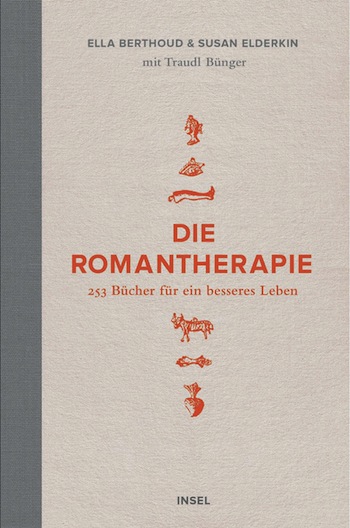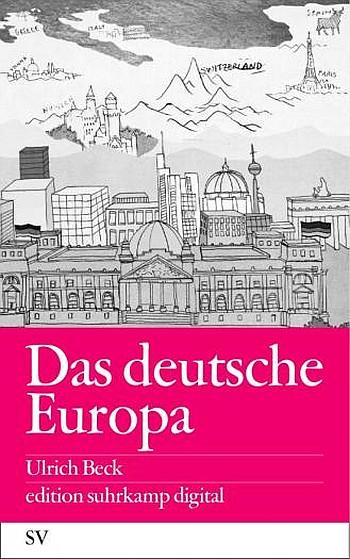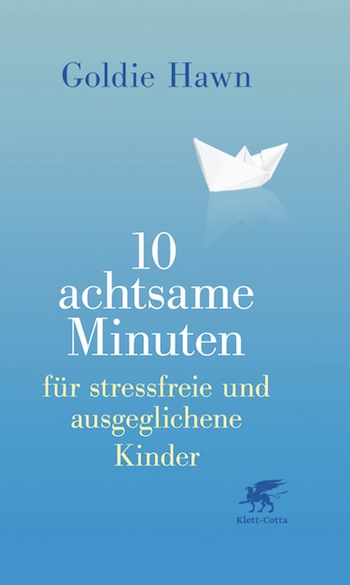Knipp liefert eine umfassende Geschichte des Flamencos, nicht im Mindesten romantisch, aber dafür von hohem Unterhaltungswert. Er rechnet mit den Mythen und Legenden ab, die um den spanischen Tanz entstanden sind. Von EVA KARNOFSKY
 Dass er aus Spanien kommt, das weiß man noch, aber dann erschöpfen sich unsere Kenntnisse des Flamencos meist schon. Wann entstand er? Und warum? Und wer hat ihn eigentlich entwickelt? Antworten auf diese Fragen gibt der Romanist und Journalist Kersten Knipp in seinem Buch mit dem schlichten Titel Flamenco. Er zieht eine Linie von der Entstehung des Flamencos um 1830 im Umfeld der andalusischen Bohème bis zu den jüngsten Entwicklungen der Gegenwart.
Dass er aus Spanien kommt, das weiß man noch, aber dann erschöpfen sich unsere Kenntnisse des Flamencos meist schon. Wann entstand er? Und warum? Und wer hat ihn eigentlich entwickelt? Antworten auf diese Fragen gibt der Romanist und Journalist Kersten Knipp in seinem Buch mit dem schlichten Titel Flamenco. Er zieht eine Linie von der Entstehung des Flamencos um 1830 im Umfeld der andalusischen Bohème bis zu den jüngsten Entwicklungen der Gegenwart.
Dabei kommt es offensichtlich darauf an, den Leser nicht nur zu informieren, sondern auch zu amüsieren, mit zahllosen Anekdoten und kleinen Geschichten: So zieht etwa der Sänger Antonio Chacón auf einem Esel durch die Lande und der bislang größte Star des Flamencos, José Monge Cruz alias Camarón de la Isla, stirbt eines tragischen Drogentodes. Ausführlich schildert Knipp die herbe Welt der sogenannten Cafés Cantantes, in denen ab 1860 die ersten Flamencosänger auftraten und sich vor einem kräftig alkoholisierten Publikum behaupten mussten.
Ein Kapitel ist dem Dichter Federico García Lorca gewidmet. Gemeinsam mit dem Komponisten Manuel de Falla veranstaltete er 1922 in Granada einen großen Flamenco-Wettbewerb. Im Schatten der Alhambra entwickelten die beiden großen spanischen Künstler ein romantisches Ideengut, das sie schließlich dazu antrieb, das erste internationale Flamenco-Festival zu organisieren.
Doch auch von den spanischen Bergwerken ist die Rede, in deren Umfeld ein Teil des Flamenco-Repertoires entstand, die Cantes de las minas (Minengesänge). Der sanfte Klang der Cantes de ida y vuelta (Gesänge vom Kommen und Gehen) stammt dagegen aus dem karibischen Raum – sozusagen eine Spätfolge des spanischen Kolonialismus, der sich damit auch im Flamenco wiederfindet. Ein weiteres Kapitel ist der Geschichte des Tanzes gewidmet.
Das Buch liest sich leicht, nicht nur dank der eingängigen Sprache, sondern auch, weil Knipp zahlreiche Legenden rund um den Flamenco gesammelt hat. Dennoch bewahrt der Autor immer eine gewisse Distanz dazu, da diese Legenden den Flamenco ausschließlich mit der Geschichte der Gitanos, der spanischen Zigeuner, verbinden und ihn als Ausdruck ihrer historisch bedingten Leidensgeschichte betrachten. Knipps Literaturrecherchen ergaben jedoch, dass der Flamenco im Wesentlichen jenem romantischen Geist zu verdanken ist, der im 19. Jahrhundert vor allem in Frankreich jenes exotische Spanienbild schuf, dessen Nachwirkungen – man denke etwa an Prosper Merimées Novelle Carmen – bis heute spürbar sind.
Noch immer verbinden sich mit dem Flamenco ausgesprochen romantische Vorstellungen. Gegen sie wendet sich Knipp, wenn er zeigt, wie sehr der Flamenco mit dem im 19. Jahrhundert sich ausbreitenden Kapitalismus verbunden war. Die Minenlieder sind nur ein Beleg dafür. Der Flamenco, so könnte man sagen, war eine frühe Form der globalen Unterhaltungsindustrie. Das klingt zwar nicht sonderlich romantisch, entspricht dafür aber den historischen Fakten.
| EVA KARNOFSKY
Titelangaben
Kersten Knipp: Flamenco
Berlin: Suhrkamp Verlag 2006
244 Seiten, 8,50 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander