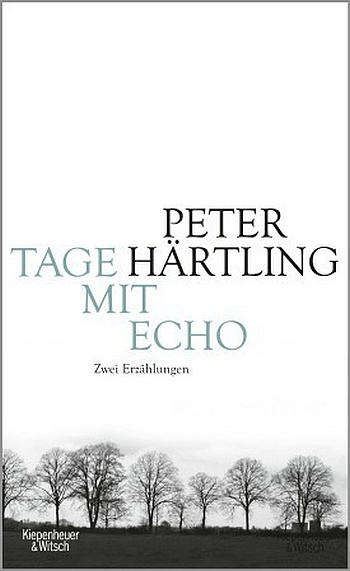Menschen | Jean Genet ist vor 100 Jahre geboren
Von der Mutter, einer Prostituierten ausgesetzt, der Fürsorge überstellt, Fremdenlegionär, er desertiert, schlägt sich als Dieb, Strichjunge durchs Leben. Die Folge: Besserungsanstalten, Gefängnis. Die drohende lebenslängliche Verbannung wird nach Fürsprache von Cocteau und Sartre aufgehoben. Die Rettung: Schreiben. – Am 19. Dezember vor 100 Jahren ist Jean Genet geboren. Von HUBERT HOLZMANN
 Für Jean Genet werden die Jahre von 1929 bis 1944 zur entscheidenden Phase seines Lebens. Er zieht als Bettler, Strichjunge, Dieb, Rauschgiftschmuggler durch verschiedene Länder. Nach Barcelona, Tanger, Neapel, Rom, Marseille, Brest, Antwerpen, Jugoslawien und Deutschland. In dieser Zeit verbüßte er wiederholte Gefängnisstrafen. Während einer dieser Knastaufenthalte wird eine Weihnachtspostkarte, die er an eine Freundin in der Tschechoslowakei schreibt, wie er Hubert Fichte in einem ZEIT-Interview vom 13.2.1976 gesteht, zum »auslösenden Kick«:
Für Jean Genet werden die Jahre von 1929 bis 1944 zur entscheidenden Phase seines Lebens. Er zieht als Bettler, Strichjunge, Dieb, Rauschgiftschmuggler durch verschiedene Länder. Nach Barcelona, Tanger, Neapel, Rom, Marseille, Brest, Antwerpen, Jugoslawien und Deutschland. In dieser Zeit verbüßte er wiederholte Gefängnisstrafen. Während einer dieser Knastaufenthalte wird eine Weihnachtspostkarte, die er an eine Freundin in der Tschechoslowakei schreibt, wie er Hubert Fichte in einem ZEIT-Interview vom 13.2.1976 gesteht, zum »auslösenden Kick«:
»Ich hatte die Karte im Gefängnis gekauft, und die Rückseite, die zum Schreiben bestimmt war, war rau. Das Rauhe dieser Karte hat mich sehr berührt. Und anstatt von Weihnachten zu sprechen, sprach ich von der Rauhheit der Postkarte und vom Schnee und was das evozierte, und von diesem Augenblick an schrieb ich.«
»Eine Stunde vor meinem Tod« – Testament und Neubeginn?
Genet schlägt sich durch die Welt, gestempelt zum Kriminellen. Er spielt seine Rolle perfekt, betrügt, stielt, verrät. Dem Verbrechen folgt Verurteilung, Strafe, Verdammnis. Rettung, Heilung gibt es nicht. Es sei denn durch Lust. Durch Lust am Verrat und Lust am Verbrechen. »Auf meinen Hals, der nicht geschützt und ohne Haß ist, meinen Hals,/ den meine Hand, leichter und schwerer als ein Fallbeil,/ … streift…« Die Realität des Verbrechers, des Gefangenen und Homosexuellen, »des zum Tode Verurteilten« wird in lyrischer Sprache ästhetisiert:
Oh komm mein Rosenhimmel, oh mein blondes Körbchen!
Besuche in seiner Nacht deinen zum Tode Verurteilten.
Reiße mir das Fleisch aus, töte, brich ein, beiße,
aber komm! Lege deine Wange an meinen runden Kopf.
Genet wird mit seinem ersten Gedicht Le condamné à mort, veröffentlicht im Jahr 1942, zu einem der großen Außenseiter der Literatur. Gleich zu Beginn seines Schaffens stellt sich Genet damit auf eine Stufe mit François Villon, dem überragenden Poeten (1431 – nach 1463) an der Schwelle zur Neuzeit. Dieser trieb ebenfalls am Abgrund der Kriminalität sein lyrisches Spiel als Possenreißer, Gauner und Lüstling, wurde wegen Totschlags zum Galgen verurteilt, begnadigt, musste jedoch in die Verbannung. Villons Werk besteht aus einem satirischen »Großen Testament, heraus sticht ein Vierzeiler: Der Franz-os ich, ein Missgeschick,/ bin aus Paris bei Oisebrück,/ bald merkt mein Hals am langen Strick:/ mein Hintern bricht mir das Genick.«
Jean Genet – die Ikone der Schwulen
Jean Genet ist ein Außenseiter der Literatur durch sein existentielles Anderssein, nicht zuletzt durch seine Homosexualität. Wie bei Rimbaud, Pasolini oder Proust sind es die mehr oder weniger offenen Gesten der Schwulen. Es sind die obskuren, geheimen Treffpunkte der Szene, die Hinterhöfe, dunklen Straßenzüge, die Bedürfnisanstalten auf den Champs-Elysées, die Gebüsche im Bois de Boulogne – Zwischenwelten der Prostitution, in denen homosexuelles Leben möglich ist.
Wenn Genet beispielsweise in der Querelle und im Journal du Voleur Handreichungen und Onaniervorlagen für die Homoszene (»Un chant d’amour«) schreibt, so mag das verurteilenswert erscheinen. Aber nicht weniger fraglich ist doch auch Joyce Nausikaa-Szene am Felsen, in der er das kleinbürgerliche, katholisch-irische Milieu entlarvt, wenn Gerty den einsamen Herrn beobachtet, ihren Schnallenschuh schwingt und Leopold Bloom sich in den siebten Himmel steigert: »Und dann flog eine Rakete hoch, und ein heller Knall und O!«
Joyce bleibt lange unverstanden. Genets Schriften werden verboten. Typische Anklage: der Ekel, die Verdammung, das Niederträchtige, Unaussprechliche, wie es Köppen im Tod in Rom in der Szene am Tiberufer imaginiert: »Ich drückte meinen Mund auf seinen gemeinen käuflichen Mund … und ich hasste mich.« Der Mord an Pasolini am Strand von Ostia durch einen seiner Strichjungen scheint beinahe vorgezeichnet – übrigens wurde schon Johann Joachim Winckelmann 1768 in Triest aus Rache wegen seiner Liebe zu jungen Männern erdolcht. – Alles kein Zufall!
Kein Zufall auch, dass Genet sich in den jungen Zirkusakrobaten Abdallah verliebt. So ist Genets »Seiltänzer«-Text autobiografisch motiviert, ganz unverblümt spielt der Text auch mit Nietzsches »Seiltänzer«-Parabel aus dem Zarathustra. Genet spannt hierin den Bogen zum Nihilismus, er spiegelt seine eigene Existenz: »Um diese völlige Einsamkeit zu erlangen, die er zur Verwirklichung seines Werkes braucht, – seines Werkes, das er einem Nichts, einer Leere entrissen hat,… – soll sich der Dichter in eine für ihn äußerst gefährliche Lage begeben. … Man meidet ihn. Er ist allein. Seine äußere Verdammung erlaubt ihm jetzt, da ihn kein beobachtender Blick mehr stört, lauter kühne Tätigkeiten. So bewegt er sich in der Einöde, einem Element, das dem Tod verwandt ist.«
Der Akrobat Abdallah verletzt sich 1960 nach einem schweren Sturz vom Seil schwer. Genet vernachlässigt den Geliebten, der sich bald darauf das Leben nimmt.
Das Werk im Merlin-Verlag
Sein erster Roman Notre-Dame-des-Fleurs erschien 1944. Er schrieb zahlreiche Bühnenstücke Die Zofen (1948), Unter Aufsicht (1949), Die Neger (1958) und das Tagebuch eines Diebes (1949). Die Helden sind Homosexuelle, Schwerverbrecher, Fremde der Gesellschaft. Der Tonfall seiner Texte provozierend, obszön, direkt und doch lyrisch. Bekannt wird Genet mit seinem 1947 veröffentlichte, zeitweise verbotene Roman Querelle. Rainer Werner Fassbinder zeigt 1982 auf dem Festival in Venedig seine Verfilmung der Geschichte des Mörders Querelle. Brad Davis, Franco Nero und Jeanne Moreau spielen die Hauptrollen.
Das Werk von Jean Genet erscheint in deutscher Sprache im Merlin Verlag Gifkendorf. In den 60er-Jahren kämpft der Verlag gegen ein Verbot von Genets Notre-Dames-des-Fleurs. Im Prozess vor dem Hamburger Landgericht sollte geklärt werden, ob der Roman als unzüchtig zu gelten hatte. Das Verbot wurde nicht bestätigt.
Adieu Genet – Adieu Rimbaud
Ab den 60ern verstummt Genet. Der Tod seines Geliebten 1964 trifft ihn schwer. Genet vernichtet seine Manuskripte. Sein Literaturagent Frechtman nimmt sich 1967 das Leben. Anlass für einen Selbstmordversuch von Genet. Er wird gerettet und unternimmt lange Reisen. 1968 veröffentlicht er politische Artikel und Statements: Er unterstützt Daniel Cohn-Bendit, reist illegal in die USA, protestiert gegen den Vietnam-Krieg und setzt sich für die Black-Panthers ein, trifft sich mit PLO-Führer Arafat, um die Palästinenser zu unterstützen, und sympatisiert in »Violence et brutalité« mit der RAF.
Die Lebenskrise Mitte der 60er ist existenziell. Warum aber das plötzliche Aus der Literaten Genet? Die Absage an das Schreiben? Ist es die Angst vor Wiederholung, die Angst vor Versagen? Auch hier gibt es ein Vorbild hundert Jahre zuvor: Arthur Rimbaud. »Adieu – J’ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J’ai essayé … d’inventer de nouvelles langues. … Eh bien ! Moi ! moi qui me suis … dispensé de toute morale, je suis rendu au sol…«
Jean Genet stirbt am 15. April 1986 an den Folgen von Kehlkopfkrebs in Paris. Er ist in Marokko beigesetzt.
Eine Hommage zum 100. Geburtstag von Jean Genet zeigt das Schwule Museum Berlin. Die Ausstellung ist bis zum 7. März 2011 geöffnet.
Titelangaben
Jean Genet: Tagebuch des Diebes
Journal du Voleur
Gifkendorf: Merlin Verlag 2001
325 Seiten. 23 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander