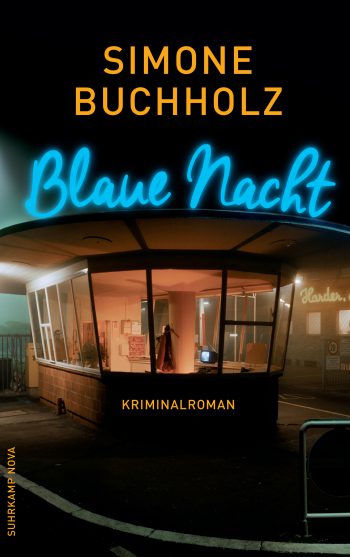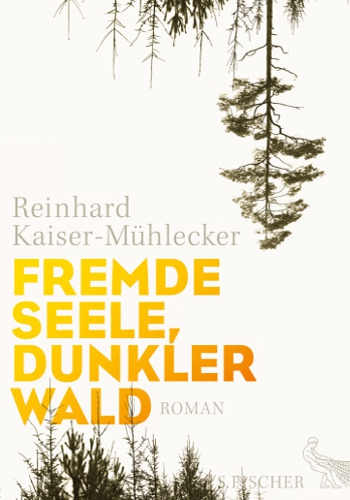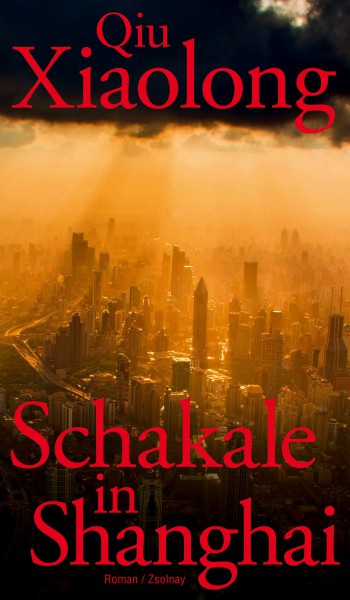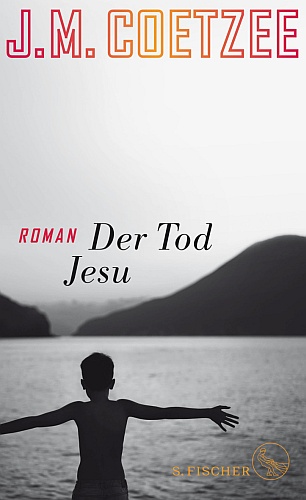Roman | Michail Schischkin: Venushaar
Um es gleich vorweg zu sagen: Man muss der DVA sehr dankbar sein, dass sie uns nun mit seinem schon 2005 erschienenen Roman ›Venushaar‹ einen Autor vorstellt, der allein aufgrund dieser 536 Seiten ohne Zweifel zu den literarischen Größen unserer Gegenwart zählt. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Dabei lebt der 1961 in Moskau geborene Michael Schischkin seit 1995 in Zürich, wo er u.a. als Dolmetscher der Einwanderungsbehörde arbeitete. In seine neue Heimat – denn mittlerweile ist Schischkin Schweizer – kam der russische Linguistiker nicht aus politischen, sondern erotischen Gründen. Er hatte sich in Moskau in eine Schweizer Slawistin verliebt.
Dabei lebt der 1961 in Moskau geborene Michael Schischkin seit 1995 in Zürich, wo er u.a. als Dolmetscher der Einwanderungsbehörde arbeitete. In seine neue Heimat – denn mittlerweile ist Schischkin Schweizer – kam der russische Linguistiker nicht aus politischen, sondern erotischen Gründen. Er hatte sich in Moskau in eine Schweizer Slawistin verliebt.
Aber als Autor, der schon u.a. ein heute vergriffenes Buch über ›Die russische Schweiz im Zürcher Limmat-Verlag publiziert hat, schreibt er weiterhin russisch, und in Russland hat er mit seinen bislang vier Romanen auch schon fast alle Preise gewonnen. Mit ›Venushaar‹, behauptet sein deutscher Verlag, sei ihm nun der Durchbruch zur internationalen Aufmerksamkeit gelungen.
Einer wünschenswerten deutschen Resonanz könnte die sehr gelungene Übersetzung Andreas Tretners zuarbeiten. Sie hat nur einen amüsanten & kuriosen Fehler. Tretner lässt in seiner Übersetzung eines fiktiven Tagebuchs aus den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Diaristin gleich zweimal davon berichten, dass sie irgendwohin »gedüst« sei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in den Fünfzigern einmal modisch erfundene Verb »düsen« (für eine schnelle Bewegung von Menschen, die wie Flugzeuge von Düsen beschleunigt werden) heute noch jemand kennt & versteht. Denn es schien mir ganz & gar außer Gebrauch gekommen zu sein.
Vielleicht ist aber der offensichtliche Fehler des Übersetzers so befremdlich in Schischkins ›Venushaar‹ auch wieder nicht. Denn ein Gegenwarts-Roman, der mit einem unausgewiesenen Xenophon-Zitat beginnt und im nächsten Satz die morgendliche Szene in der Schweizer Ausländerbehörde skizziert, wo in Gegenwart von Polizisten, Beamten & einem Dolmetscher osteuropäische »Gesuchsteller« ihren Asylantrag begründen sollen, fängt ja bizarr genug an.
Ungewöhnlich ist auch seine Fortsetzung: nämlich eine Folge von Fragen & Antworten, in denen Mord & Totschlag, Folter & Vergewaltigung, Drohungen, Flucht & Verfolgung zur Sprache kommen; aber auch durchschaubare Betrugsmanöver, um sich Einlass & Aufenthalt im »Paradies« der Schweiz zu erschleichen, deren Existenz in einer märchenhaften Allegorie an den »Hochwerten Nabuccosaurus« beschworen wird.
Dazwischen: Kaffeepausen des Dolmetschers, der in Xenophons Anabasis liest – jenem autobiographischen Bericht einer griechischen Söldnertruppe in persischen Diensten, die sich im 4. Jahrhundert auf eigene Faust quer durch Kleinasien in die thrakische Heimat durchschlägt. Später im ›Venushaar‹, wenn der Roman im sowjetischen Tschetschenienkrieg Station macht, wird Schischkin in einigen Passagen die Zeiten aufheben, durchlässig machen für einen erzählerischen Grenzverkehr mythischer Wiederholungen im Kaukasus & am Schwarzen Meer zwischen dem 4. & dem 20. Jahrhundert. Christoph Ransmayrs ›Die letzte Welt‹ grüßt dabei von ferne.
Patchwork aus literarischen Zeugnissen
Jedoch bildet die antike Erzählung der Griechen in der Fremde keinen eigenen Erzählstrang in der literarischen Buntscheckigkeit des erstaunlichen Buches aus, das man als eine polyphone Epopöe des Exils, einen erzählerischen Flickerlteppich der Vertreibung bezeichnen könnte. Als Leser, der hier eine erste Bekanntschaft mit dem Schweizer Russen oder russischen Schweizer macht, hat man fast den Eindruck, der mit allen ästhetischen Mitteln des modernen Romans vertraute Michael Schischkin wolle einen mit seiner erzählerischen Virtuosität & spielerischen Vielfältigkeit ebenso imponieren wie verwirren.
Denn man muss schon sehr aufpassen, um beim fliegenden Wechsel, den der Romancier zwischen seinen zeit- & ortsdifferenten thematischen Steckenpferden vornimmt, nicht auf der Strecke zu bleiben & die Orientierung zu verlieren, weil er nämlich dabei sowohl die literarischen Genres als auch die Stile oft blitzartig wechselt.
Neben der immer wieder aufgenommenen, aber variierten Technik von Frage & Antwort, mit der er ein Kaleidoskop von individuellen Lebens- & Leidensgeschichten des Kriegs-Grauens in der Gegenwart evoziert, ist es vor allem zum einen das fiktive Tagebuch der Sängerin Isabella Jurjewa und zum anderen sind es die Aufzeichnungen des Dolmetschers von seiner unglücklich in der Trennung endenden Italien- & Frankreichreise mit seiner Frau und ihrem kleinen Kind, mit denen Schischkin einen multiplen Roman des 20. Jahrhunderts unter russischen Perspektiven entstehen lässt. Hinzu kommt noch als weiterer verdichteter Stoff-Komplex die Beschreibung der demütigenden Zustände in der sowjetischen Armee, die die jungen Soldaten vorab brutalisiert, bevor sie in den Horror des gnadenlosen Kriegs in Afghanistan & Tschetschenien geraten, dessen Gräuel sie traumatisiert.
Die lange Lebensspanne von rund 90 Jahren, welche die aus bürgerlichem Elternhaus stammende Sängerin von ihrer pubertären Jugend im zaristischen bis ins postsowjetische Russland durchlebt, erlaubt Schischkin, die wechselnden Erlebniswelten während eines Jahrhunderts im Spiegel der sich verändernden Tagebuchaufzeichnungen aus weiblicher Perspektive zu reflektieren. Jedoch die politischen Entwicklungen der Sowjetunion nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs – also vor allem die terroristische Zeit des Stalinismus und der »Große Vaterländische Krieg« – spielen in der Wahrnehmung der als »unpolitisch« gezeichneten & ganz ihren erotischen Emotionen als Frau & Mutter lebenden Künstlerin keine Rolle, was einen denn doch einigermaßen irritiert.
Furioser Kehraus der Motive in Rom
Der Autor, der sich offensichtlich (nicht zu Unrecht) einiges darauf zugutehält, als Mann ein Frauenleben trefflich literarisch imaginieren zu können, hat allerdings dabei seinem Affen etwas zu viel Zucker gegeben, will sagen: Die sentimentalen Aufwallungen der über ihre unerfüllten und erfüllten Liebesbeziehungen besorgten Diaristin nehmen im Mittelteil des Romans einen zu großen, vor allem redundanten Raum ein.
Man hätte jedoch immer noch keinen annährenden Eindruck von der Vielzahl der Themen und deren literarischen Instrumentierung durch Schischkin, wenn man jene Erzählstrecken verschwiege, auf denen er disparate und z.T. surreale Szenen in wenigen Zeilen um- oder anreißt & sie hintereinander so montiert, dass er damit einen kaleidoskopischen Wirbel von grausamen, märchenhaften, grotesken und absurden Momentaufnahmen erzeugt.
Nahezu unerkennbar aber bleiben für den nicht-russischen Leser die zahlreichen »Fiorituren & Pralltriller« (Arno Schmidt), die der hochgebildete Autor prunkvoll, hintersinnig und gewitzt als Zitat-Lichter seinem Text aufgesetzt hat – vornehmlich aus der russischen Literatur- & Kulturgeschichte, aber auch aus der europäischen & antiken Geisteswelt. Auf einige dieser Anspielungen hat der Übersetzter auf 17 (!) Seiten im Anhang hingewiesen.
Je mehr das Buch sich dem Ende zuneigt und in einem apokalyptischen Furioso vieler seiner Motive in Rom ausklingt, desto stärker tritt ein philosophisch-mystischer, fatalistisch-religiöser Zug an Michael Schischkins epischer Weltsicht zutage, der einmal so beschrieben wird: »Jemandem wird der Kopf abgeschlagen, und in der Menge der Zuschauer vor dem Schafott sind zwei, die verlieben sich gerade zum erstenmal. Einer schaut verzückt auf den malerischen Sonnenuntergang, ein anderer sieht ihn auch, aber durch ein Gitter.(…) Die Welt ist ein Ganzes, eine Vielzahl kommunizierender Gefäße. Je ärger das Unglück des einen, desto entschiedener müssen die anderen auf ihrem Glück bestehen. Desto stärker müssen sie lieben. Damit die Welt im Gleichgewicht bleibt, damit sie nicht kentert wie ein Boot.«
Eher ist es die Ahnung, dass Michael Schischkin hier etwas Außerordentliches literarisch gelungen ist, als die begründete Gewissheit, es sei so, die mich motiviert, jedem Liebhaber einer aufs Ganze gehenden epischen Moderne dieses dichte, auch rätselvolle ›Venushaar‹ zur Lektüre zu empfehlen. Es ist jedenfalls höchste Zeit, dass wir einen einzigartigen Autor kennenlernen, der unter uns lebt.
Titelangaben
Michail Schischkin: Venushaar
(Venerin volos) Aus dem Russischen von Andreas Tretner
München: DVA 2011
560 Seiten, 24,99 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe