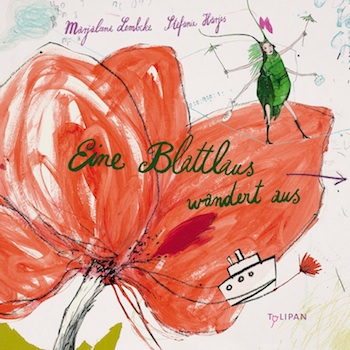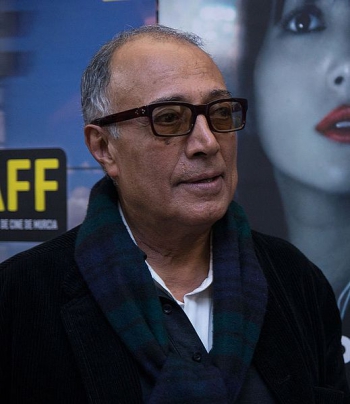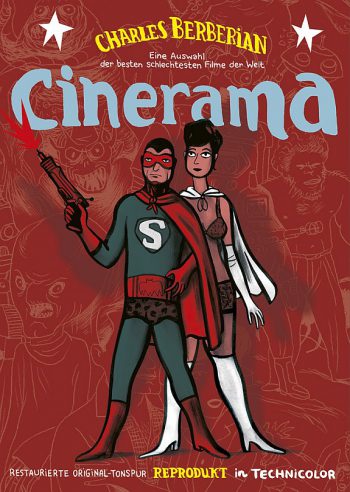Kommentar | über die Notwendigkeit einer umfassenden Film-Kritik
Einem Artikel auf der Medienseite der SZ vom 9.3. entnehme ich, dass sich deutsche Kleinverleiher – nach der viel beredeten Überproduktionskrise der Degeto – an die ARD in einem Brief gewandt und die Befürchtung geäußert hatten, dass die Sender des 1. Programms nun weniger »Arthouse«-Filme einkaufen würden – wie diese ja auch »kaum noch im Programm des ZDF« vertreten seien. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Nur weil auf diesen Brief vom 19. Januar die Verleiher fast drei Monate später immer noch keine Antwort erhalten hatten, wurde er Gegenstand dieses SZ-Artikels. Die designierte neue Verantwortliche für die Degeto will sich nun um die bürokratische Erledigung des bislang unbeantworteten Briefs kümmern und versucht die Befürchtungen der deutschen Verleiher, die im vergangenen Jahr 162 Filme herausgebracht und damit 20 Millionen Kinogänger erreicht haben, zu zerstreuen. Die ARD werde ihre »Spielfilmplätze, auch die in den Dritten Programmen, weiterführen«, zusätzlich gebe es Mitte des Jahres an acht Abenden schon um 20.15 eine Novität, nämlich »Sommerkino«.
Nur weil auf diesen Brief vom 19. Januar die Verleiher fast drei Monate später immer noch keine Antwort erhalten hatten, wurde er Gegenstand dieses SZ-Artikels. Die designierte neue Verantwortliche für die Degeto will sich nun um die bürokratische Erledigung des bislang unbeantworteten Briefs kümmern und versucht die Befürchtungen der deutschen Verleiher, die im vergangenen Jahr 162 Filme herausgebracht und damit 20 Millionen Kinogänger erreicht haben, zu zerstreuen. Die ARD werde ihre »Spielfilmplätze, auch die in den Dritten Programmen, weiterführen«, zusätzlich gebe es Mitte des Jahres an acht Abenden schon um 20.15 eine Novität, nämlich »Sommerkino«.
Das klingt beruhigend, ist es aber nicht. Zum einen, weil die deutschen Kleinverleiher weiterhin befürchten, dass die ARD solche »Arthouse«-Filme »bald nur noch nach Mitternacht zeigen«, was aufgrund des dadurch reduzierten Ankaufspreises das Angebot für Verkäufer unattraktiver macht & damit auf die Verleihersituation zurück, bzw. durchschlägt, also zu einer Reduzierung des Angebots führt. Zum anderen ist das »Sommerkino« eine Ersatzlösung für die Jahreszeit, in der, wegen der weitgehend kollektiven Urlaubszeit, keine der eigenproduzierten Unterhaltungsserien laufen könnten, ohne Ärger beim (abwesenden) Publikum zu erzeugen. Deshalb also laufen da jetzt die europäischen Kinofilme.
Manche Leser mögen sich nun fragen, was denn der Film-Ankauf des Fernsehens mit der deutschen Kino-Verleihsituation zu tun hat. Sie wissen nicht, dass schon über Jahrzehnte hin die öffentlich-rechtliche TV-Einkaufspolitik (bisweilen auch ergänzt durch Coproduktionen, wie man sie häufig für französische oder britische Filme in deren Credits für Channel 4 oder Kanal+ vermerkt sieht) dafür gesorgt hat, dass es überhaupt noch ein Kinoerlebnis jenseits des weitgehend von Hollywood dominierten Mainstreams in unseren Filmtheatern gab, bzw. gibt. Dort laufen – weil das deutsche Publikum in allen Alterskategorien untertitelte Originalfassungen nicht schätzt – die vom Fernsehen synchronisierten Filme. Z.B. die großen Epen des kürzlich verstorbenen Griechen Theo Angelopoulos.
Zumeist sind es französische, selten spanische oder italienische oder US-amerikanische Off-Hollywood- oder kanadische Filme, die wir in unseren Kinos sehen können. Aus anderen europäischen Ländern mit beachtlichen einheimischen Produktionen, z. B. in Skandinavien sieht man jedoch bei uns kaum einen Film, trotz deren Qualitäten, weder im TV noch im Kino. Nur auf regionalen Filmfestivals kann man ihnen noch kurzzeitig begegnen. Einzig die Franzosen haben es aber, qua Filmproduktion, zustande gebracht, dass ihre regionalen landschaftlichen & kulturellen Besonderheiten zwischen Provence & Bretagne im Kino (wieder) erkennbar präsent sind.
Das deutsche Fernsehen, das für die Kinoauswertung seine Synchronfassungen den Kleinverleihen zur Verfügung stellt, übernimmt damit nicht nur eine mäzenatische Rolle für unsere Kinos; es hat dadurch aber auch einen nicht zu unterschätzenden PR-Vorteil, wenn es dann die Filme sendet & Mundpropaganda für sie wirbt.
Offenbar hat sich das ZDF schon seit geraumer Zeit ganz daraus zurückgezogen – und keiner hat es bemerkt oder kritisiert, gar das ZDF zur Rechenschaft gezogen. Wenn die ARD folgen würde, gingen unsere Arthouse-Kinos demnächst an mangelnder Abspielware ein – und die einzige Alternative zum Popcorn-Mainstream-Kino wäre bald verschwunden.
Denn zum einen lohnt der minoritäre Kinoerfolg solcher Filme den Verleih- & Abspielaufwand nicht; zum anderen weiß man als älterer Kinobesucher, dass sich meist nur Altersgenossen diese Filme ansehen, selbst wenn es Festivalsieger (wie z.B. der Ardenne-Film ›Der Junge mit dem Fahrrad‹) sind. Da hat sich etwas radikal verändert in den letzten Jahrzehnten.. Früher fand man die Kritiker zuhauf in den »Arthouse«- Kinos & -Filmen, an denen sie ihre Urteile bildeten und meistens zugleich für deren Besuch sie mit ihren ausführlichen Kritiken warben.
Wie in jeder anderen Kunstform nahmen früher auch die Film-Kritiker an den avanciertesten Produktionen das Maß für ihre allgemeinen Urteile. Aber nur die Film-Kritik, die nach einer eben von dem diesjährigen Kerr-Peisträger Helmut Böttiger vorgenommene Rückstufung der deutschen Literaturkritik, nur noch »Filmjournalismus« genannt werden dürfte, hat sich vom Kritik-Anspruch radikal entfernt & zum Apportierhündchen der Mainstream-Filmbranche gemacht.
Verloren gegangen ist damit auch ein Verständnis & ein Engagement für die Independenzen des heimischen und internationalen TV- & Verleihmarktes. Wer – so könnte man Hanns Eisler berühmtes Diktum abwandeln – heute sagt: »Ich verstehe nur etwas von Filmen«, versteht in Wirklichkeit auch davon nichts.
Dabei wäre es höchste Zeit dafür, dass sich die deutsche Film- & TV-Kritik wieder auf den Kenntnistand, den artifiziellen Anspruch & die Wahrnehmung & Beeinflussung sowohl des öffentlich-rechtlichen TV- als auch des kommerziellen Verleih- & Kinobereichs mit Entschiedenheit, umfassender Kenntnis und kritisch-künstlerischem, persönlichen Enthusiasmus kümmert & einlässt. Hier fehlt als anspornende ein- & widersprechende Instanz einer virtuellen Öffentlichkeit die Kritik der Presse. Ohne solches kritisches Gegengewicht verkommt der öffentlich-rechtliche Sektor. In dem eingangs erwähnten SZ-Bericht wird erwähnt, dass Volker Herres, der ARD-Programmdirektor kürzlich die sowohl in Frankreich als auch bei uns sehr erfolgreiche Komödie ›Ziemlich beste Freunde‹ für die ARD eingekauft hat.