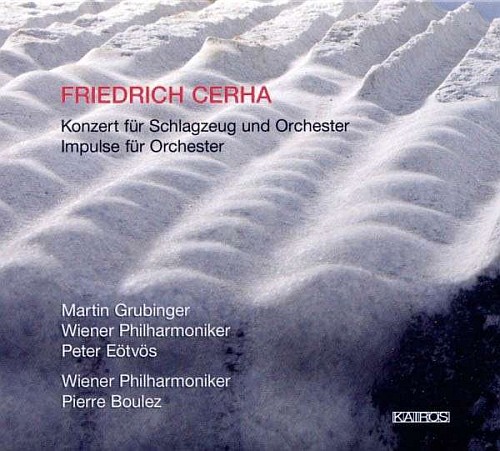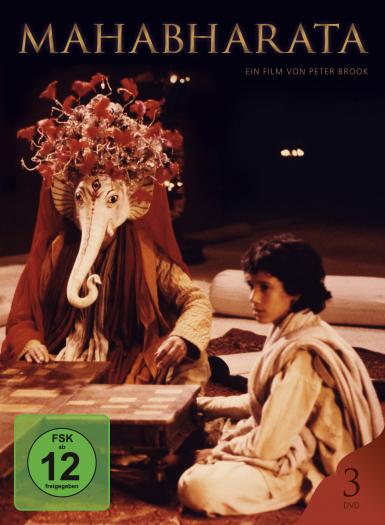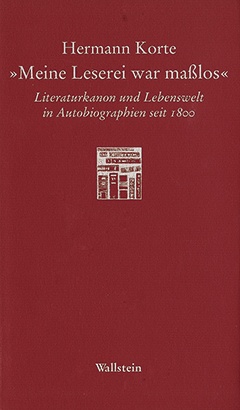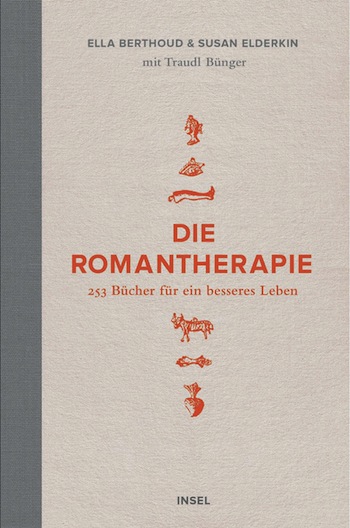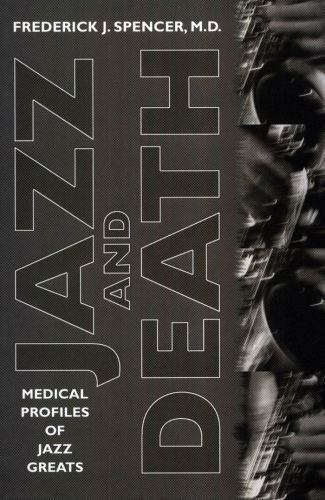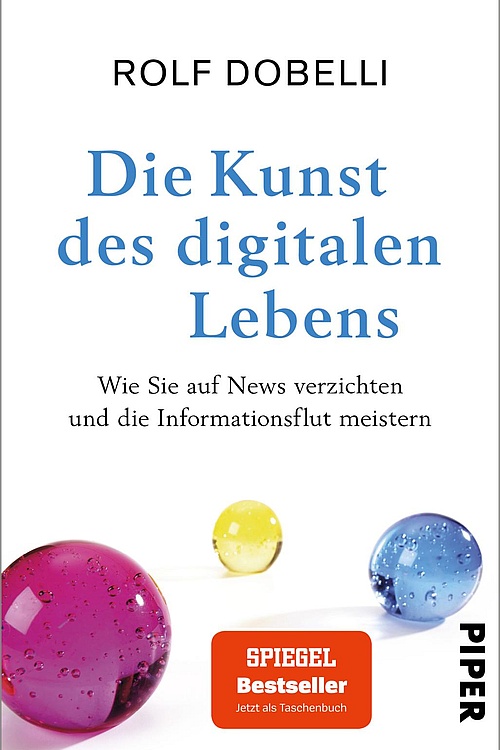Kulturbuch | H.-Joachim Heßler: Philosophie der postmodernen Musik
H.-Joachim Heßlers Traktat über die Philosophie der postmodernen Musik – von HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
 Der beste Dolmetscher der Postmoderne, auch der französischen »nouvelle philosophie«, scheint mir in Deutschland immer noch Wolfgang Welsch, vor allem in seinem umfangreichen Buch Unsere postmoderne Moderne von 1993. In klarem Diskurs spricht er dort von der Krise der »Metaerzählungen« und – Habermas herausfordernd – vom unhomogenisierbar-pluralistischen Nebeneinander der Diskursarten. Obwohl er vor allem auf Architektur abhebt, lassen sich seine ästhetischen Befunde unschwer auf die anderen »Künste« übertragen, nicht zuletzt auf die Musik.
Der beste Dolmetscher der Postmoderne, auch der französischen »nouvelle philosophie«, scheint mir in Deutschland immer noch Wolfgang Welsch, vor allem in seinem umfangreichen Buch Unsere postmoderne Moderne von 1993. In klarem Diskurs spricht er dort von der Krise der »Metaerzählungen« und – Habermas herausfordernd – vom unhomogenisierbar-pluralistischen Nebeneinander der Diskursarten. Obwohl er vor allem auf Architektur abhebt, lassen sich seine ästhetischen Befunde unschwer auf die anderen »Künste« übertragen, nicht zuletzt auf die Musik.
Der offenbar äußerst vielseitige H.-Joachim Heßler – Autor, Schulmusiker, aber auch Komponist und Interpret in eigener Sache – übernimmt natürlich Welschs Grundthese – die jemandem, der aus dem Fenster blickt auf die städtebaulichen Hervorbringungen der letzten 30 Jahre, nicht unbedingt selbstverständlich erscheint –, die postmoderne Intention sei nicht so sehr eine Praxis des anything goes, der eklektizistischen Beliebigkeit, als vielmehr Fortsetzung und Überbietung der Moderne. Sehr zu recht konstatiert Heßler, dass Theodor W. Adornos Musikphilosophie bereits viele Phänomene des 20. Jahrhunderts nicht mehr adäquat reflektiert. Heßler benennt auch einen entscheidend fragwürdigen Punkt des Adorno’schen Theoretisierens: die These von der historischen Geprägtheit des Materials – bei Adorno zweifellos ein nicht hinreichend »dialektisch« verarbeitetes Relikt Hegel’scher Teleologie, das ihn dazu (ver)führt, Beethoven im Sinne der Emanzipation der Vernunft höher einzuschätzen als J. S. Bach, wo doch schon Leopold von Ranke, einer der großen Historiker des 19. Jahrhunderts, davon gesprochen hatte, dass alle Epochen »unmittelbar zu Gott« seien (was sich übersetzen ließe: Es gibt keinen linearen kulturellen Fortschritt). Den »zwanghaften« Zügen des Materials bei Adorno setzt Heßler den flexibilisierten Materialbegriff bei Jean-Francois Lyotard und John Cage entgegen. Für den französischen Philosophen ist musikalisches Material anscheinend nichts weiter als physikalisch messbare Luftschwingung, für den amerikanischen Künstler ist Material – nichts! Definitionen, in denen die »Historizität« völlig zum Verschwinden gebracht sind: Sie können aber letztlich wohl auch nicht befriedigen.
Eine weitergedachte Musikphilosophie aus dem Umkreis der Kritischen Theorie gibt es nicht; Habermas ist unmusikalisch. Unter den Philosophen nach Adorno ist Lyotard gewiss (neben Peter Sloterdijk und Slavoj Zizek, die freilich weniger forsch »umwertend« agieren) einer der musikinteressiertesten. Das Manko besteht darin, dass seine Erkenntnisse meistens sehr allgemein bleiben und nicht mit einleuchtender Plausibilität aus der Musik herausentwickelt werden wie bei Adorno (ja sogar wie bei Claude Levi-Strauss, dessen Affinität zu Boulez Heßler wahrscheinlich unbekannt ist). Lyotard fallen beim Drauflosschreiben (das man durchaus als genuines Philosophieren würdigen kann) die einen oder anderen »passenden« musikalischen Beispiele an, die er, seine Denkfiguren bestätigend und quasi legitimierend, heranzieht – mit unterschiedlicher Überzeugungskraft. Fest steht: Als Nichtfachmann weiß Lyotard, wenn er schreibt, über Musik nur ungefähr Bescheid. Etwas boshaft könnte man auch sagen: Er will über Musik gar nichts so Genaues wissen, um sein Denken nicht zu stören.
Mancherlei Anregung zu schöpfen
Mit Anspielung auf einen berühmten Adornotitel nennt Heßler seinen Text Philosophie der postmodernen Musik. Das ist nach den Sternen gegriffen; das Resultat der sich zentral auf Lyotard stützenden Arbeit bleibt eher mager. Zwei Komponisten werden als postmoderne Repräsentanten im Sinne Lyotards näher beleuchtet: John Cage und Mauricio Kagel. Cage ist mit vielem kompatibel, so auch mit Lyotard-Maßstäben – ähnlich gutmütig ließ sich sein Oeuvre vom Adorno-Adepten Heinz-Klaus Metzger als Heldentat der Anarchie und Hierarchiezertrümmerung feiern, andererseits auch mit »esoterischem« Raunen verknüpfen. Kagel wäre »postmodern« eher in dem eingeschränkten Sinne, dass seine Musik (besonders die späte) als »bestimmte Negation« sich genau auf traditionelle musikalische Diskurse bezieht, diese paraphrasierend, unterlaufend, konterkarierend. Bei Heßler fehlt der Hinweis, dass bereits das ganze 20. Jahrhundert musikalisch als »postmodern«-vielsträhnig zu deuten wäre (Das vielstimmige Jahrhundert hieß ein entsprechendes, wenn auch philosophisch unbedarftes Buch von Kurt Honolka).
Aus Heßlers Ausführungen lässt sich sicherlich mancherlei Anregung schöpfen, doch zum »gut Geschriebenen« gehören sie keineswegs. Das macht die Lektüre nur mäßig vergnüglich. Zeichensetzung wird sozusagen nach dem Zufallsprinzip über die Textur verteilt, so dass in einigen Fällen so etwas wie eine vermutlich unfreiwillig »postmoderne« Mehrdeutigkeit, Diskurs-Unentschiedenheit, entsteht. Ich wage diesen oberlehrerhaften Fingerzeig umso lieber, als Heßler, wenn er selbst in Fremdzitaten kleine Unstimmigkeiten entdeckt, mit der Watsche des eingeklammerten »Sic!« pedantisch bei der Hand ist.
| HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
Titelangaben
H.-Joachim Heßler: Philosophie der postmodernen Musik. Jean-Francois Lyotard
Dortmund: NonEM-Verlag 2001.
168 Seiten. 24,90 Euro