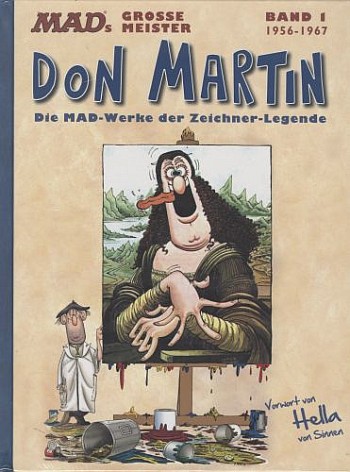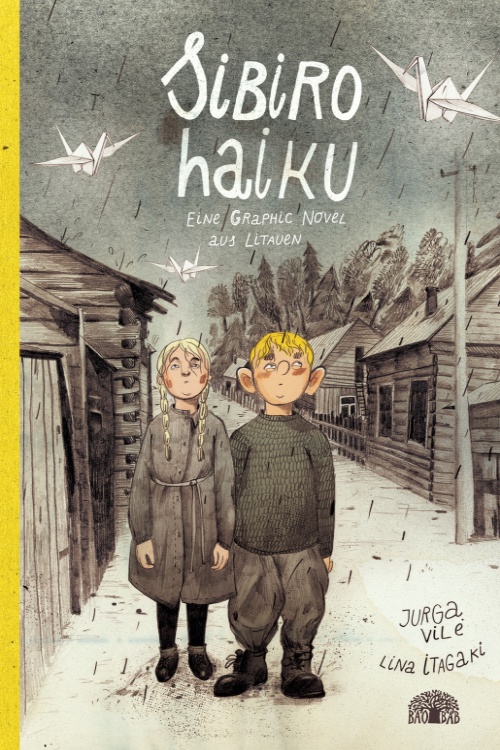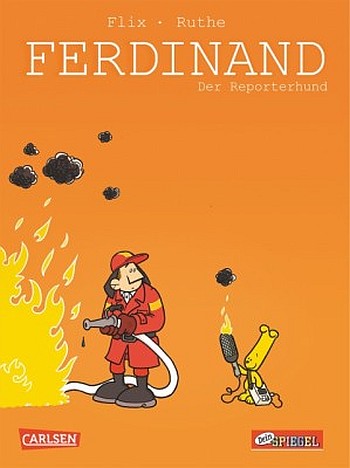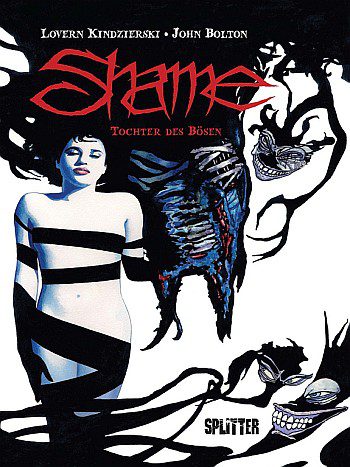Comic | John Arcudi / Peter Snejbjerg: A God Somewhere
›A God Somewhere‹ imaginiert schmerzhaft und eindrucksvoll, wie ein grenzenlos mächtiger Mensch zum Monster wird. Für TIM SLAGMAN erschlagen die drastischen Bilder aber die vielen leiseren Töne der Geschichte.
 So eindimensional, so rein und vorbildhaft, wie es für eine schöne, griffige These nützlich wäre, war die Figur des Superhelden nie – man denke nur an Weltenretter, die entweder von zu vielen (wie Spider-Man) oder von eindeutig zu wenigen (wie Iron Man) Selbstzweifeln geplagt werden.
So eindimensional, so rein und vorbildhaft, wie es für eine schöne, griffige These nützlich wäre, war die Figur des Superhelden nie – man denke nur an Weltenretter, die entweder von zu vielen (wie Spider-Man) oder von eindeutig zu wenigen (wie Iron Man) Selbstzweifeln geplagt werden.
Dennoch ist die moralische Wertung in einigen ambitionierten Werken der Popkultur endgültig gekippt: Alan Moores ›Watchmen‹ und der Antiheld aus dem aktuellen Found-Footage-Film ›Chronicle‹, sie tun Böses – oder, anders gesagt: Der Erzählkontext hat sich so weit verschoben, dass das Böse, das sie auch tun – der Euphemismus »Kollateralschaden« kommt einem da sogleich in den Sinn – sehr drastisch als solches erfahrbar wird. Und oft schwingt doch immer noch eine faszinierende Mischung aus Rechtfertigungsdrang und selbstbewusster Frechheit mit, die sich an die älteste, grundlegendste und oberflächlichste Kritik des Mediums richtet: Wir können auch anspruchsvoll, vielschichtig und komplex – und das gerade in dem Genre, das prototypisch für eure Vorurteile ist.
Eine Welt vor dem Abgrund
John Arcudi und Peter Snejbjerg haben in ›A God Somewhere‹ daher durchaus gewisse Anleihen bei der Ästhetik der Marvel- und DC-Comics gemacht: Die Geschichte eines scheinbar ganz normalen jungen Kerls, der im Zuge einer Katastrophe außergewöhnliche Kräfte an sich entdeckt, erzählen sie in klar umrissenen Panels und mit einer satten Palette an Farben. Doch von Anfang an lässt Snejbjerg riesige Schatten auf die Gesichter seiner Figuren fallen, er modelliert eine Welt, die nur einen Schritt davon entfernt scheint, in eine ewige Düsternis zu stürzen. Und von der ersten Seite an stellen sie das ekelhafte, zerstörerische, leidvolle Resultat von Gewalt und die Materialität des versehrten Körpers überdeutlich aus.
So wie Snejbjerg den Blick immer wieder weitet und verengt, vom Detail zur Totale geht und zurück, so entfaltet sich die Geschichte im stetigen Verweis vom Privaten ins Politische – eigentlich sogar vom Intimen ins Weltbewegende: Denn der Aufstieg dieses Eric Forster vom Durchschnittstyp zum nahezu Allmächtigen legt die verborgenen Sehnsüchte und Antipathien in seiner nur scheinbar so engen Clique mit seinem Kumpel Sam, seinem Bruder Hugh und dessen Frau Alma frei. Während Eric zum Medienereignis wird, nimmt die Entfremdung zu – und je weiter er seine neu entdeckten Fähigkeiten entwickelt, desto weiter entfernt Eric sich in seinen Gedanken und ethischen Maßstäben von der gesamten Menschheit, bis all diese ineinander verwobenen Konflikte grausam eskalieren.
Der Messias aus der Hölle watet in den Gliedmaßen seiner Feinde
Diesen neuen Eric und Sam schicken Arcudi und Snejberg durch eine schockierende, gigantische Suppe aus Blut und Gliedmaßen, durch mit Tod und Verletzung vollgepfropfte Panels, ein Chaos, aus dem nur Eric in einer manchmal pervers heroischen Pose herausragen darf wie ein Messias aus der Hölle. Zwei Spezies prallen da aufeinander, die nicht miteinander sprechen können, weil sie die Welt so unterschiedlich erfahren. Erics Thesen in einem letzten Gespräch mit Sam sind provokant, er spricht von Menschen, die bloß Tiere seien und so auch gefälligst zu sterben hätten. Und er weiß genau Bescheid, wie es seinem Bruder Hugh geht.
Das Gigantomanische, Größenwahnsinnige des Sujets überlagert nicht zuletzt aufgrund der wuchtig-expressiven Bildgestaltung ab und an die leisen Töne des allzu menschlichen Melodrams, um das sich Arcudi zwar redlich bemüht. Aber den nachhaltigeren Eindruck hinterlässt das Außeralltägliche, Grenzen überschreitende der Geschichte, die den Mythos nicht gründlich genug erdet. Dafür interpretiert sie ihn um zu einem packenden Schauermärchen – vom Menschen und von Rausch und Verderbnis der Macht.
| TIM SLAGMAN
Titelangaben
John Arcudi (Text) / Peter Snejbjerg (Zeichnungen): A God Somewhere
Aus dem Englischen von Bernd Kronsbein
Stuttgart: Panini Comics 2012
204 Seiten. 24,95 Euro