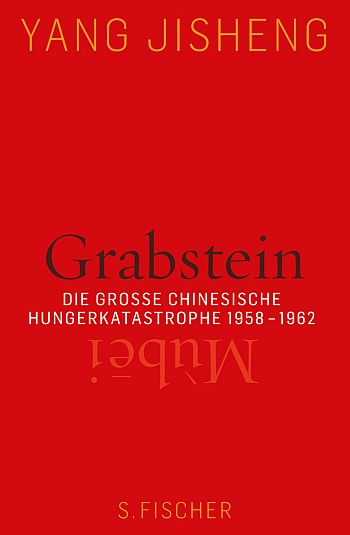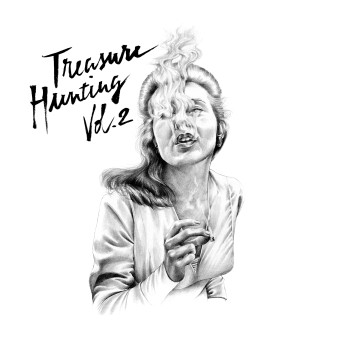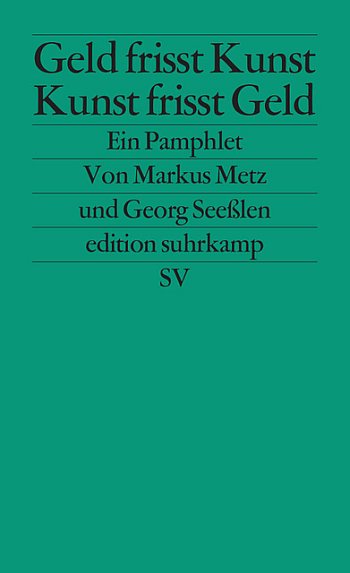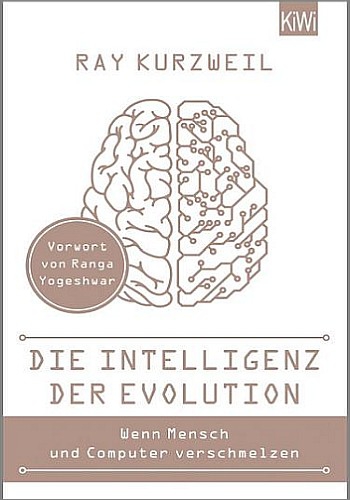Sachbuch | Imad Mustafa: Der Politische Islam
Seit etwa dreißig Jahren machen sich im Nahen Osten Parteien und Massenbewegungen bemerkbar, die sich explizit auf den Islam als Richtschnur für politisches Handeln beziehen. Vom Westen misstrauisch beäugt und in der Regel als Rückfall in die Vormoderne gewertet, haben islamistische Parteien im sogenannten Arabischen Frühling von 2011 breite Zustimmung in der Bevölkerung erfahren und sind in Tunesien und kurzzeitig auch in Ägypten zu Regierungsparteien geworden. Imad Mustafa stellt in Politischer Islam vier von ihnen vor. Von PETER BLASTENBREI
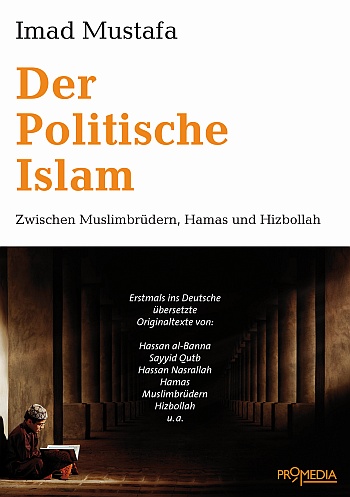
Seine Beispiele sind die libanesische Hizbollah, die Hamas in Palästina und die beiden ägyptischen Parteien al-Nur und FJP (etwas unglücklich nach der englischen Übersetzung des Parteinamens Freedom and Justice Party). Eine einleuchtende Auswahl, denn al-Nur und FJP sind aus den Muslimbrüdern hervorgegangen wie indirekt ja auch die Hamas, während die Hizbollah die erfolgreichste schiitische Variante des politischen Islam im arabischen Raum darstellt. Ebenso überzeugend ist seine Grundfragestellung: wollen diese Parteien tatsächlich, wie oft unterstellt und teilweise in älteren Parteiprogrammen vertreten, das wörtlich verstandene islamische Recht bestehenden Gesellschaften überstülpen, notfalls mit Gewalt, oder antworten diese Parteien politisch längst auf die realen Erfordernisse dieser Gesellschaften.
Kind der Moderne
Eine beliebte westliche Denkfigur kann Mustafa gleich im ersten Kapitel zerstören. Der heutige politische Islam ist kein Rückfall ins Mittelalter, er ist selbst ein Kind der islamischen Moderne. Ohne Denker wie Dschamál al-Din al-Afgáni (1839-1897) und Muhámmed Ábduh (1849-1905) ist keine der besprochenen Parteien vorstellbar. Die islamischen Reformer suchten fieberhaft nach einer Antwort auf die umfassende Dominanz des Westens ohne eben ihren eigenen kulturellen Rahmen aufzugeben. Ihre Arbeit führte zu einer Neuorientierung des Islam, oft genug gegen die islamischen Autoritäten ihrer Zeit. Ähnliches gilt von Ajatollah Chomeini und dem Libanesen Musa Sadr (1928-1978) auf schiitischer Seite, auf die sich die Hizbollah ideologisch beruft.
Der Autor, in Esslingen geborener Politologe palästinensischer Herkunft, stellt Geschichte und Ideologie dieser vier Bewegungen dar, indem er ältere und aktuelle programmatische Äußerungen im Gegenschnitt mit ihrer politischen Praxis auswertet. Dabei gibt es grundlegende Unterschiede, denn anders als die ägyptischen Gruppen sind Hizbollah und Hamas im Widerstand gegen Israel entstanden; dessen konkrete Bedingungen bestimmten von Anfang an ihre Umsetzung des Islam. Beide Widerstandsbewegungen haben dennoch einen tiefgreifenden ideologischen Wandel hinter sich, die Hizbollah seit ihrer Integration in die libanesische Innenpolitik 1992 und die Hamas seit ihrer Machtübernahme 2006.
Realitätsbezogen und pragmatisch
Diesen Wandel vollzogen die beiden islamistischen Parteien Ägyptens spätestens mit ihrer Legalisierung 2011. Heute kann man trotz bestehender, hier klar herausgearbeiteter Unterschiede und Unklarheiten davon ausgehen, dass alle Gruppen politisch für eine parlamentarische Demokratie, Gewaltenteilung, Schutz der Bürgerrechte und gesellschaftliche Partizipation beider Geschlechter eintreten. Die berüchtigten Scharia-Strafen spielen keine Rolle, Zwang in Glaubensdingen ist verpönt (wörtlich dem Koran entsprechend). Islamisch ist vor allem noch die Hoffnung auf eine langfristige Besserung der Gesellschaft durch innere Mission, d.h. besonders durch Vertiefung des Glaubens bei den Muslimen selbst.
Wenn etwas islamistische Gruppierungen für den Westen akzeptabel macht, dann am ehesten das Fehlen eines ausformulierten islamischen Wirtschaftsmodells. Ein Musterbeispiel für die Übernahme rein westlicher Modelle ist die FJP. Ihre wirtschaftlichen Vorstellungen beinhalten schrankenlose ökonomische Freiheit, Wirtschaftswachstum, unbeschränkten Wettbewerb und Kooperation mit dem IWF. Abgelehnt werden Monopole und Kartelle, jede Form der Staatsintervention, aber auch eine obligatorische Sozialversicherung, an deren Stelle eine rein karitative Sozialfürsorge über freiwillige Almosen, sadaqa, tritt (nicht die verpflichtende islamische Armensteuer zakat!).
Politik und Wirtschaft nach Allahs Willen
Demgegenüber strebt al-Nur eine aktive, auf ägyptische Verhältnisse zugeschnittene Wirtschaftspolitik an: Entwicklung arbeitskräfteintensiver kleiner und mittlerer Betriebe, qualifizierende Berufsausbildung, Ernährungssicherung durch Landwirtschaftsförderung, zinsloses Kreditsystem. Ganz anders Hizbollah und Hamas, die sich beide für das Modell eines umfassend interventionistischen Wohlfahrtsstaates entschieden haben – die Hamas angesichts des israelischen Drucks allerdings vorerst ohne Hoffnung auf Verwirklichung.
Die ägyptischen Parteien antworten mit ihren politischen und wirtschaftlichen Ideen, jede auf ihre Art, auf die Defizite der Mubarak-Diktatur. Völlig unterschiedlich ist die Situation im Süd-Libanon und in Gaza, wo die Widerstandsbewegungen seit langem die Funktionen des notorisch abwesendenen Staates ausfüllen mussten. Es ist nicht schwer zu sehen: die Berufung auf den Islam sunnitischer oder schiitischer Prägung tritt überall, ungeachtet dessen, was offiziell noch im Programm steht, vor den Erfordernissen der Tagespolitik zurück. Pragmatische alltags- und situationsbezogene Politik also im oft kaum wahrnehmbaren islamischen Rahmen statt religiösem Dogmatismus.
Der Autor kann damit systematisch belegen, wofür es einige wenige Vorstudien (z.B. Khaled Hroubs Buch über die Hamas) und ansonsten zahlreiche Indizien gab. Mustafa selbst ist kein Freund islamischer Politik und er verschweigt auch nicht, wo Positionen dieser Parteien unzulässig vage bleiben oder Anlass zu kritischen Nachfragen geben, etwa bei der Garantie der Freiheitsrechte für die islamische Gemeinschaft (umma) statt für das Individuum bei al-Nur. Er geht aber mit der spröden und komplexen Materie fair und sehr kenntnisreich um und er kann sehr schwierige Sachverhalte am Schnittpunkt von Theologie, Staatsrecht und Politik verständlich machen. Vieles, was heute im Nahen Osten vorgeht, begreift man besser, wenn man dieses Buch kennt.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben:
Imad Mustafa: Der Politische Islam. Zwischen Muslimbrüdern, Hamas und Hisbollah
Wien: Promedia 2013. 232 Seiten. 17,90 Euro
Diskussionsveranstaltungen mit Imad Mustafa:
Dienstag, 19. November 2013 ab 19 Uhr
im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 RGB, 80336 München
Donnerstag, 21. November 2013 ab 18 Uhr
Universität Salzburg, Hörsaal Anna Bahr-Mildenburg, E.004, Erzabt Klotz Straße 1, Erdgeschoß, 5020 Salzburg
Freitag, 22. November 2013 ab 19 Uhr
Afro-Asiatisches Institut, Leechgasse 22, 8010 Graz