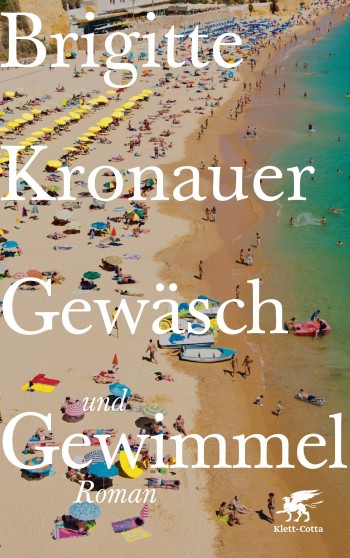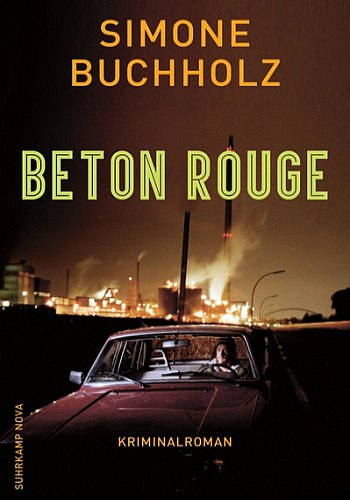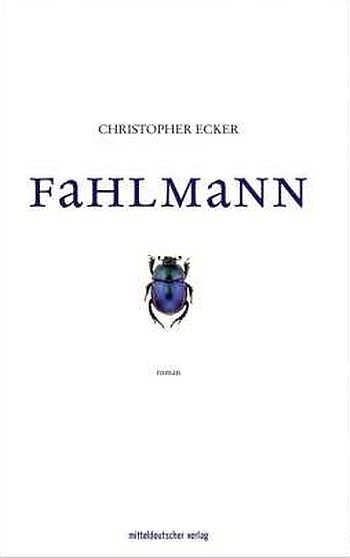Roman | Michael Köhlmeier: Die Abenteuer des Joel Spazierer
Ganz gewiss ist es nicht zu hoch gegriffen, stellt man Michael Köhlmeiers Die Abenteuer des Joel Spazierer in eine Reihe mit den ganz Großen seiner Zunft – neben Grimmelshausens Simplicissimus oder Thomas Manns Felix Krull. Auf den über 650 Romanseiten wird ein großartiges Feuerwerk aus Erzählwitz und Kompositionsfreude entfacht. – Eine Rezension von HUBERT HOLZMANN
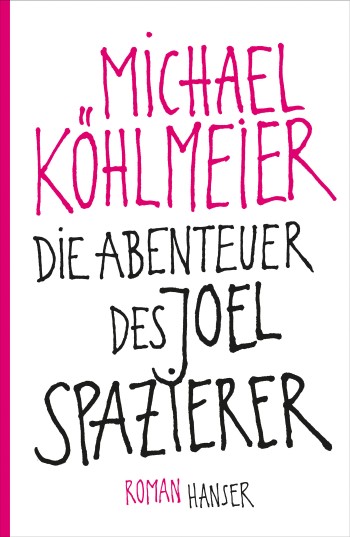
Michael Köhlmeier legt mit seinem neuen Roman Die Abenteuer des Joel Spazierer einen Schelmenroman vor, wie er im Lehrbuch steht. Wie schon viele vor ihm lässt er seinen Titelhelden selbst erzählen, natürlich aus der Rückschau, als »Lebensbeichte«. Wie in Günter Grass’ Blechtrommel (1959) Oskar Matzerath die Isolation der geschlossenen Anstalt nutzt, seine Erlebnisse aufzuschreiben, greift auch Köhlmeier in diese Trickkiste des Geschichtenerzählers und entwirft die Lebensgeschichte von András Fülöp – alias Joel Spazierer – als Roman im Roman. Sein Titelheld schreibt als alter Mann seine Erinnerungen nieder und will sie als Roman veröffentlichen.
Der Held erzählt von seinem bewegten Leben – beginnend als kleines Kind in Ungarn der 50er Jahre bis zu seinen Erlebnissen nach der Grenzöffnung der DDR. Sein Titelheld fabuliert sich um Kopf und Kragen, wenn es darum geht, seine Biografie neu zu erfinden, Brüche glätten, Lücken zu stopfen und Ungereimtheiten zu klären. Immer aufs Neue gibt es plötzliche Wendungen: Entführung, Gefängnis, Flucht, neue Identitäten. Und immer wieder wird er aus Gefahren errettet. Meist durch seine besondere Ausstrahlung, durch die er seine Mitmenschen beeindrucken kann. »Beim Abendessen erfand ich eine Geschichte… sie geriet mir, denke ich, recht eindrucksvoll. Sogar Violetta, das Dienstmädchen, blieb mit den schmutzigen Tellern in den Händen stehen, um bis ans Ende zuzuhören. Die Geschichte war komisch und rührend in einem, leider habe ich sie vergessen.«
Spielplatz »Weltgeschichte«
Vieles bleibt zweifelhaft, spekulativ oder einfach hoch gepokert. Führt er doch immer auch wichtige Persönlichkeiten an, die ihm als Rettungsanker dienen: einen erzbischöflichen Sekretär, einen Turiner Unternehmer und später Ernst Thälmann. Doch erst mal langsam der Reihe nach. Joel Spazierers Abenteuerspielplatz ist die Welt des kalten Kriegs: Er erlebt den Ungarnaufstand, den Einmarsch der Russen, lebt im Nachkriegs-Österreich, flieht später in den Sozialistischen Bruderstaat DDR und muss die allmähliche Auflösung desselben nach 1987 miterleben.
Die geschichtlichen Fakten sind die Folie, auf der sich die persönlichen Erlebnisse unseres Helden abspielen. Doch hier nimmt es Michael Köhlmeier nicht immer historisch genau. Spielt mit der Ironie der Geschichte. So flieht András Fülöp mit seiner Familie ein halbes Jahr zu früh aus Ungarn. Die Mutter wie eine Gans ausgestopft mit Geld. Aber die Flucht der Fülöps interessiert in Österreich niemanden, eher wird die Familie skeptisch beäugt. Daher spielen sie Theater, kehren zurück an die Grenze und fliehen, als nämlich Ungarnflüchtlinge nach der Niederschlagung des Aufstands durch die Russen in Österreich willkommen geheißen werden, ein zweites Mal. Es folgt ein gebührender Empfang und die Fülöps werden Nutznießer des Westens. Die Großmutter als Oberhaupt der Familie wird rehabilitiert und darf wieder an der Wiener Universität unterrichten.
Die Erfindung des Selbst
Parallel zu den geschichtlichen Wirren muss András Fülöp sehen, wie er überlebt. Bereits als Vierjähriger ist er einige Tage alleine in der Wohnung, nachdem der Rest der Familie von der ungarischen Geheimpolizei verhört wird. Er rettet sich in kindliche Traumwelten: spielt mit Blechautos, stellt die Wohnung auf den Kopf und träumt – von Siegfried aus Xanten und von den Tieren auf seiner Schlafdecke mit ägyptischen Götterdarstellungen. »Ich hörte, wie sich die aufgestickten Tiere regten, und ich hörte sie rufen«. Diese Tiere werden seine treusten Begleiter in seinem Leben, ersetzen die Freunde.
Er grenzt sich von der Welt der Erwachsenen ab, die ihn nicht beachten. Schafft sich seine Parallelwelt, seine Traumwelt. András unterhält sich, berät sich und diskutiert mit ihnen manch schrulliges Thema: »Und wachte auf, nachdem sich meine Tiere von mir verabschiedet hatten. Draußen war es bereits hell. Ich öffnete das Küchenfenster und setzte mich aufs Fensterbrett. Ein feiner Regen fiel. Ich hatte mit den Tieren besprochen, was meine Familie am Tag zuvor zwischen den Museen besprochen hatte: wie man sich in einem ÁHV-Gefängnis das Leben nehmen könnte… Das Tier mit dem Vogelkopf hatte gehustet. Das Tier mit dem Stierkopf hatte auch gehustet. Die Katze hatte sich verschluckt. Ich lauschte auf die Vögel, die in den Wiener Morgen hineinriefen, und beschloss, nicht mehr an die Tiere in meinen Träumen zu glauben.« Köhlmeier arbeitet bemerkenswert tiefenpsychologisch!
Einige Zeit später passiert wieder ein Initialereignis: Er sieht in der Stadt einen Cadillac und beschließt für sich: »– – ich wollte im Leben jemand sein. Ein Mann mit einem Namen. Dem die Leute alles glauben. Der Papiergeld in den Taschen herumträgt. Der ein gewichtiges Auto fährt…« András ist kein gewöhnlicher Junge, wird keine Schulband drücken, muss nicht irgendeinen Schulstoff lernen. Er beginnt mit zwei anderen Jungen, Emil, dem Sohn einer Prostituierten, und Franzi, durch die Stadt zu streifen.
Die Geburt des Joel Spazierer
András gibt sich als Hans-Martin aus und verdient sich ein Taschengeld als Strichjunge und erpresst anschließend seine Freier. Den Freund und Retter der Familie, Dr. Martin, ruiniert er später dadurch, dass er ihn der Pädophilie bezichtigt. Die Lüge erklärt er von nun ab zum Prinzip seines Lebens und nennt sich Joel Spazierer. Seine Unschuld hat er verloren. Und doch auch wieder nicht. Denn: »Einmal hörte ich jemanden sagen: Wir verlieren unsere Unschuld in dem Moment, in dem wir begreifen, dass uns nicht alle Welt liebt. Ich habe sofort verstanden, was er meinte, und wusste, ich habe meine Unschuld bis heute nicht verloren und würde sie nie verlieren.«
Eines Morgens begegnet András in Wien dem ehemaligen ungarischen Geheimdienstoffizier Major Hajós, der die Familie Fülöp verhört und gefoltert hatte und später in einem Strafprozess seine Schuld eingestehen musste. Mit ihm flieht der András alias Joel aus Wien. So jedenfalls empfindet es der Junge. Die Flucht gleicht aber doch mehr einer Entführung – Hajós’ späte Rache an den Fülöps. Doch András entkommt dem Folterknecht und flüchtet mit dem Zug weiter nach Oostende. Dort übernachtet er allein am Strand, dort kommen auch seine Tiere zurück und beraten ihn aufs Neue. Er schlägt sich ohne Geld durch, hält sich über Wasser durch glückliche Fügung und beschließt schließlich nach Wien zurückzukehren.
Der Zug bringt ihn als blinden Passagier bis ins Fränkische nach Hilpoltstein. Dort irrt er hungrig durch einen Wald und begegnet schließlich Staff Sergeant Hiram Winship, einem desertierten, ehemaligen GI, der als Einsiedler in einer verborgenen Einöde lebt. Wie der junge Simplicissimus bei Grimmelshausen lernt Joel von diesem Einsiedler alles Wichtige fürs Leben – und das Handwerkszeug, das er für seine neue Rolle als Hochstapler benötigt: lügen, stehlen, morden. Und nebenbei auch seine erste Fremdsprache Englisch. Mit seiner Hilfe kehrt er zurück in die Donaumetropole und damit zurück auf die Bühne der großen Welt.
Schelmenroman und Höllenfahrt
Michael Köhlmeiers Roman Die Abenteuer des Joel Spazierer ist kein Entwicklungsroman. Im Helden selbst ist bereits alles angelegt, was er später einmal benötigt: das bedingungslose Lügen, das Spiel mit der eigenen Biografie, ein ungetrübtes Selbstbewusstsein, die abgrundtiefe Verachtung der Menschen und zugleich extremer Charme und Charisma. Seine verschiedenen Lebensstationen münden immer wieder in Phasen der Abgeschiedenheit: Joel flieht ins Exil, ist auf der Flucht oder verbringt einige Jahre im Gefängnis. Zum Beispiel nach einem eher zufälligen, aber dennoch kaltblütigen Mord, den er in der Schweiz verübt. In den Jahren im Knast lernt er neue Fähigkeiten: Er lernt Autos zu reparieren, weitere Sprachen und versteht durch sein sympathisches Auftreten seine Mitmenschen zu manipulieren.
Damit rüstet er sich für seinen letzten, entscheidenden Coup: seine Flucht und »Heimkehr« in die DDR der 70er-Jahre. Joel Spazierer verwandelt sich in den Enkel von Ernst Thälmann. »Die Grenzbeamtin starrte auf meinen Pass und fragte, ob ich tatsächlich mit Vornamen Ernst-Thälmann heiße. Ich sagte: ’Gewiss, Ernst-Thälmann, wie der große Arbeiterführer. Er war mein Großvater. Ich bitte um Asyl in der Deutschen Demokratischen Republik.’ ’Wieso Asyl?’, antwortete sie – nach einer sehr langen, sehr stillen Pause. ’Wollen Sie nicht einfach so reinkommen, Herr Dr. Koch?’ Das fand ich auffallend freundlich.«
Und damit beginnt das biografische Verwirrspiel von vorne. Und die Verhöre und Prüfung durch alle Instanzen hindurch – angefangen von der Staatssicherheit bis hin zu Erich Mielke und Margot Honecker, die Dr. Ernst-Thälmann Koch – alias Joel Spazierer / alias András Fülöp – bei dessen Vorlesungen als »Professor für wissenschaftlichen Atheismus« an der Humboldt-Uni hört. Michael Köhlmeier ist mit seinen Abenteuern des Joel Spazierer ein großartiger, ein gewaltiger Wurf gelungen. Prädikat: genial und sehr unterhaltsam!
| Hubert Holzmann
Titelangaben:
Michael Köhlmeier: Die Abenteuer des Joel Spazierer
München: Hanser 2013
656 Seiten. 24,90 Euro
Michael Köhlmeier in TITEL-Kulturmagazin