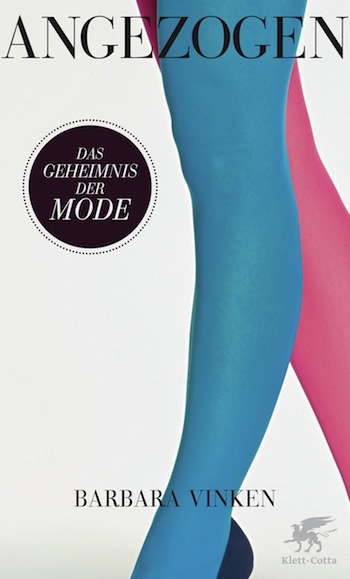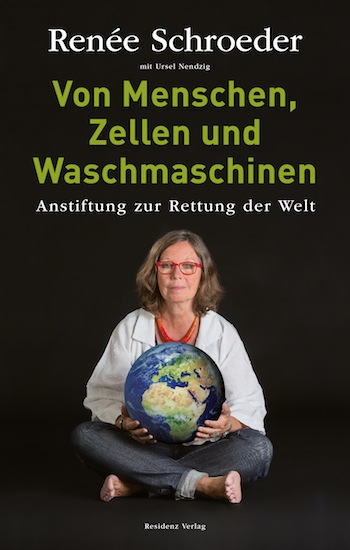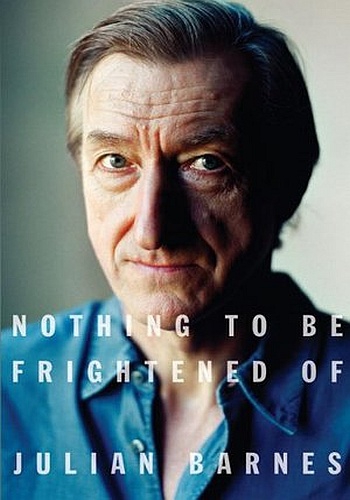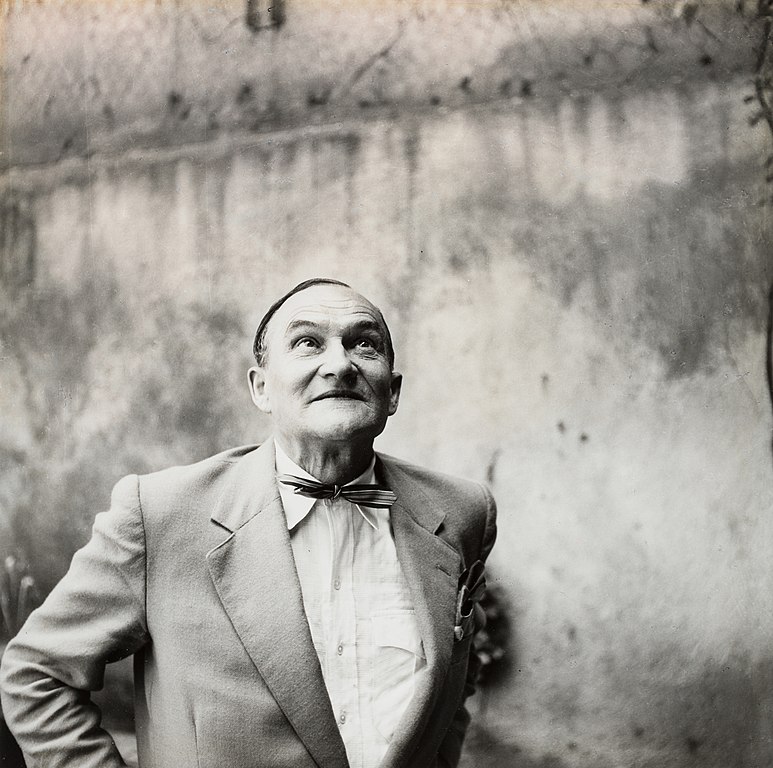Menschen | Michael Brenner (Hg.): Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart
Die schlechte Nachricht zuerst: Nein, es hätte sie nicht geben sollen – Juden und Geschichte in diesem Land nach der Shoah. Weder für die gojischen Deutschen noch für den Jüdischen Weltkongress. Jetzt die gute: Doch, es gibt sie wieder! Wie, gegen welche Widerstände und durch welche Kräfte sie trotzdem zustande kam, zeichnet die von Michael Brenner herausgegebene Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart nach. Ohne Scheu vor ungemütlichen Fakten und ohne »Oh-wie-schön!«-Schmu. Von PIEKE BIERMANN
Die Geschichte der Juden in Deutschland ist lang, und deutsche Juden oder jüdische Deutsche waren immer schon nur ein Teil. Es ist eine fruchtbare Geschichte, die auch furchtbare Episoden hatte, bevor sie 1945, nach dem antisemitischen Vernichtungswahn von Nazi-Deutschland, ein für allemal zu Ende schien.
Mit dem Jahr 1945 endete auch die vierbändige Deutschjüdische Geschichte in der Neuzeit. 1600-1945. Sie gilt als Standardwerk, 1996/97 herausgegeben vom Leo Baeck Institut. Seitdem sind etliche kleine und große Studien erschienen – über wiedergegründete Gemeinden und wiederaufgebaute Synagogen, über jüdisches Leben in den Lagern für »Displaced Persons« (DP) und später in der Bundesrepublik, über Entschädigungsblockaden und neu-alten Antisemitismus. Eine Gesamtschau dagegen fehlte bisher. Jetzt ist sie da, sozusagen als fünfter Band des Leo-Baeck-Projekts, gefördert von der VolkswagenStiftung. Ergebnis jahrelanger Archivarbeit von acht Autoren – vier Frauen, vier Männern, die jeweils zu zweit eine Periode erforscht haben – unter Federführung von Michael Brenner, dem Inhaber des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur an der Universität München. Über 500 Seiten bestens dokumentierte und lebendige, aufregende Prosa.
Koffer unterm Bann
Vorangestellt ist ein Essay von Dan Diner über den Cherem, den Bann, unter dem das neue jüdische Leben in (West-) Deutschland anfangs stand. Für Juden war das »Leben auf gepackten Koffern« nicht bloß eine hübsche Metapher. Und die Koffer standen obendrein – wie hier zum ersten Mal ausführlich geschildert – zwischen zwei Stühlen. Der Druck kam von beiden Seiten. Die nichtjüdischen Nachbarn hatten gerade vorher unmissverständlich klargemacht, dass Juden »endgelöst« gehören, und waren nicht erpicht auf die Wenigen, die das überlebt hatten und womöglich wiederhaben wollten, was ihnen geraubt worden war. Und den jüdischen Hilfsorganisationen, dem Jüdischen Weltkongress und dem Jischuw (der jüdischen Gemeinschaft in Palästina vor der israelischen Staatsgründung) galt es als glatter Verrat, auf »blutgetränktem Boden« zu bleiben, gar wieder Gemeinden aufzubauen. Für sie waren Juden, die es trotzdem taten, »parasitäre Charaktere«, korrumpiert »von den Fleischtöpfen Deutschlands«. Diner berichtet von dem Konflikt – als Einziger leider doch etwas akademisch trocken, aber – mit so ergreifenden Details, dass es einem schier den Atem verschlägt angesichts des Muts, der Hartnäckigkeit und der Widerstandskraft der Rückkehrer und Neuansiedler.
»Mir senen do!«
Die vier Teile des Buchs sind chronologisch geordnet. Atina Grossmann und Tamar Lewinsky erzählen von den DP-Lagern vor allem in der amerikanischen und britischen Zone. Eine Viertelmillion Menschen zumeist aus dem Osten kam hier zunächst provisorisch unter, Shoah-Überlebende und ins Sowjet-Exil Gezwungene. Aber nicht zuletzt dank energischer Unterstützung durch die US-Politik, die jüdisches Leben in Deutschland als demokratischen »Lackmustest« verstand, blieben viele nach dem trotzigen Motto eines jiddischen Partisanenleids: »Mir senen do!«
Im zweiten Teil schildern Michael Brenner und Norbert Frei die ersten zwanzig Jahre des neugegründeten Zentralrats, das allmähliche »Sesshaftwerden« zwischen »Wiedergutmachungs«verhandlungen und internen Querelen um eine liberale oder orthodoxe Ausrichtung der Synagogen. Constantin Goschler und Anthony Kauders zeichnen im dritten Teil die Periode zwischen zwei historischen Daten nach, 1968 und 1989, die auch intern von markanten Entwicklungen geprägt war: dem Generationenwechsel und der allmählichen Verwandlung der metaphorischen Koffer, die Salomon Korn 1986 in dem berühmten Satz zusammengefasst hat: »Wer ein Haus baut, will bleiben.« Der vierte Teil von Lena Gorelik und Yfaat Weiss schließlich widmet sich der Zeit seit dem Mauerfall, vor allem der Migration aus dem Ostblock, die jüdisches Leben in Deutschland wieder mal neu definiert hat.
Auch heute leben in Deutschland wieder jüdische Deutsche, deutsche Juden und eine multi-»nationale« Jewish community mit und ohne Gemeindebindung, zu der sogar immer mehr Israelis stoßen. Die Koffer sind ausgepackt, das Haus ist da und ziemlich solide gebaut. Jetzt kommt es darauf an, ob der Boden, auf dem es errichtet wurde, solide ist und gepflegt wird – ob ihn, mit anderen Worten, die nichtjüdische Mehrheit verlässlich von Blut freihält. Dieses Buch bietet dafür das fundamentale Wissen.
| PIEKE BIERMANN
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 1. November 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
Titelangaben
Michael Brenner (Hg.): Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart
München: C. H. Beck Verlag 2012
542 Seiten. 34 Euro