Thema | Kritik einer Übersetzungskritik
Ein kleines Lehrstück über den notorisch respektlosen Umgang mit der Arbeit des Übersetzens – auch eine Folge der schleichenden Entwertung des Begriffs »Kritik« durch das Feuilleton selbst –, und auch darüber, was intelligentes gemeinsames Handeln bewirken kann. Von PIEKE BIERMANN
Am 1. November 2012 erscheint eine Meldung bei SPIEGEL-online:
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 01.11.2012
Pieke Biermann wehrt sich gegen Bernard Imhaslys Kritik an ihrer Übersetzung […]. Biermann beklagt die ungerechte Behandlung von Übersetzungen in den Feuilletons, wo sie meist ignoriert oder anhand von willkürlich ausgewählten Beispielen bemängelt würden. Letzteres könne gravierende Folgen haben, „zumal, wenn es in einem der wenigen seriösen Leitmedien passiert und ‚übersetzerische Fehlgriffe‘ zum fetten Zwischentitel werden. Das zieht Kreise, das prägt Meinungen von anderen Rezensenten, Verlagen, Veranstaltern – und kann schnell materiellen Schaden anrichten, denn Übersetzer leben von ihrem guten Ruf.“
Wie bitte? Eine Übersetzerin rezensiert eine Rezension, in der eine Übersetzung kritisiert wird? Wie geht das denn?
Zur Buchmesse 2012 erschien Katherine Boos Behind the Beautiful Forevers auf Deutsch unter dem Titel ›Annawadi oder der Traum von einem anderen Leben‹, von mir übersetzt. Keine leichte Arbeit, aber die Art Herausforderung, die ich mag. Boo, preisgekrönte US-amerikanische Reporterin, hatte für ihre Erzählung aus einem Slum in Mumbai einen spezifischen Ton entwickelt: weder fictionartig noch »reportagig«; unpathetisch, aber atmosphärisch dicht bis in die sensorischen Details dieses Slums; nüchtern, da und dort dezent auktorial erzählt, aber Vorrang hat der »O-Ton Annawadi«. Gemeinsam mit indischen Mitarbeiterinnen und über fast vier Jahre hatte Boo die Stimmen der Menschen dort gesammelt – wütende, verzweifelte, sehnsüchtige, auch gemeine, fiese. Es ist Erzählung »von innen«. Ein literarisches Verfahren, bei dem der Autor sein »Objekt« zum eigentlichen »Subjekt« und sich selbst zum Katalysator macht, seit etwa 50 Jahren geläufig als New Journalism und immer wieder neu variiert.
Es ging also (wie immer bei Literatur) vor allem darum, diesen spezifischen Ton oder genauer: diese Ton-Mischung buchstäblich stimmig zu transferieren. Für alle anderen Schwierigkeiten hatte ich mir (wie immer) ExpertInnen gesucht. Diesmal hatte es mich dabei unter anderem bis zum Goetheinstitut Mumbai verschlagen, so war ich an Daniela Verma geraten, eine wahre Expertin for all things Indian. Und selbstverständlich habe ich (auch wie immer) mit der Autorin selbst manches beraten. Mich mit Leuten auszutauschen, die mehr wissen als ich, gehört für mich zum Aufregendsten, und Übersetzen ist bei aller (un)splendid isolation eine äußerst kommunikative Tätigkeit.
Alles schick also. Sogar die Redaktionsphase: Caroline Draeger erwies sich als genauso pingelig wie ich, hatte Spaß am Hin- und Herüberlegen und viel Geduld bei der doppelten Bildschirmarbeit. Wir arbeiteten nämlich bis zuletzt ohne Buch. Wir hatten nur PDF-Dateien. Das ist nicht unüblich. US-Verlage und -Agenturen diktieren gern auch ausländische Publikationsdaten, um Bücher gleichzeitig weltweit zu vermarkten; die weltgewandteren schicken immerhin regelmäßig Fassungen »letzter Hand«, dann »allerletzter«, und »jetzt aber wirklich die endgültige«.
Das Buch ging in Druck. Alle hatten das Gefühl, gut gearbeitet zu haben, und waren gespannt auf die öffentliche Reaktion. Würde sich das deutschsprachige Publikum überhaupt für eine Geschichte aus »Indien« interessieren, die ihm zweierlei verbaut: Trost durch Friede-Yoga-Eierkuchen-Sanftmut und Distanz durch gönnerhaftes Mitleid mit hoffnungslos Armen? Würde sie hier so einschlagen wie in der angelsächsischen Welt? Nichts gegen einen Bestseller!
RWÜSTLICH SCHÖN UNVERWÜSTLICH SCHÖN UNVERWÜSTLICH SCHÖN UNVERWÜSTLICH SCH
Die erste Rezension erscheint am 16. Oktober, groß aufgemacht, Adresse vom Feinsten: NZZ. Titel: »Hinter den Fassaden des ›ewig Schönen‹«. Darunter ein Foto von Slumhütten, Unterzeile: »Ein Leben ohne Perspektive und Solidarität – Impressionen aus einem Slumviertel in Mumbai«. Darunter der Name Bernard Imhasly. Ich lese los, über leichte Irritationen hinweg. Dass der Rezensent neutrale Bodenfliesen zu »Badezimmer-Kacheln« aufpeppt – geschenkt, auch wenn die Frauen des Slums, die durch die Reklamewand mit dem Endlosslogan beautiful forever beautiful forever … verlockt werden, bestenfalls von einer Kochnische träumen können. Dass er umgekehrt Abdul, der Müll »taxierte und ankaufte« und damit »in der Rangordnung des Müllgeschäfts eine Stufe höher als die Müllsucher« stand, zum »Lumpensammler« degradiert – peanuts, mangelndes Gespür für die existenzielle Bedeutung von Hierarchien gerade unter den Ärmsten ist ja nicht untypisch für einen vermutlich wohlsituierten Europäer. Dass er »Jugendheime« sieht, wo grauenhafte Jugendknäste und U-Haftanstalten sind – too bad, aber sicher der heißen Nadel geschuldet, mit der Rezensionen oft gestrickt werden (müssen). Dass er Katherine Boo vorwirft, sie verletze »das journalistische Grundgesetz, dass jedes Zitat an einer realen Person zu einem bestimmten Zeitpunkt festgemacht wird«, katapultiere den »Leser in ein quasi fiktionales Universum« und lasse Annawadi fälschlich »vielleicht für ganz Indien stehen« – sein Recht, es gibt ja kein Grundgesetz, dass Journalisten mit den Entwicklungen des Reportage-Genres in den letzten zwei Generationen oder gar der komplexen Verschränkung von literarischen und journalistischen Verfahren vertraut sein müssen.
Und dann kommt ein Zwischentitel, in größeren gefetteten Lettern:
Übersetzerische Fehlgriffe
Mir bleibt das Herz stehen. Ich lese weiter:
Allerdings geht bei der Übersetzung von Pieke Biermann einiges vom Original verloren. Es irritieren die vielen Übersetzungsfehler: Aus den «sheets» von Wellblech werden «Laken», «kameez», das lange Hemd muslimischer Frauen, wird mit «Zweiteiler» übersetzt, «Central Mumbai» mutiert zur «Altstadt», die «liquid city» zur «liquiden Stadt».
Noch ärgerlicher ist der Versuch, den Müllsammlern einen auf Norddeutsch frisierten Slang zu verpassen. Boo spricht von der Einsilbigkeit der «Alltagssprache der Menschen, die den grössten Teil des Tages mit Müll verbringen, schweigend, von der Arbeit ausgelaugt». Zur Lakonik der Charakterskizzen fügt sich die «transaktionale» Kürze der gesprochenen Rede. Dies geht im Deutschen manchmal verloren. Biermann macht aus «I’ll put you in a trap» ein «Ich tret dich voll in die Scheisse», der «Furniturewallah» wird zum «Möbelfritzen», Slumbewohner lassen «ne Party steigen».
Viele Fehler! Hab ich etwa geschludert? Wie peinlich! Meine Gedanken rasen los, überschlagen sich. In meinem Kopf ist ein ganzer Chor aus Stimmen, die sich gegenseitig niederbrüllen wollen. Bleib jetzt ganz ruhig! Ärgerlicher norddeutscher Slang? Lass dich nicht beeindrucken vom besserwisserischen Tonfall! Ist das die Rache für Steinbrücks Kavallerie? Leg dich erstmal auf den Boden, aaatme! ’ne Party steigen lassen? Guck dir das genau an. Einzeln! Die sheets! Die kameez! Überprüf alles – hah, du hast ja PDF-Dateien!
Ich verbringe die nächsten Stunden mit Suchprogramm und Textvergleich. Eine kameez kommt im Original nur einmal vor, als stylish red salwar kameez, bei mir als »schicke rote Salwar Kamiz«. Meinen »Zweiteiler« gibt’s auch nur einmal: … a brown two-piece outfit with pink flowers … Was hat der Mann gelesen? Steht da im Buch womöglich doch etwas anderes als in der ultimativen PDF? Hilfe! Lieber alles doppelt prüfen! Inzwischen habe ich auch das Originalbuch. Immerhin stimmt die Paginierung überein!
Also, die sheets. Die kommen häufig vor – als bed sheets, charge sheets, also eindeutig aus Stoff oder Papier. Die eine inkriminierte Stelle, an der ich unrechtmäßig Metall in Stoff verwandelt haben soll, steht gleich im Prolog:
Abdul had known the One Leg [Fatima] since the day, eight years back, that his family had arrived in Annawadi. He’d had no choice but to know her, since only a sheet had divided her shack from his own. Even then, her smell had troubled him. Despite her poverty, she perfumed herself somehow. Abdul’s mother, who smelled of breast milk and fried onions, disapproved.
In the sheet days, as now, Abdul believed his mother, Zehrunisa, to be right about most things. […] Abdul had learned. One year, there was enough to eat. Another year, there was more of a home to live in. The sheet was replaced by a divider made of scraps of aluminum and, later, a wall of reject bricks, which established his home as the sturdiest dwelling in the row.
Der Kontext zeigt: Der kleine Aufstieg der Familie des Müllhändlers Abdul manifestiert sich an den immer stabileren Materialien um ihre privacy herum, bei mir vom »Laken« zur »Trennwand aus Wellblechresten« bis zur »Mauer aus ausgemusterten Ziegelsteinen«.
Weiter, central Mumbai. Es kommt nur selten vor und wenn, dann aus der Perspektive »von unten«, als Kontrast zum Slum. Mumbai hat keine Stadtmitte, gar Altstadt im europäischen Sinn, gemeint sind seine historischen, vom kolonial(istisch)en Stil geprägten Teile. Ich hätte die Bezeichnung einfach übernehmen können. Ich finde allerdings, man darf (und sollte) Begriffe eindeutschen, wo das Original ein unnötiger Stolperstein wäre – was Central Mumbai wohl nicht wäre – oder wo eine deutsche Formulierung einen »Mehrwert« bietet. Bei Altstadt, schien mir, können Menschen mit deutschem Sprachhintergrund das Historische mitassoziieren, Central Mumbai klingt »modern«.
Auch die »liquide Stadt« habe ich bewusst gesetzt, liquid city kommt ein einziges Mal vor:
Now it poured, a stinging rain. On the high grounds of the liquid city, rich people spoke of the romance of monsoon: the langurous sex, retail therapy, and hot jalebis that eased July into August. At Annawadi, the sewage lake crept forward like a living thing.
Die liquid city ist auch im Original eine Art Stolperstein. Ich nehme an, dass Katherine Boo, die sich im Nachwort selbst als Wandersoziologin ironisiert, bewusst mit dem Begriff spielt, weil sich darin verschiedene Bedeutungsschichten überlagern: Das Flüssige (vom Monsun bis zum Sex, gern als »Austausch von Körperflüssigkeiten« bespöttelt), die Liquidität reicher Leute, die Geld gegen allerlei Wehwehchen fließen lassen können, auch eine Spur neue Soziologie, die »Liquid City« als Begriff für Mega-Citys entwickelt hat (übrigens am Beispiel Mumbai), vielleicht auch ein mentaler Klick zu popkulturellen Projekten, Produkten, Aktivitäten, die als »Liquid City« durchs Netz schwirren. Hier habe ich den Originalbegriff übernommen, hier fand ich, um möglichst viele der originalen Assoziationen freizusetzen, sollte ich mutwillig einen Stolperstein auslegen.
I’ll put you in a trap ist nicht halb so komplex. Fatima droht das an. Fatima ist eine zutiefst tragische Gestalt, arm, einbeinig, misshandelt, verachtet, sehnsüchtig nach Liebe und über all dem bösartig geworden. Sie hat eine ihrer drei Töchter umgebracht, sie betrügt ihren Mann mit jedem, der ihr einen Moment lang das Gefühl gibt, schön und attraktiv zu sein. Wenn sie mit ihrer Krücke zur Latrine stolziert, lacht der halbe Slum hinter ihr her. Der Neid auf die intakte, leicht prosperierende Familie Husain hat sie so zerfressen, dass sie, als wegen Abduls kleiner Umbauten ein paar Brocken aus der schon erwähnten Ziegeltrennmauer in ihre Hüttenhälfte fliegen, loskeift: »If you don’t stop breaking my house, motherfucker, I’ll put you in a trap.«
Trap heißt Falle, to put someone in a trap heißt, jemanden reinreiten. In vulgären Idiomatiken heißt trap auch Fresse und Klo. Reiten hat im Deutschen eine zotige Konnotation, die gut zu Fatima passt, und weil die Gemeinschaftslatrine für sie eine große Rolle spielt, schien es mir sinnvoll, das »Reinreiten« fäkal zu verschärfen. Denn dass das ein aggressiv-vulgärer Auftritt ist, wird am Wort motherfucker klar – Katherine Boo ist äußerst dezent mit Kraftausdrücken.
»Wenn du nicht sofort aufhörst, mein Haus zu zerkloppen, du Mutterficker, dann reit ich dich voll in die Scheiße.«
Eine Lösung, selbstverständlich kritisierbar. Man darf sie – selbst wenn das etwas unterkomplex wirkt – auch wegpatschen wie eine lästige Fliege, man sollte nur genau sein: In irgendetwas »getreten« wird bei mir niemand und »voll reingeritten« auch nur dieses eine Mal.
Wo »Slumbewohner ’ne Party steigen lassen«, habe ich vergeblich gesucht. Gefunden habe ich: »The previous day had been the sixtieth anniversary of the assassination of Mahatma Gandhi, a national holiday on which elite Indians once considered it poor taste to throw a lavish party.«
Und auf Deutsch:
»Am Vortag vor sechzig Jahren war Mahatma Gandhi ermordet worden, und einst hatte es bei der indischen Elite als geschmacklos gegolten, den Nationalfeiertag mit extravaganten Events zu begehen.«
Schließlich der furniturewallah – Menschen mit arabischem, asiatischem oder Neuköllner Sprachhintergrund muss man die allseitige Verwendbarkeit von wallah nicht erklären. Im Englischen ist damit zumeist eine Person gemeint – ein Typ, ein Heini, ein Trottel, je nach Gefühlslage. Dieser hier kommt ein einziges Mal vor, in einem muslimischen Mittelschichtviertel, durch das der staunende arme Muslim Abdul in den Knast gefahren wird:
»Zur einen Seite einer dunkelgrünen Moschee lagen Läden, und das Geschäft brummte trotz des Regens. Ein Halal-Fleischer. Ein muslimischer Möbelfritze. Drogerie Nazir. Die Habib-Klinik. Küchenläden, in denen Schöpfkellen an Haken baumelten.«
Kann ein ganzes Buch durch einen einfachen umgangsdeutschen »-fritze« für einen Schweizer nach »auf Norddeutsch frisiertem Slang« klingen? Woher nimmt einer, der selbst so flüchtig liest und schreibt, diesen Fliegenklatschen-Ton – oberlehrerhaft, von oben herab, frisierte Berliner sagen dazu: »kraft seiner Wassersuppe«? Als hätte er persönlich das Rad erfunden – das journalistische und das übersetzerische gleich mit.
Wer ist der Mann? Aha – der Südasienkorrespondent der NZZ, vorher Diplomat, verheiratet mit einer indischen Psychotherapeutin, Autor eines Buches über Indien, das in der INDIA TIMES als obsolet empfunden wurde, Blogger; Literaturkritiker offenbar nicht.
Ich klappe Bücher und Computer zu. Mein Körper ist eine einzige geballte Faust, aber wenigstens brüllt im Kopf kein Chor mehr. Da wuselt gerade nur ein Duett aus wohliger Erleichterung – »Puh, rehabilitiert!« – und rachlustigem Kichern – »Ricolaaaa!« Und Bilder. Im Vordergrund hüpft ein zeterndes Männchen. Im Hintergrund tanzt ein fetter Zwischentitel: »übersetzerische Fehlgriffe«. Irgendwann braut sich aus allem eine Art Zauberformel zusammen: rezensentische Fehlgriffe. Das ist es, was hier passiert ist. Mir. Einen Moment lang ziehen sich Panik und Verzweiflung zurück. Dafür kommt Zorn auf.
Pest oder Cholera
Die Panik kommt schnell zurück: Das steht im Netz! Unlöschbar. Unverwüstlich schön unverwüstlich … Als allererste Stimme zum Buch. Das lesen künftige Rezensenten. Es gehört zu ihrem Job, sich auch über die Rezeption eines Buchs zu informieren, das man besprechen soll. Ich rezensiere doch selbst, ich sehe doch, wie oft – notorisch unterbezahlte – Buchkritiker nur mehr oder weniger verhohlen abkupfern, was »Leitmedien« vorgelegt haben. Wer hat denn noch die Zeit, die zig neuen Bücher überhaupt nur ganz zu lesen, wer kriegt den Platz, die eigene Meinung dazu mit Argumenten zu begründen? Ich bin obendrein noch selbst Schriftstellerin, ich kann mich an komischste Fehler (unter anderem war ich jahrelang in Kiew geboren) erinnern, die sich multipliziert haben, weil kein Mensch mehr schlichte Fakten prüft.
Das hier ist nicht komisch, es verbreitet sich viral. In unserem schönen neuen Digistan geht sowas schnell an die ganz analoge Existenz. Ich muss was dagegen tun – aber was denn bloß? Das Grundgesetz der medialen Selbstreferenzialität lässt doch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera: Wer widerspricht, wird belohnt mit dem Ruf der Zicke und dem Entzug von Aufträgen; wer die Klappe hält, gilt als souverän, aber der Schlamassel bleibt – etwa so wie bei einer betrogenen Ehefrau.
Wieder geht der Chor im Kopf los. Diesmal verstärkt, aber auch sortiert durch einen Chor von außen – Telefonate, Mails hin und her, mit befreundeten Journalistinnen, Schriftstellerinnen, mit einem Frankfurter Kollegen. Langsam kristallisiert sich ein Grundgefühl heraus: Die betrogene Ehefrau gefällt mir nicht, dann lieber Zicke.
Ich klappe den Computer wieder auf und schreibe einen Brief an Bernard Imhasly, in dem ich meine Suchergebnisse aufliste, ihn um bessere Übersetzungsvorschläge und um eine Erklärung bitte, woher die Schärfe seines Verrisses rührt. Ich schicke ihn als Anhang mit einer Mail an die NZZ-Redaktion:
Sehr geehrte Damen und Herren –
ich bin die Übersetzerin von Katherine Boos Buch, und Sie können mir glauben, ich bin immer zuerst mal froh, wenn in Rezensionen überhaupt die Arbeit der ÜbersetzerInnen erwähnt wird. Sie können mir auch glauben, dass ich Kritik als etwas grundsätzlich Konstruktives ansehe, erst recht, wenn sie an seriöser Stelle von kompetenten Menschen vorgetragen wird. Und wenn in Ihrer Zeitung – online wie gedruckt – von Ihrem langjährigen Südasienkorrespondenten meine Übersetzung eines Buchs über Mumbai kritisiert wird, dann nehme ich das sehr sehr ernst.
Ich habe mir also (zugegeben: zähneknirschend, weil mir Fehler, die ich mache, peinlich sind) genau angesehen, was Herr Imhasly moniert. Mit fortschreitendem Augenreiben verringerte sich das Zähneknirschen – es war nicht meine Peinlichkeit, der ich da auf die Spur kam. Das Ergebnis meiner Arbeit eines halben Tages habe ich in einem Schreiben an Herrn Imhasly zusammengefasst. Ich ziehe das offene Visier vor und setze mich immer gern direkt auseinander, ich habe meinen Brief an ihn angehängt und bitte Sie, ihn an ihn weiterzuleiten.
Ich kopiere die Fakten außerdem in diese Mail. So können Sie auf einen Blick und ohne Klicken erkennen, dass Herrn Imhaslys Behauptungen entweder nicht zutreffen oder man durchaus fruchtbar über sie streiten kann. (Wie, nebenbei, auch über manche von Herrn Imhaslys Interpretationen des ganzen Buchs.)
Die Schärfe seiner Attacke, die redaktionelle Heraushebung (Zwischentitel in Fettdruck) einer falschen Behauptung, der herausgehobene Ort der Rezension (Dossier), die Tatsache, dass die Rezension prominent bei SpiegelOnline ua als link angeboten wird – all das bedeutet eine massive Rufschädigung für mich. Ich bin eine freie Übersetzerin, das heißt, ich bin auf die Integrität meines professionellen Ruf existenziell angewiesen – mehr, als man es sich als angestellt Arbeitender vielleicht vorstellen kann.
Ich bitte Sie also herzlich darum, meinen guten Namen zu rehabilitieren, und bin auf Ihre Vorschläge gespannt.
Die nächsten zehn Tage verbringe ich einem Zustand, von dem man das meiste hinterher nur zu gern vergessen hat. Ich weiß noch, dass ich zwischen manchen blues in fast heiterer Kampflaune war. Imhasly, von der Redakteurin um Stellungnahme gebeten, reagiert mit einem noch aggressiveren Brief. Diskutieren möchte er nicht, der einzige Vorschlag, den er macht, betrifft einen in den PDFs noch fehlenden Satz, der ebenfalls im Buch steht – den hätte er bei nächster Gelegenheit in der deutschen Ausgabe gern ergänzt. Die Telefonate und Hin-und-Her-Mails gehen weiter, selbstverständlich informiere ich alle, die ich in meine dämliche Situation reingezogen habe, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass sie genauso in deadlines klemmen wie ich, kriege wieder mal Existenzängste.
Prinzip Hoffnung
Plötzlich, out of the blue, ein warmer Lichtstrahl: Klaus Binder hat beim Frankfurter Stammtisch von meinem Fall erzählt, und die KollegInnen schreiben einen Leserbrief.
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Kollegin Pieke Biermann hat uns von der Auseinandersetzung um eine Rezension von Bernard Imhasly zu Katherine Boos „Annawadi, oder der Traum von einem anderen Leben«, übersetzt von Pieke Biermann, berichtet. Wir kennen ihren Brief an Ihre Redaktion sowie an Imhasly und seine Antwort darauf.
Es geht uns wie der Kollegin: Wir erleben generell, dass (vor allem im Sachbuchbereich) die Tätigkeit von Übersetzern in den Medien und der Buchkritik, gelinde gesagt, unterbelichtet bleibt, in einem Maß, dass man auch von Missachtung sprechen könnte.
Wenn wir etwas zu unserer Arbeit lesen oder hören können, dann, im positiven Fall, mit generalisierenden Formeln wie „glänzend«, „flüssig«, „kongenial“; immerhin. Im negativen Fall aber zumeist beckmesserisch, auf einzelne „Fehler« bezogen (wobei den Übersetzern oft auch noch Schlampereien der Originalverlage angehängt werden).
Oder es ist, wie im vorliegenden Fall, dem Rezensenten vorzuwerfen, dass er seine Sorgfaltspflicht vernachlässigt und dass generalisierende Urteile sich auf Einzelheiten gründen. Auch der Rezensent sollte den Kontext seiner »Fundstellen« berücksichtigen – andernfalls kommt es zu solch gravierenden Fehleinschätzungen wie hier. Und manchmal wird das dann auch noch redaktionell unterstrichen, wie ebenfalls hier, durch Zwischentitel wie „Übersetzerische Fehlgriffe«. Sowas bleibt hängen. Selbst wenn es kaum begründet ist, wie sich gezeigt hat. Auch Zeitungen haben eine Sorgfaltspflicht.
Wir verstehen sehr gut, dass unsere Kollegin sich zur Wehr setzt, mit guten Argumenten. Und wir sind der Meinung, dass die NZZ ihr Raum nicht nur für einen Leserbrief, sondern für eine ausführliche Gegendarstellung geben sollte. Um so mehr, als es hier nicht nur um den Ruf einer erfahrenen und renommierten Kollegin geht, sondern um das Metier des Übersetzens, um dessen öffentliche Wahrnehmung und Würdigung.
Unsere dringende Bitte an Sie ist also: Geben Sie Pieke Biermann die Gelegenheit, ausführlich und an sichtbarem Ort zu antworten. Da wir sie auch als Autorin (und als Rezensentin) kennen, sind wir sicher, dass auf diese Weise ein Artikel entstehen wird, der Ihren Lesern einen interessanten Einblick in die verantwortungsvolle Aufgabe des Übersetzens bieten wird.
Mit freundlichen Grüßen
Helga Augustin, Karin Betz, Klaus Binder,
Pauline Cumbers, Irmgard Hölscher,
Liliane Meilinger, Eva Moldenhauer,
Birgit Schmitz, Andrea von Struve,
Elisabeth Thielicke
Eva Moldenhauer schickt ihn am 24. Oktober los. Einen Tag später antwortet ihr Angela Schader, die Redakteurin, cc an mich: Der Ressortchef habe ausnahmsweise eingewilligt, ich kriege 3.000 Zeichen und soll »sachlich formulieren«. Ich nehme sofort an.
Dann muss ich nur noch zwei Hürden überwinden: Alles zu 3.000 Zeichen zusammendampfen, und das redaktionelle Gerangel danach durchstehen. Mein Titel »Rezensentische Fehlgriffe« geht partout nicht durch, manches Wortspiel fällt den Usancen der NZZ zum Opfer. Aber endlich, am 1. November, erscheint:
Wie man Worte wägt
Kritik einer Übersetzungskritik
«Übersetzen ist Glücksache», hat Fritz Senn einmal formuliert. Das ist natürlich ein dialektisches Augenzwinkern von einem an Joyce geschulten Grossen, der souverän beurteilen kann, ob ein Übersetzer ein glückliches oder bloß ein linkes Händchen gehabt hat. Beim deutschsprachigen Feuilleton hat man leider oft den Eindruck, dass auch Rezensieren Glücksache ist, zumindest in Bezug auf die Arbeit der Übersetzer. Von seltenen kostbaren Ausnahmen abgesehen: Meistens wird sie «gar nicht erst ignoriert», manchmal pauschal am Rande gelobt – als «brillant» oder «kongenial».Hin und wieder macht sich ein Rezensent zum Beckmesser und hebt ein paar Wörter hervor, die ihm aufgefallen sind. Für den Übersetzer, der sich ja nicht wehren kann, ist das katastrophal. Zumal, wenn es in einem der wenigen seriösen Leitmedien passiert und «übersetzerische Fehlgriffe» zum fetten Zwischentitel werden. Das zieht Kreise, das prägt die Meinung von anderen Rezensenten, Verlagen, Veranstaltern – und kann schnell materiellen Schaden anrichten, denn Übersetzer leben von ihrem guten Ruf. Nach 35 Jahren Berufspraxis ist mir just das passiert, aber ausnahmsweise darf ich mich wehren. Ich habe, so das Verdikt, «irritierend viele Fehler» gemacht, zum Beispiel eine kameez als «Zweiteiler» übersetzt. Habe ich. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, wie unsereins heutzutage immer öfter arbeitet: mit PDF-Dateien, das deutsche Buch soll ja zeitnah erscheinen. Da steht dann leider noch ein two-piece outfit, das erst im Originalbuch zur kameez wird.
Hinter allen inkriminierten Wörtern stehen vielschichtige übersetzerische Entscheidungen, wie Übersetzer sie immer treffen müssen, für deren Erläuterung mein Platz hier leider nicht reicht. Ihr Fundament ist immer der Gesamtton, sind Atmosphäre, Musikalität, Rhythmus, Sprachebenen, Wortfelder usw. Bei jeder Übersetzung geht vieles verloren, gute Übersetzer versuchen das durch Bereicherung anderswo auszugleichen, bauen sanft Brücken bei «exotischen» Begriffen ein, wägen ab, ob sie ein Originalwort übernehmen oder eindeutschen. So wurde aus central Mumbai (nicht Central) meine «Altstadt», obwohl Mumbai die im europäischen Sinn nicht hat: Bei Altstadt denkt ein hiesiger Leser an «historisch» und kann auf «Kolonialstil» kommen. Die «Scheisse», in die bei mir «geritten» (nicht getreten) wird, schien mir ideal für die vulgär-böse Klappe der Frau, die das androht und durchzieht. To put someone in a trap meint «jemanden reinreiten», meine Slang-Lexika bieten zu trap ausser «Fresse» auch «Latrine», die wiederum eine böse Rolle in Fatimas Leben spielt. «’ne Party steigen» dagegen lässt bei mir niemand. Im Original wird jedoch einmal erwähnt, dass reiche Mumbaier throw a lavish party – bei mir ein «extravagantes Event». Auf Norddeutsch frisierter Slang?
Entscheidungen sind immer Interpretationen – bester Streitstoff. Gute Übersetzer wünschen sich sehnlichst mehr öffentlichen Streit. Er täte beiden Seiten gut, allerdings nur, wenn beide Seiten Original wie Übersetzung als Ganzes und mit Sorgfalt würdigen. «Annawadi» – diese Literatur gewordene Reportage über Überlebensintelligenz und Moralität unter grausamsten Bedingungen, also über die «Hoffnung», die trotz allem «keine Fiktion ist», wie Katherine Boo schreibt, wäre ein prima Objekt.
Vierzehn Tage Heulen & Zähneklappern sind zu Ende. Ich kehre endlich zurück in die Erwerbsroutine und schlafe wieder aus. Bis heute habe ich allerdings das Wort »Pyrrhussieg« nicht ganz aus dem Kopf gekriegt. Immer wieder mal, mitten im »Wägen« von »Worten«, schiebt sich die Frage nach vorn: Lohnt sich das denn alles? Ja, verdammt nochmal! Weil … ach, das weiß man doch, wenn man das hier gelesen hat!
 Mit freundlicher Genehmigung des Verlags haben wir den Text leicht gekürzt entnommen aus ›Souveräne Brückenbauer. 60 Jahre Verband der Literaturübersetzer (VdÜ)‹. Der VdÜ trifft sich vom 26. bis 29. Juni in Wolfenbüttel zu seiner Jahrestagung.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags haben wir den Text leicht gekürzt entnommen aus ›Souveräne Brückenbauer. 60 Jahre Verband der Literaturübersetzer (VdÜ)‹. Der VdÜ trifft sich vom 26. bis 29. Juni in Wolfenbüttel zu seiner Jahrestagung.
Titelangaben
Helga Pfetsch (Hg.): Souveräne Brückenbauer. 60 Jahre Verband der Literaturübersetzer (VdÜ)
Köln: Böhlau 2014
323 Seiten. 24,90 Euro
Reinschauen
| Bildgewaltiges Glanzstück – Marc Strotmann zu Katherine Boo: Annawadi oder der Traum von einem anderen Leben





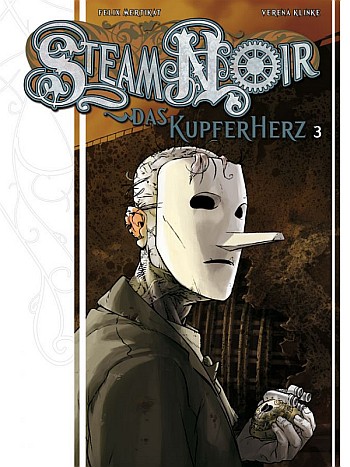
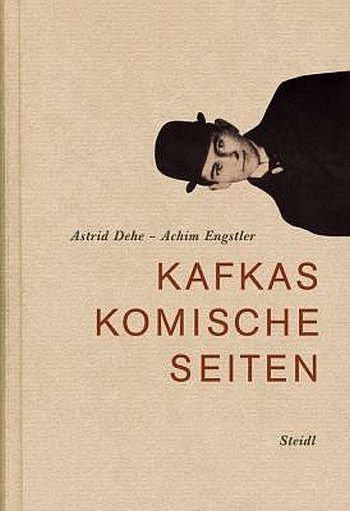




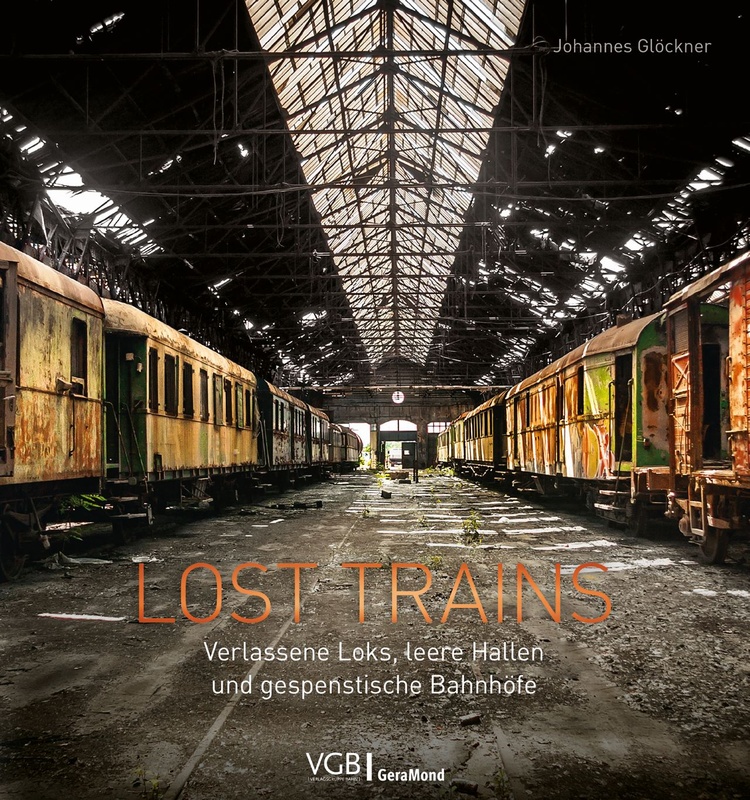
[…] Rezensentische Fehlgriffe – Pieke Biermann wehrt sich gegen aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Kritik in einer Rezension zu einer ihrer Übersetzungen. Sie schildert die ganze Affäre und geht auch konkret auf die vom Rezensenten genannten Beispiele ein. Ein Problem, das wir Übersetzerinnen oft haben, ist, dass man häufig nur eine PDF Datei des Originaltextes bekommt, die vom gedruckten Buch, dank nachträglicher Änderungen abweichen kann. Ist mir gerade mit das Blut der Helden passiert. Da weicht meine PDF-Datei von der Kindle-Version ab, die dem Lektor vorliegt. Da kann es dann Abweichungen geben, wenn ein Leser Original und Übersetzung vergleicht. Ein Rezensent, der eine Übersetzung kritisiert, sollte auf jeden Fall sorgfältig sein, und korrekt aus dem Text zitieren, nicht einfach aus dem Gedächtnis, ohne Seitenangaben. Schließlich will er ja seine Behauptungen auch belegen. […]
[…] Pieke Biermanns Artikel lesen möchte, hier steht […]
[…] Rezensentische Fehlgriffe […]
furniturewallah = Möbelfritze = Volltreffer!
Ich zitiere aus einem anderen Kommentar: „Kein Ehrgefühl, kein Mitgefühl, kein Rückrat, kein Einsehen und kein Gespür für die eigene ‚Macht'“. Ein Eindruck, den ich oft beim Zeitunglesen und insbes. bei der kritischen Auseinandersetzung (egal um welches Thema) damit habe. Journalisten sind eine bunte Truppe wie der Rest der Bevölkerung, von klugen, gewissenhaft und kenntnisreich Schreibenden bis hin zu dummen und böswilligen Idioten. Man sollte annehmen, dass die Letzteren dank interner und externer Qualitätskontrolle verschwänden oder zu besserer Arbeit gebracht würden, aber diese Vorstellung ist leider naiv.
Tja, Rehabilitierung hin oder her… Den Schaden hat der Südasienkorrespondent, vorher Diplomat, ja angerichtet…
Ich schätze mal, dass Pieke Biermann spätestens mit der aktuellen Verlinkung dieses Artikels auf BildBlog rehabilitiert sein dürfte. Ich wünsche ihr jedenfalls zukünftig gründlichere Kritiker, aber weiterhin soviel Unterstützung durch ihre Mitstreiter.
Auf jeden Fall werde ich mir ihren Namen einfach mal merken – und beim nächsten Bücherkauf als Qualitätsmaßstab für gute Übersetzung im Hinterkopf behalten. Von daher: Vielen Dank für den Text!
Falls Pieke Biermann den Text lesen sollte: Onkel Hotte hat schon recht; „Hurensohn“ ist ein trefflicher Ersatz für „motherfucker“.
Wer weiß wozu es gut war….. jedenfalls „kenne“ ich sie sowie ihr übersetztes Buch jetzt und es landete schonmal auf meinem amazon-Wunschzettel :)
Lehrreich und interessant, das alles… Nur mal am Rande gefragt: Warum haben Sie eigentlich „motherfucker“ mit „Mutterficker“ übersetzt? Das sagt doch im Deutschen niemand, zumindest wäre mir das bislang nie aufgefallen. Warum nicht etwas freier übersetzen mit einem geläufigeren, weitverbreitetem und ähnlich starkem deutschen Schimpfwort? („Arschficker“, „Hurensohn“ oder dergleichen?)
Liebe/r (?) A.P. –
herzlichen Dank! Gute Frage, ich habe lange überlegt. Auch so Schimpfwörter haben ja immer mindestens zwei Ebenen – den Wortsinn und die Gebräuchlichkeit. Wo auf Englisch zum „motherfucker“ gegriffen wird, es aber vor allem um gängige Drastik geht und der Inhalt/WortSINN keine große Rolle spielt, greifen wir zu „Dreckskerl“ oder „Arschloch“ – „typisch deutsch“: auf Deutsch beleidigt und flucht man eher anal/fäkal als sexuell. Trotzdem schwingt der Wortsinn immer mit.
Fatima hat Abdul mit aller ihr möglichen verbalen Härte niedermachen wollen – nun spricht sie aber nicht Englisch, sondern vermutlich Marathi oder Gujarati, ihr „motherfucker“ ist also schon eine Übersetzung. Sie meint mit Sicherheit – das kann man dem ganzen Kontext entnehmen – keine homophobe Anspielung, insofern kommt der „Arschficker“ nicht in Frage. Den „Hurensohn“ habe ich auch als unbrauchbar empfunden. Für Fatima, die selbst vom halben Slum als Hure verunglimpft wird, wäre es – nach meinem Gefühl, das natürlich falsch sein kann – ein zu schwieriges emotionales Manöver, die Mutter der Jungen zur Hure zu erklären (ua weil sie sie zutiefst beneidet, die Mutter gehört auch zu den wenigen, die Verständnis, Mitgefühl für Fatima aufbringen). Und sie zielt auf ihn, ganz direkt, nicht als „Ableitung von Mama“.
Dann ist da noch die Sache mit dem Rhythmus – „motherfucker“ hat 4 Silben mit einer bestimmten Betonung, „Hurensohn“ nur 3. Um das auszubügeln, könnte man natürlich „Hurensöhnchen“ sagen, nur – dann wäre die halbe Härte futsch.
Am Ende habe ich mich für die schlichte Eindeutschung entschieden, obwohl die etwas ungebräuchlich ist. Auch der „Hurensohn“ ist bei uns noch nicht sooo lange gebräuchlich. Wenn ich nicht irre, ist der erst durch die Italo-Western (60s ff) bei uns popularisiert worden.
Das waren so ein paar Überlegungen hinter dem „Mutterficker“. Der Rest war die simple, vielleicht etwas schlitzohrige Spekulation: „motherfucker“ ist inzwischen so bekannt bei uns, dass man sofort drauf kommt und ich Fatima nicht „doppelt englisch verfremden“ muss.
Herzliche Grüße –
Pieke Biermann
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung! …die auch noch mal zeigt, dass es wohl zuweilen äußerst knifflig ist, die „richtige“ Übersetzung zu finden bzw. es häufig genug mehrere Möglichkeiten gibt, die alle gleichermaßen „korrekt“ wären.
Auch mich irritiert die Übersetzung „Mutterficker“.
Warum es dann nicht gleich beim englischen Original belassen? Also warum kann dann Fatima nicht fluchen? »Wenn du nicht sofort aufhörst, mein Haus zu zerkloppen, du Motherfucker, dann reit ich dich voll in die Scheiße.«
Oder warum nicht „Wichser“ verwenden, wenn es ein deutscher Begriff auf der sexuellen Schimpf-Ebene sein soll?
Auf jeden Fall vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit & alles Gute.
Und was ist jetzt mit dem Süasienkorrespondenten?
Schludrigkeit war schon immer ein Merkmal der Journallie. Durch INet fällt es nur zunehmend auf, da sich die Leser an anderen Quellen schnell verischern können, was ihnen da als Qualität verkauft wird.
Schade, dass Medien sich ihrer Sorgfaltspflicht nicht mehr bewusst sein wollen.
Damit verlieren sie in meinen Augen ihre Relevanz und sind dann nicht mehr als Propagandaflyer mit Anzeigen … Schade drum …
Sehr schade, dass die NZZ sich erst durch den Einsatz von einem größeren Kreis von Interessierten zu einer „Korrektur“ bemüßigt sah. Das unterstreicht m.E. nur meinen obengenannten Vorwurf. Kein Ehrgefühl, kein Mitgefühl, kein Rückrat, kein Einsehen und kein Gespür für die eigene „Macht“ … und somit irrelevant, austauschbar und enttäuschend …