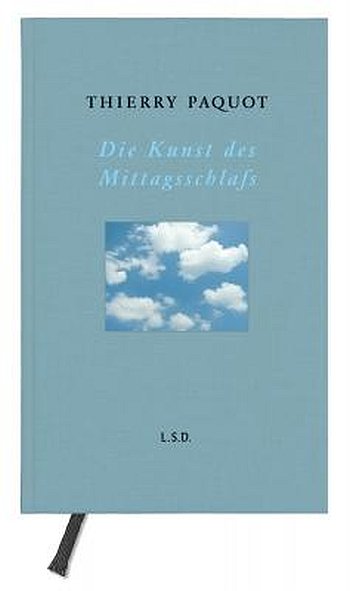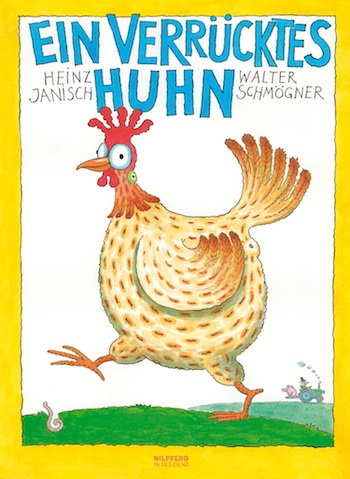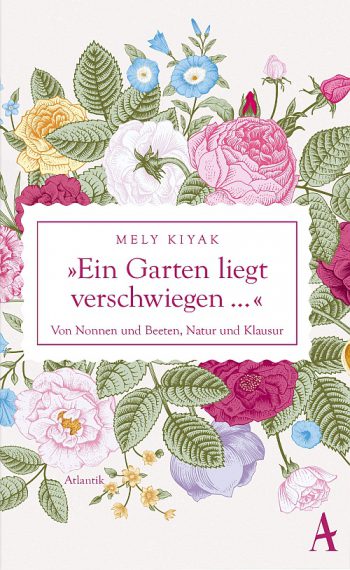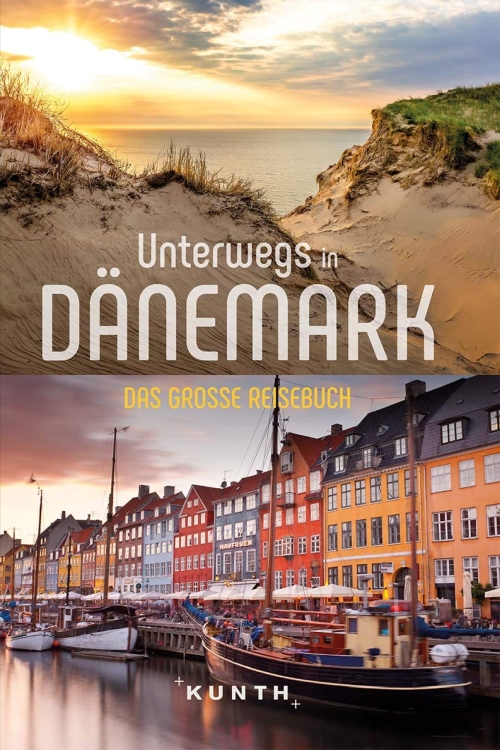Astrid Dehe/Achim Engstler: Kafkas komische Seiten
Beim Namen Franz Kafka denken die meisten an Beklemmendes wie Der Prozess oder Das Schloss, an Unheimliches wie Ein Bericht für eine Akademie oder In der Strafkolonie. Dabei ist es eigentlich kein Geheimnis, dass Gregor Samsa Züge einer Comic-Figur hat. Im Allgemeinen gilt Kafka weiter als »Schmerzensmann«, sind Kafka und Komik nicht kompatibel. Mit diesem falschen Bild räumt das Buch Kafkas komische Seiten von Astrid Dehe und Achim Engstler gründlich und vergnüglich auf. Von PIEKE BIERMANN
 Anmutiger als Astrid Dehe und Achim Engstler kann man das eherne Monument mit dem Etikett »Franz Kafka – Pater Doloroso der deutschsprachigen Literatur« nicht vom Sockel holen. Zwar wussten seine Zeitgenossen (und publizierten das auch), dass Kafka dem eigenen Lachen so wenig abhold war wie dem Provozieren des Gelächters anderer, und hatte Walter Benjamin den Verdacht, dass Kafka und Komik eine innere Verbindung haben und die wiederum im Judentum verankert sein könnte.
Anmutiger als Astrid Dehe und Achim Engstler kann man das eherne Monument mit dem Etikett »Franz Kafka – Pater Doloroso der deutschsprachigen Literatur« nicht vom Sockel holen. Zwar wussten seine Zeitgenossen (und publizierten das auch), dass Kafka dem eigenen Lachen so wenig abhold war wie dem Provozieren des Gelächters anderer, und hatte Walter Benjamin den Verdacht, dass Kafka und Komik eine innere Verbindung haben und die wiederum im Judentum verankert sein könnte.
Er ahnte 1939: »Dem würde der Schlüssel zu Kafka in die Hände fallen, der der jüdischen Theologie ihre komischen Seiten abgewönne.« Zwar haben in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Autoren der Neuen Frankfurter Schule – Robert Gernhardt und Eckard Henscheid – den komischen Kafka entdeckt und sind seitdem Kafka-Forscher wie Reiner Stach und Hans-Gerd Koch immer wieder explizit auch auf Kafkas Beziehungen zu Komik und Witz zu sprechen gekommen. Aber es half alles nichts.
Fällt der Name »Kafka«, raunt in den gebildeten Ständen noch immer ein heiliger Ernst, der aus ihm eine Art Katastrophenjule mit Erhabenheitssiegel gemacht hat. Es ist nun mal so – nicht nur in Deutschland, aber hier besonders dickköpfig –, dass Komisches säuberlich von Ernstem ferngehalten werden muss. Witz gehört ins Reich des Unseriösen und Trivialen. Kein Wunder, dass Franz Kafka dem einfach leselustigen breiten Publikum hierzulande noch immer versperrt ist. Er musste erst (imaginäre) 125 Jahre alt werden – man kann auch sagen: (reale) 84 Jahre tot sein –, bevor die WELT mit Ulf Poschart verblüfft ausrief: »Über Kafka darf jetzt gelacht werden«, und Bernd Eilert, ein anderer Neufrankfurtschüler, in der FAZ wieder einmal auf »Die komischen Talente eines Schmerzensmannes« hinweisen durfte. 2008 ist der Andachtskäfig ein kleines bisschen aufgesprungen. Astrid Dehes und Achim Engstlers jüngst erschienenes Buch reißt ihn endlich sperrangelweit auf.
In 36 Kapiteln mit herrlichen Titeln wie 25 harte Eier oder Die dicke warme Rehberger oder Schmutzian legen Dehe und Engstler Kafkas komische Seiten frei, und zwar im doppelten Sinn – lebensweltlich wie literarisch. Fast alle Kapitel beginnen mit einem Kafkaschen O-Ton. Das sind zumeist Auszüge aus seinen Tagebüchern und seinen Briefen an Felice Bauer, Milena Jesenská, seine Schwester Ottla und Max Brod oder aus den noch zu Lebzeiten veröffentlichten oder nachgelassenen Texten, hin und wieder auch aus den berühmten Werken wie Der Proceß oder Die Verwandlung. In einem Brief an Felice zum Beispiel schildert Kafka den legendären Lachkoller, der ihn als kleinen Beamten angesichts des Firmenpräsidenten gepackt hatte. Das liest sich wie ein Lehrstück für Film-Gagschreiber – wie baut man ganz sanft eine salbungsvoll-autoritäre Situation so eng, dass das Gelächter unausweichlich, aber gleichzeitig nicht justiziabel ist: als antiautoritärer Befreiungsschlag nämlich.
Von anderem – durchaus bitterem, verzweifeltem – Witz sind Kafkas Zickzack-Kurse in Sachen Frauen, die Ver- und Entlobungen, die x-mal angekündigten und wieder abgesagten Treffen, die Idee der »Ehe per Brief«, die Liste der Vor- und Nachteile von Eheschließungen, die Vorliebe des klapperdürren notorischen Veganers für »fette Füßchen« und weich-warmes Fleisch an den Vertreterinnen des anderen Geschlechts. Oder der Hang, bei allem Ernst, mit dem er sich paramedizinischen »Lichtluftkuren« aussetzt oder sich fürs Judentum und die Begegnung mit einem leibhaftigen ostjüdischen Rabbi interessiert, immer auch den »bösen Blick«, das feine Gehör für die winzigen, entlarvenden oder enttäuschenden Widersprüchlichkeiten nicht abzuschalten.
Natürlich ist die Komik, um die es geht, nicht schenkelklopfend-wiehernd. Sie ist vertrackt, hintersinnig, bizarr kasuistisch oder schiere, quasi vegetative Subversion: das Antidot gegen Anonym-Übermächtig-Beängstigendes, das niemand in so universell gültige Prosa übersetzt hat wie Kafka. Das beste Mittel gegen Angsthaben ist bekanntlich Angstmachen, und wem dazu die Macht fehlt, dem bleibt nur das Lachen. Dehe und Engstler nehmen den O-Ton jeweils wie einen Ariadnefaden durch die Kafkaschen Labyrinthe, ziehen andere Fäden – Lebensereignisse, Liebesnöte, literarische Entwicklungen – als Subtexte hervor, verknüpfen sie mit weiteren Textstellen, O-Tönen von anderen und Bildern (unter anderem Zeichnungen von Kafka, die zwischen Giacomettischer Langgliedrigkeit und Paul Floras Strich oszillieren) und machen so historische und individuelle Kontexte sichtbar.
Von den beiden Autoren ist bisher nur bekannt, dass sie gelernte Germanisten sind, die eine außerdem Theologin, der andere Philosoph, dass ihre Leben seit Jahrzehnten von Kafka begleitet werden und dass die Idee eines Buches über Kafkas komische Seiten insofern nahelag, als Achim Engstler komisch ist und Astrid Dehe Seiten hat. Wer keine schnöden Daten braucht, erfährt allerdings eine Menge mehr über sie aus ihrer wunderbar leichtfüßigen und gleichzeitig konzentrierten, sorgfältigen Prosa. Mit ihr öffnen sie en passant auch Türen zu Kafkas Werk ganz ohne angsterzeugende Schwellen.
Kafkas komische Seiten sind Balsam für alle Kafka-Liebhaber, die beim Wort kafkaesk immer den komischen Unterton mithören – es ist eben nicht zufällig mit derselben Endung gebaut wie grotesk oder karnevalesk.
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 26.01.2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
| PIEKE BIERMANN
Titelangaben
Astrid Dehe/ Achim Engstler: Kafkas komische Seiten
Göttingen: Steidl Verlag 2011
324 Seiten. 29,80 Euro