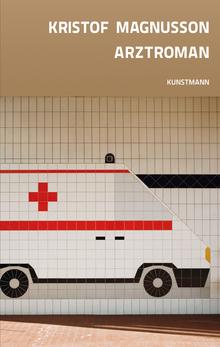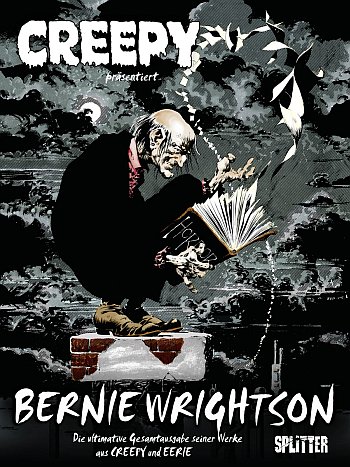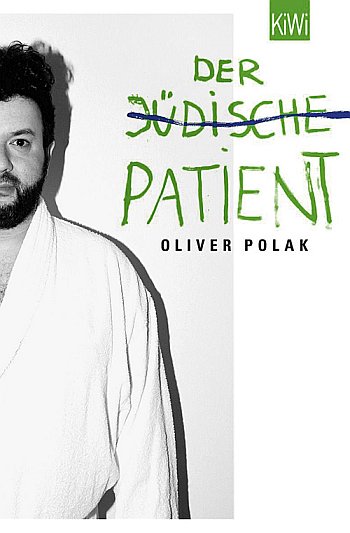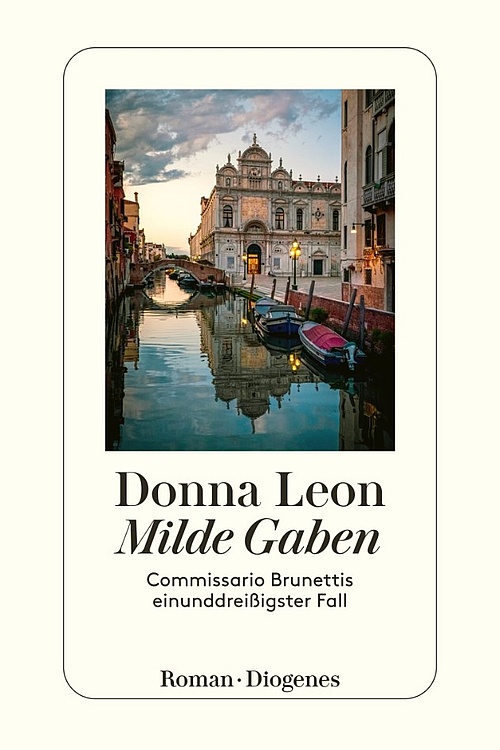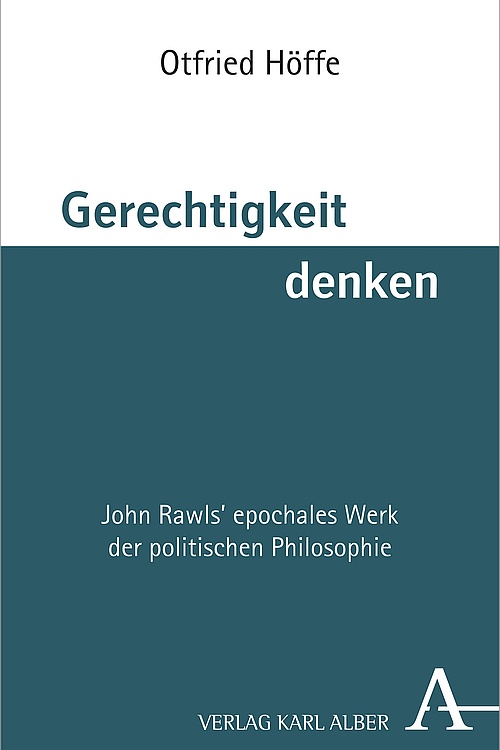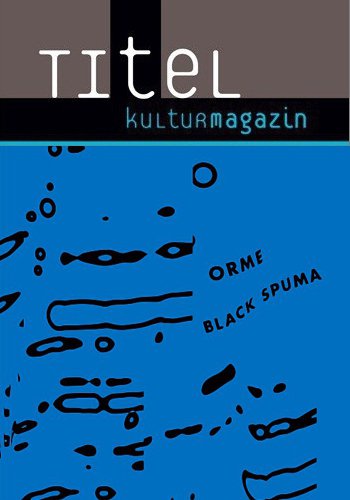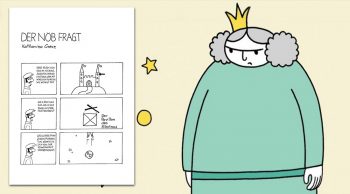Menschen | Zum Tode von Siegfried Lenz
Siegfried Lenz war einer der letzten großen Geschichtenerzähler, ein stilsicherer Traditionalist, ein schriftstellerisches Urgestein, das ganz der Kraft des Erzählens vertraute und zum Meister der »kleinen Tragödien« avancierte. Lenz neigte stets zum nordischen Understatement, war ein verbaler Leisetreter – sowohl in seinen Büchern als auch in seinen Äußerungen als öffentliche Person. PETER MOHR zum Tode des Schriftstellers Siegfried Lenz.

Bundesarchiv, B 145 Bild-F030757-0019 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA
Seine persönliche Krise, die 2006 der Tod seiner Frau Liselotte ausgelöst hatte, ist bewältigt. Siegfried Lenz sprühte wieder vor Tatendrang. Ein schmales Erzählwerk mit dem Titel ›Die Maske‹ war zuletzt 2011 erscheinen. Dass er wieder zurückgefunden hat zum Schreiben, sei Ulla zu verdanken, jener Frau, die ihn ermutigt hatte, die ›Schweigeminute‹ abzuschließen und die er 2010 geheiratet hatte.
Im Laufe seiner sechzigjährigen Tätigkeit als Schriftsteller hat Lenz, der am 17. März 1926 im ostpreußischen Lyck geboren wurde, zahlreiche Literaturpreise erhalten. Aber kaum eine andere Auszeichnung hat ihn so erfreut und war gleichzeitig so sinnstiftend wie der ihm 1985 verliehene Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck. Die bisweilen chronistische Funktion seiner Romane, der Hang zur epischen Breite und die geradezu innige Verschmelzung mit seinen Figuren (»Ich bin alle meine Figuren selbst«) verband ihn mit Thomas Mann ebenso wie der hanseatische Lebensraum und die Affinität zur sanften politischen Einmischung.
Schon in seinen erfolgreichen Frühwerken (›Es waren Habichte in der Luft‹, ›So zärtlich war Suleyken‹, ›Der Mann im Strom und ›Das Feuerschiff‹) hatte Lenz seinen Stil gefunden, den er – nur in Nuancen verändert – immer beibehalten hat. Die Sprache, diese wohlausgewogene Balance zwischen überbordendem Erzählfluss und einfachem Vokabular, wurde zu seinem Markenzeichen. Lenz hat so ein Massenpublikum erreicht, wie die Gesamtauflage von weltweit über 25 Millionen Exemplaren nachhaltig dokumentiert.
Zwischen 1965 und den frühen 70er Jahren unterstützte er (wie seine Kollegen Günter Grass und Heinrich Böll) in Wahlkämpfen die SPD, und er begleitete Bundeskanzler Willy Brandt im Dezember 1970 sogar zur Unterzeichnung der Ostverträge nach Warschau. Mit Brandt-Nachfolger Helmut Schmidt verband ihn eine lange Freundschaft, gerade ist bei Hoffmann und Campe der von Jörg Magenau herausgegebene Band ›Geschichte einer Freundschaft‹ erschienen.
Lenz hat immer darauf beharrt, mit seinen Geschichten auch Geschichte erzählen zu wollen. Am eindrucksvollsten gelang ihm dies im Roman ›Deutschstunde‹ (1968) in der Darstellung des Konflikts zwischen dem Kunstmaler Nansen, der Emil Nolde nachempfunden ist, und dem obrigkeitshörigen Dorfpolizisten Jepsen, der in der NS-Zeit das gegen seinen Jugendfreund Nansen verhängte Berufsverbot unnachsichtig überwachte. Jepsens Sohn Siggi rollt diesen »Fall« in einer Strafarbeit mit dem Titel ›Freuden der Pflicht‹ auf. Die ›Deutschstunde‹ wurde in über 20 Sprachen übersetzt, mehr als zwei Millionen Mal verkauft und später (wie viele andere Lenz-Bücher) erfolgreich verfilmt. Ein Roman soll – so hat es Siegfried Lenz 1992 in seinem Essayband ›Über das Gedächtnis‹ zum Ausdruck gebracht – primär Erinnerungsarbeit leisten: »Es wird der Erzähler sein, der uns den Strom vergangenen Lebens am anschaulichsten erfahrbar macht.«
Der letzte ganz große »Romanwurf« gelang Lenz 1978 mit dem ›Heimatmuseum‹, dessen Umfang er »als unhöflich dick‹ bezeichnete. Ein leidenschaftliches Plädoyer für einen unideologischen Heimatbegriff, dargestellt am Schicksal des aus seiner masurischen Heimat vertriebenen Zygmunt Rogalla. Der Protagonist verbrennt sein in Schleswig-Holstein aufgebautes ›Heimatmuseum‹, als ihn revanchistische Vertriebenenverbände politisch zu vereinnahmen versuchen.
Nicht nur die Handlungsorte Masuren und Hamburg, sondern auch viele Motive tauchten in Intervallen immer wieder auf. Schon früh setzte sich Lenz mit dem Älterwerden auseinander – erstmals 1959 in ›Brot und Spiele‹ anhand der nachlassenden Leistungsfähigkeit eines Sportlers. Ein weiteres zentrales Sujet des Naturliebhabers und passionierten Anglers ist die fortschreitende Zerstörung des Lebensraums. Diese beiden Leitmotive hat er 1994 im Roman ›Die Auflehnung‹ zusammengefasst. Die Wittmann-Brüder durchleben Alterungsprozess und Naturzerstörung; der eine als Tee-Experte, dessen Geschmacksnerven plötzlich nicht mehr funktionieren, der andere als Forellenzüchter, dessen Teiche von der Natur und von wenig friedliebenden Nachbarn angegriffen werden.
Leben und Schreiben sind bei Lenz kaum voneinander zu trennen. Sein Alltag und sein literarisches Werk korrespondieren unentwegt miteinander: »Ich drehe mich einfach um in Augenblicken der Verzagtheit, oder der Bilanzwehmut, schaue auf die Buchreihe, die da steht, und finde ein gewissermaßen materialisiertes Leben vor. Es ist da, es ist anwesend, ich kann mir sagen, von 51 bis 53 hast du das versucht, dann das, dann hast du zwischendurch einen Band mit Erzählungen geschrieben. Mit anderen Worten, das verflossene Leben präsentiert sich«, erklärte der Jubilar 2001 in einem NDR-Interview.
Mit der schmalen Novelle ›Schweigeminute‹ war Lenz 2008 noch einmal ein Meisterwerk gelungen – ein wunderbar gefühlvolles Buch, in dem man – trotz der impliziten Tragik – die menschliche Wärme körperlich zu spüren glaubte. Es war die federleichte Liebesgeschichte eines in die Jahre gekommenen Autors.
Siegfried Lenz, der zuletzt abwechselnd im Hamburger Stadtteil Othmarschen, auf der dänischen Insel Alsen und im schleswig-holsteinischen Tetenhusen lebte, war einer der letzten ganz großen Geschichtenerzähler, einer der Protagonisten der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Im Sport ist es fast unmöglich, was bei Lenz in der Literatur funktionierte: Er war ein Meistersprinter auf der erzählerischen Kurzstrecke, ausgestattet mit einer beneidenswerten Kondition für die langen »Roman-Distanzen«. Am Dienstag ist Lenz in Hamburg im Alter von 88 Jahren gestorben.
Reinschauen
| ›Fundbüro‹ im TITEL kulturmagazin
| ›Schweigeminute‹ im TITEL kulturmagazin
| ›Landesbühne‹ im TITEL kulturmagazin
| »Drei Tassen Kaffee, zwei Pfeifen, und ich bin in Fahrt!« Siegfrid Lenz zum 85. Geburtstag – im TITEL kulturmagazin