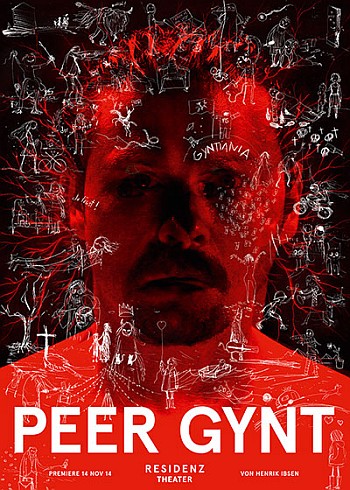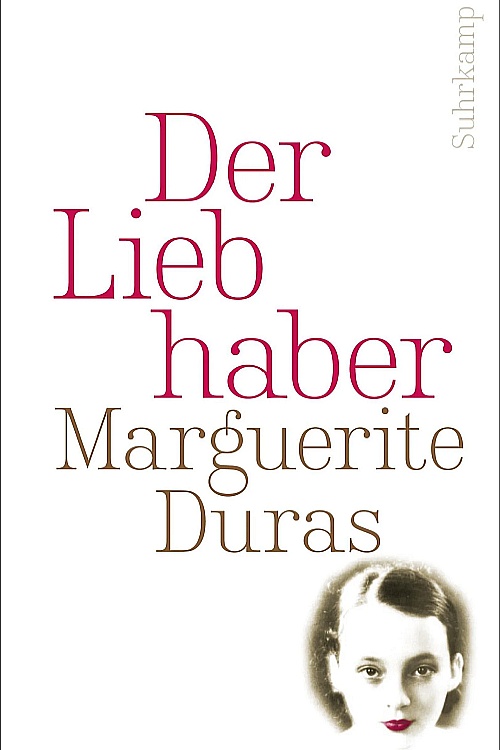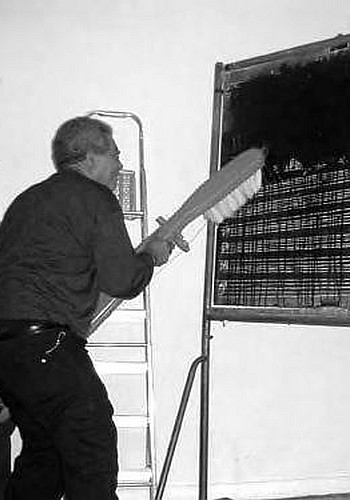Menschen | Oliver Polak: Der jüdische Patient
»Comedy: kann man so meinen, muss man aber nicht«, sagt der jüdische Comedian Oliver Polak gerne bei seinen Auftritten, die von mitunter sehr harten Gags bestimmt werden. Mindestens genauso hart ist seine schwere Depression gewesen, über die Polak nun das Buch ›Der jüdische Patient‹ geschrieben hat. MARTIN SPIESS hat es gelesen.
 Von Robin Williams stammt der bezeichnende Satz, Deutschland habe keine guten Comedians mehr, weil es sie alle umgebracht habe. Der Comedian und Schauspieler, der im August dieses Jahres Selbstmord beging, litt an einer schweren Depression. Das Bild des traurigen Clowns mutet zwar klischeehaft an, aber es trifft zu: Oft sind es die zerrissensten Menschen, geplagt von Selbstzweifeln oder traumatisiert, die ihrem eigenen Schrecken den Humor entgegensetzen.
Von Robin Williams stammt der bezeichnende Satz, Deutschland habe keine guten Comedians mehr, weil es sie alle umgebracht habe. Der Comedian und Schauspieler, der im August dieses Jahres Selbstmord beging, litt an einer schweren Depression. Das Bild des traurigen Clowns mutet zwar klischeehaft an, aber es trifft zu: Oft sind es die zerrissensten Menschen, geplagt von Selbstzweifeln oder traumatisiert, die ihrem eigenen Schrecken den Humor entgegensetzen.
Im Fall des jüdischen Comedians Oliver Polak geht dieses Trauma, geht diese Verzweiflung noch einen Schritt weiter. Es ist nicht der eigene Schrecken, der bei Polak eine schwere Depression auslöste, es ist der Schrecken eines Landes und seiner Geschichte. Polaks Vater überlebte Nazi-Verfolgung und KZ, hat sich davon aber nie richtig erholt. Darunter litt der Sohn, der das einzig Naheliegende tut: diese Geschichte auf die Bühne zu bringen. Humor, wie ihn die Nazis auszurotten versucht haben.
Oliver Polak, dessen erstes Buch ›Ich darf das, ich bin Jude‹ bereits zum Bestseller wurde, hat nun ein zweites Buch geschrieben. ›Der jüdische Patient‹ heißt es, und er erzählt darin von seiner Depression, von seiner Familie und wie der Holocaust sie zerstörte, von den Schwierigkeiten, in Deutschland Comedy zu machen – und wie er schließlich an all dem verzweifelte, verzweifeln musste.
Comedy als belanglose Feelgoodscheiße
Polak erzählt mit seiner gewohnt umgangssprachlichen Art, in die er seine charmanten Anglizismen mischt, und das mit einem Maß an Aufrichtigkeit, das man bewundernswert nennen muss, so stigmatisiert sind psychisch kranke Menschen heute in Deutschland leider immer noch. Das Buch ist dabei nicht nur ein Lanzenbruch dafür, psychische Krankheiten endlich als das ernst zu nehmen, was sie sind – nämlich Krankheiten –, es zeigt auch, dass ein Mann einen Fick drauf geben kann, was man von seiner Verzweiflung denkt.
Was er denkt, das teilt Polak dem Leser jedoch sehr direkt mit: was er von den zahllosen Comedians hält, die belanglose Feelgoodscheiße wiederkäuen, anstatt die Bühne als Chance zu betrachten, Wahrheit und Erkenntnis zu erzeugen – oder zumindest richtig gute (also harte) Gags zu erzählen.
Er erzählt davon, wie das befreundete Ehepaar der Eltern am Geburtstag von Polaks Vater zum Gratulieren kommt, nur um zu sagen, dass was die Israelis mit den Palästinensern machen, schlimmer sei als der Holocaust. Wie eine alte Schulfreundin Polaks, der er erzählt, wie schlecht er sich fühle, umgeben von all den Deutschen, die auch noch 75 Jahre später randvoll sind mit Vorurteilen und Ressentiments, mit Ablehnung und Hass, ihm rät, er solle abhauen und Deutschland verlassen. Oder wie der Host des »Quatsch Comedy Club« sich für einen Auftritt Polaks entschuldigt, anstatt darauf hinzuweisen, dass das hier ein Raum für Comedy ist, das Publikum sich also nicht beschweren dürfe.
Man muss nicht – wie der Autor dieser Rezension – selbst Comedian sein, um darüber bestürzt zu sein, wie das humorlose Deutschland mit einem Comedian umgeht, der streitbare Gags erzählt, um mehr hervorzubringen, als billige Lacher, aber fast nur Kopfschütteln und Kritik erntet. Der Pointen bringt, die wehtun, aber durch den Schmerz Auseinandersetzung bewirken können. Und es macht wütend, dass so wenige von uns – Deutsche genauso wie Comedians – die Tatsache akzeptieren, dass Hitler und der Nationalsozialismus zur deutschen Geschichte gehören und jede Generation die Verantwortung hat, bewusst damit um- beziehungsweise gegen Antisemitismus und Rassismus vorzugehen.
Das Steuer herumreißen – bei Tempo 180
In Oliver Polaks Fall hatten Ausgrenzung und Geschichtsverweigerung einen einschneidenden Effekt: Er leidet so sehr unter der Absenz von Mitgefühl in diesem Land, dass er eine Depression bekommt. Er fragt sich, bei 180km/h auf der Autobahn: »Hallöchen, einfach mal das Steuerrad rumreißen und bääm! Eine Sekunde und weg – einfach durchziehen. Den Mut brachte ich nicht auf. Obwohl, vielleicht ist es auch mutiger, sich nicht umzubringen.«
›Zeige deine Wunde‹ heißt eine Installation von Joseph Beuys aus dem Jahr 1974, deren Message ihr Titel selbst ist: Man soll sich seine Verletzlichkeit eingestehen. Nur wenn wir uns unserer Wunden bewusst werden und sie offen machen, können wir Heilung erwarten.
Polak zeigt seine Wunde, erklärt, hinterfragt, analysiert oder lässt in Therapiesitzungen analysieren. Er erzählt offen von seinen Ängsten und Traumata, und dabei ist es gerade seine entspannte, kumpelhafte Sprache, die Empathie erzeugt: Als ob er einem bei Bier und Kippe davon erzählen würde.
Am Ende des Buches (beziehungsweise des Klinikaufenthalts) steht für Polak die Erkenntnis, dass er nur eines machen kann: weiter. Seine Therapeutin sagt in der letzten Gruppensitzung: »Sie können sich nicht mehr erlauben, wegzulaufen. Gehen Sie auf die Bühne, das ist das Beste, was Sie machen können!« Kurz bevor er den Raum verlässt, ruft sie ihm zu: »Fallen Sie nicht beim erstbesten Stolperstein zur Erde. Fangen Sie sich – und weiter!«
Ausweg oder Flucht
Schon während des gesamten Buchs erzählt Polak immer wieder von Sunny, der Freundin, die eher Buddy war denn Partnerin. Und jetzt, wieder draußen in der Welt, fragt er sich umso mehr, was sie denn nun ist: Ausweg? Flucht? The real deal?
Er holt sie am selben Tag vom Flughafen ab, an dem er – gerade aus der Klinik entlassen – im Musikvideo seiner Freunde von K.I.Z. ›Ich bin Adolf Hitler‹ den Hitler spielt. Er vergisst allerdings, sich den Schnäuz zu rasieren, den Seitenscheitel zu entfernen und das Kunstblut abzuwaschen. Erst am Gate, als Sunny ihn drauf anspricht, stellt er fest, dass es ein komisches Bild gewesen sein muss für die Passagiere aus New York: »Sie landen in Berlin und das erste, was sie sehen, ist ein blutverschmierter Hitler mit einem ›Welcome home!‹-Ballon.« Oliver Polak wäre nicht Oliver Polak, wenn er nicht noch einen Joke draufsetzte: »Gut, dass Sunny nicht aus Tel Aviv gekommen ist.«
Dass er das Buch beendet, bevor er ihr – voller Nervosität – seine Liebe gestehen kann, beweist, dass Polak nicht nur ein brillanter Comedian, sondern außerdem ein grandioser Geschichtenerzähler ist. Von dem wir alle nur hoffen können, mehr zu hören. Von dem Mann mit dem großen Herzen ganz zu schweigen.
Titelangaben
Oliver Polak: Der jüdische Patient
Köln: Kiepenheuer & Witsch 2014
240 Seiten. 9,99 Euro