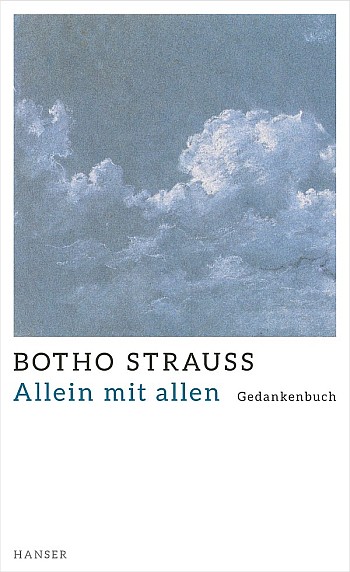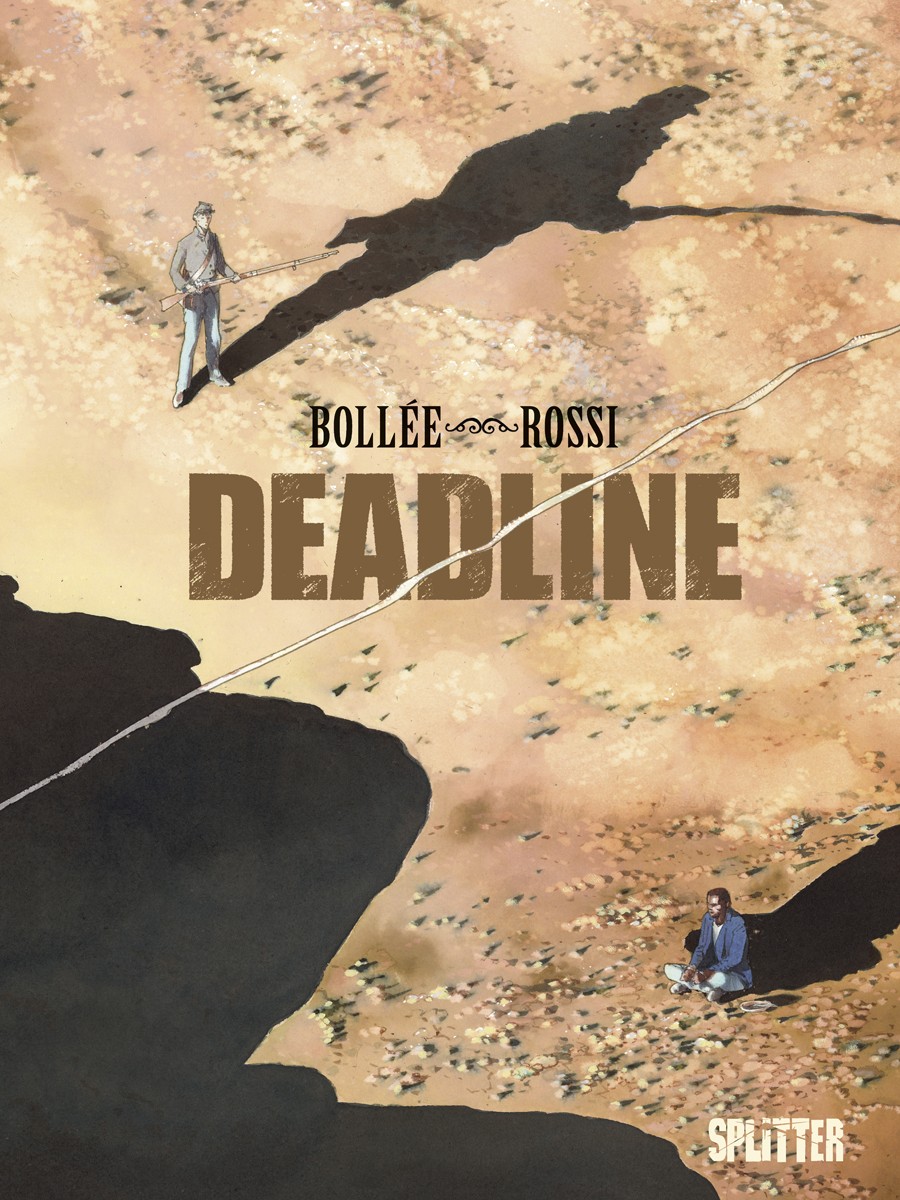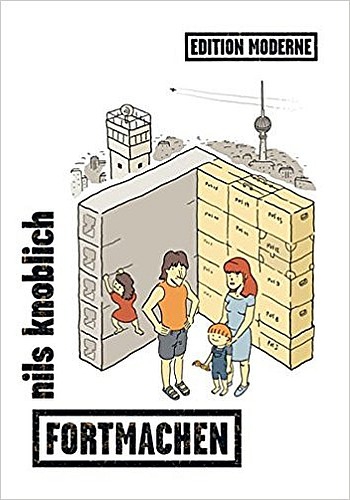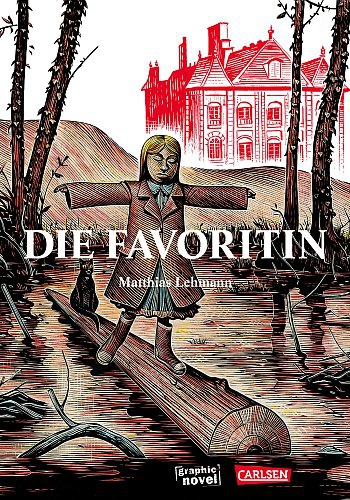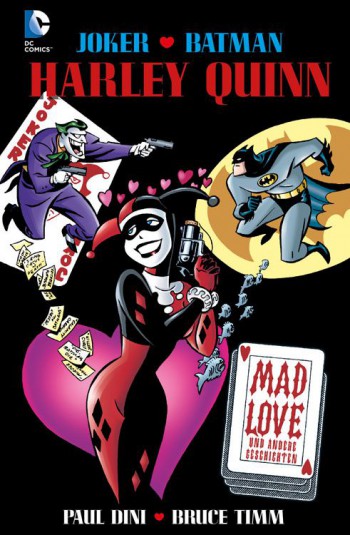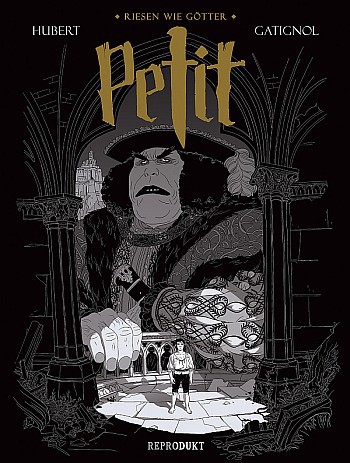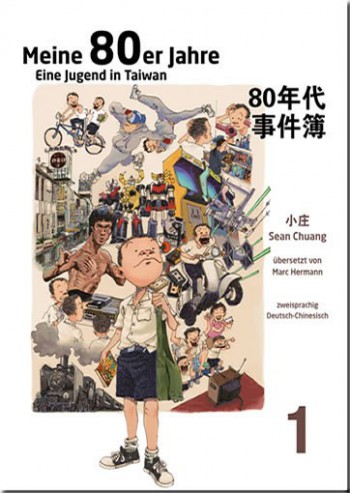Comic | Émile Bravo: Der vergessene Garten
Émile Bravo, einer der führenden aktuellen französischen Comickünstler, lädt den Leser dazu ein, einen Blick in seinen Garten zu werfen. Dabei sollen wir nicht seine bunten Blumenbeete oder stolzen Riesenkürbisse bewundern, sondern eher die faszinierende Schönheit von wildwucherndem Unkraut und bizarren Nachtschattengewächsen entdecken. BORIS KUNZ hat die Einladung angenommen und sich umgesehen.
 Wenn ein Zeichner, der bislang vor allem mit wunderbaren Comics für Kinder auf sich aufmerksam gemacht hat, nun mit einem Werk für ein »explizit erwachsenes Publikum« an den Start geht, erinnert das ein wenig an André Franquins ›Schwarze Gedanken‹, eine Sammlung bösartigster Cartoons mit triefend schwarzem Humor, in dem der depressiv veranlagte Künstler all den Phantasien freien Lauf ließ, die er in Spirou, Gaston oder dem Marsupilami nicht unterbringen konnte. Der Unterschied zwischen den Kurzgeschichten und Cartoons, die in ›Der vergessene Garten‹ untergebracht sind (weiß der Teufel, warum in der deutschen Übersetzung das Adjektiv »vergessen« hinzugefügt wurde) zum bekannteren Werk von Émile Bravo (›Die sieben Zwergbären‹, ›Pauls fantastische Abenteuer‹, ›Spirou‹ ›Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen‹) ist nicht so drastisch. Eines allerdings stimmt: Dieser Garten hat keinen Sandkasten und keine Kinderschaukel.
Wenn ein Zeichner, der bislang vor allem mit wunderbaren Comics für Kinder auf sich aufmerksam gemacht hat, nun mit einem Werk für ein »explizit erwachsenes Publikum« an den Start geht, erinnert das ein wenig an André Franquins ›Schwarze Gedanken‹, eine Sammlung bösartigster Cartoons mit triefend schwarzem Humor, in dem der depressiv veranlagte Künstler all den Phantasien freien Lauf ließ, die er in Spirou, Gaston oder dem Marsupilami nicht unterbringen konnte. Der Unterschied zwischen den Kurzgeschichten und Cartoons, die in ›Der vergessene Garten‹ untergebracht sind (weiß der Teufel, warum in der deutschen Übersetzung das Adjektiv »vergessen« hinzugefügt wurde) zum bekannteren Werk von Émile Bravo (›Die sieben Zwergbären‹, ›Pauls fantastische Abenteuer‹, ›Spirou‹ ›Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen‹) ist nicht so drastisch. Eines allerdings stimmt: Dieser Garten hat keinen Sandkasten und keine Kinderschaukel.
Spielplatz für Erwachsene
Vor allem handelt es sich bei ›Der vergessene Garten‹ nicht um ein zusammengehöriges Werk, sondern um eine überschaubare Sammlung von Kurzgeschichten, Cartoons und Titelbildentwürfen ganz unterschiedlicher Couleur aus den Jahren 2002 bis 2013. Viele davon haben eine eindeutig politische Komponente; da werden Atomkraft, die Selbstmordattentate in Palästina oder der Machtwechsel von George W. Bush zu Barack Obama thematisiert. Anderes ist reiner Slapstick, etwa die Geschichte vom Schiedsrichter, der während eines Fußballspiels immer so ungünstig auf dem Feld steht, dass er jedes entscheidende Tor durch einen dummen Zufall entweder erst ermöglicht oder aber verhindert und dadurch nach und nach den Hass beider Mannschaften auf sich zieht. Oder die kleine Story von dem Chinesen Fu-Yi, der grandios bei dem Versuch scheitert, zwei schwere Kisten aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss zu transportieren.
Die einzige durchgehende Figur ist Familienvater René, dem es partout nicht gelingen will, seiner Familie sonntags statt dem üblichen Burger mit Pommes ein selbstgekochtes Feinschmeckermenü zu kredenzen. In diesen Geschichten, die sich eher um Situationskomik drehen, läuft Bravo zur Hochform auf – während die politischen Satiren zwar durchaus eine gewisse Schärfe besitzen, aber stellenweise auch ein wenig altklug daherkommen.
Meistens kommt Bravo dabei ohne Dialoge aus – und er experimentiert auch damit, wie weit man ohne Text kommen kann. Eine Parabel über die Abwanderung von Industrie in Billiglohnländer nahezu ohne geschriebenen Dialog zu absolvieren, ist schon eine Leistung – wobei Bravo hier allerdings die Sprechblasen der Figuren mit vereinzelten Schlagwörtern und einer Reihe von Piktogrammen füllt, als Comic im Comic sozusagen. Eine anderes, viel überraschenderes Experiment von ihm geht in eine ganz andere Richtung: Da präsentiert er zwei Mal dieselbe Geschichte über einen Konflikt eines Teenagers mit seinem Vater, tauscht in beiden Versionen allerdings den Inhalt der Sprechblasen komplett aus. Während es das erste Mal noch hochgestochen um den gesellschaftlichen Stellenwert von Literatur geht, dreht sich in der zweiten Fassung in derbstem Vokabular alles nur noch um das Eine…
Von Comicfan zu Comicfan
Nicht nur mit diesen formalen Spielereien wendet sich Bravo oftmals an den eingefleischten Comicfan – oder zumindest an ein Publikum, dem die Klassiker frankobelgischer Comicliteratur ein Begriff sind. Reflexionen über Comics sind das dritte große Thema bei ihm. So zeigt er uns, was aus Gaston geworden ist, nachdem er seinen Job als Bürobote endlich hingeschmissen und sich selbstständig gemacht hat, oder präsentiert eine besonders verstörende Version von Blake und Mortimer als Lagerarzt und KZ-Aufseher. Dann gibt es noch ein paar sehr autobiografisch geprägte Strips, in denen es um Freud und Leid des Comiczeichners geht, sowie ein paar eigenwillige, oftmals auch abgelehnte Plakatentwürfe für Comicveranstaltungen.
Auch die Gestaltung des Artworks fällt recht unterschiedlich aus, mal schwarz weiß, mal in Graustufen, mal in knallbunten Farben, mal feingliedrig, mal grob – doch letztendlich bleibt Bravos Strich immer erkennbar. Hier zeigt er sich als souveräner Comickünstler, der seine Handschrift – eine moderne, lebendige Variante des französischen Funny-Stils – perfekt beherrscht, sie zu gewissen Graden zu variieren versteht, letztlich aber immer dem Schwung des eigenen Handgelenks treu bleibt. Seine Vorbilder sind dabei deutlich zu spüren, und so wirken seine Comics dann auch bei allen modernen Erzählansätzen, gewagten Jokes und zeitgenössischen Themen auf eine gewisse Weise »old fashioned« und erinnern an die Glanzzeit des französischen Comic.
Alles in allem macht das Album einen zwar überwiegend positiven, gleichzeitig aber auch durchwachsenen Eindruck. Manchmal bringt einen der Humor zum Lachen, manchmal wirkt er sehr irritierend, manchmal regen seine Botschaften zum Nachdenken an, manchmal zum Schulterzucken, manchmal geht seine Bosheit unter die Haut, manchmal sieht man die Pointen schon kommen. Jeder Leser wird je nach Geschmack mit dem einen mehr und dem anderen weniger anfangen können. Ein stimmiges Gesamtkonzept geht dem Album allerdings ab, aber immerhin überrascht Bravo durch Experimentierfreude und Vielseitigkeit. Man weiß nie so recht, womit er als nächstes um die Ecke kommt.
Titelangaben
Émile Bravo: Der vergessene Garten von Émile Bravo (Le Jardin d`Émlie Bravo)
Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock
Berlin: Reprodukt, 2014
80 Seiten, 24 Euro
Reinschauen
| Émile Bravo bei Carlsen
| Émile Bravo bei Lambiek