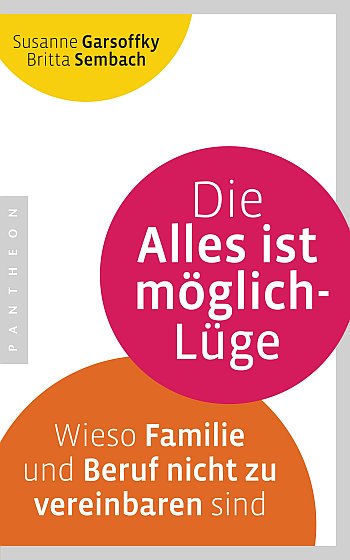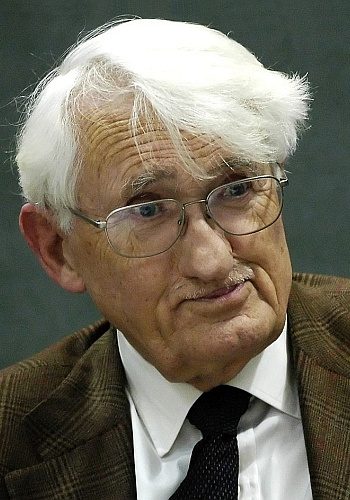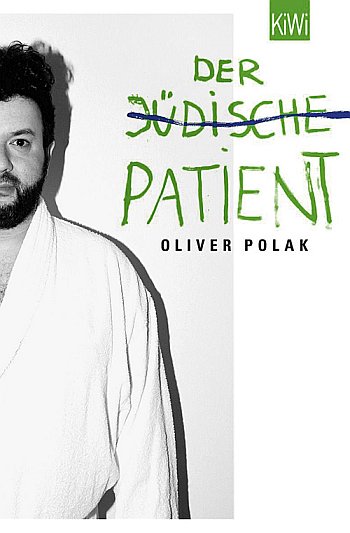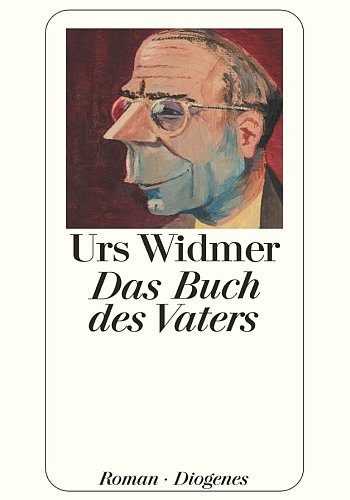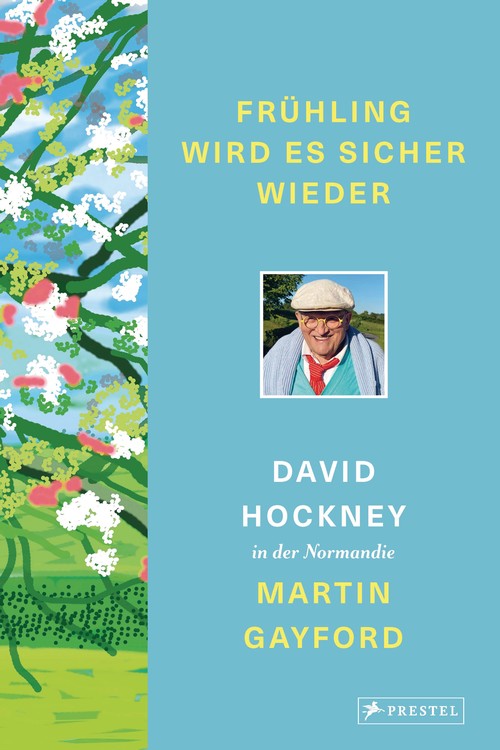Menschen | Susanne Kippenberger: Das rote Schaf der Familie
In England waren sie in den 1920er und frühen 1930er Jahren das, was heute It-Girls sind: Die Mitford-Schwestern. Bei uns hat man eventuell Romane von Nancy gelesen oder mal gehört von dieser anderen mit dem komischen Namen Unity und dem Faible für Hitler. Aber Jessica? Dabei nennt Joanne K. Rowling sie ihr großes Vorbild. An ihrem Sterbebett saß Maya Angelou, die schwarze Dichterin, die Clintons Inauguration besingen durfte, und nach ihrem Tod 1996 gab es gleich zwei Trauerfeiern, eine britische und eine US-amerikanische. Seit 2013 kann man endlich etwas von ihr selbst auf Deutsch lesen, ›Hunnen und Rebellen‹ (Berenberg-Verlag, übersetzt von Joachim Kalka), und jetzt ist Susanne Kippenbergers pralle biographische Erzählung ›Das rote Schaf der Familie. Jessica Mitford und ihre Schwestern‹ erschienen. Wird Zeit, sie kennenzulernen! Von PIEKE BIERMANN
 Sechs Schwestern und ein Bruder aus feinsten Kreisen, und die sind so fein, dass die Gören nicht mal zur Schule müssen, also ihre geschwisterlichen Dynamiken ungestört von anderen Kindern austoben können – das allein ist narrativ reizvoll. Britischer Hochadel, landsitz- und empiregestützt, mit Lizenz zu Exzentrik. Wenn diese Siebenerbande noch in eine Epoche hineingeboren wird, in der zwei bis zum Exzess getriebene Extremismen die alte Weltordnung zerschmettern, und wenn sie dann auch noch in ihren Lebensentscheidungen buchstäblich alles exaltiert, was das 20. Jahrhundert an »Rollen« und Zuordnungen zu bieten hat, dann schreit das geradezu nach Erzähltwerden.
Sechs Schwestern und ein Bruder aus feinsten Kreisen, und die sind so fein, dass die Gören nicht mal zur Schule müssen, also ihre geschwisterlichen Dynamiken ungestört von anderen Kindern austoben können – das allein ist narrativ reizvoll. Britischer Hochadel, landsitz- und empiregestützt, mit Lizenz zu Exzentrik. Wenn diese Siebenerbande noch in eine Epoche hineingeboren wird, in der zwei bis zum Exzess getriebene Extremismen die alte Weltordnung zerschmettern, und wenn sie dann auch noch in ihren Lebensentscheidungen buchstäblich alles exaltiert, was das 20. Jahrhundert an »Rollen« und Zuordnungen zu bieten hat, dann schreit das geradezu nach Erzähltwerden.
Genau das trifft zu für die Mitford-Kinder, geboren zwischen 1904 und 1920. In den Jahren zwischen den Weltkriegen waren vor allem die Mädchen eine veritable Skandalnudelfabrik und so notorisch in angelsächsischen Klatschspalten, dass man stutzt: Und deren Geschichte wird erst jetzt erzählt? Und ausgerechnet auf Deutsch? Denn hierzulande sind die Mitford-Schwestern nicht ganz zufällig kaum bekannt. Aber wahrscheinlich braucht es einfach eine Erzählerin wie Susanne Kippenberger. Sie ist Journalistin wie ihre erklärte Lieblings-Mitford Jessica, sie kommt selbst aus einer ähnlichen »Familienaufstellung«, und sie hat derart turbulenten Stoff schon ein Mal glänzend bewältigt, mit der Biographie ihres genialen, skandalaffinen Maler-Bruders Martin Kippenberger.
Which side are you on?
Nancy, Pamela, Thomas, Diana, Unity, Jessica und Deborah Mitford also, Kinder von Lord und Lady Redesdale: Nancy wird Bestsellerautorin spitzzüngiger Gesellschaftsromane, die auch auf Deutsch erscheinen, zumeist von Reinhard Kaiser übersetzt, und lebt später in Frankreich in Résistance- und Literaten-Kreisen. Pamela wird Heimchen an einem ruhigen goldenen Herd; Thomas fällt 1941 in Burma; Diana lässt 1932 ihren Gatten sausen – immerhin der Brauerei-Erbe Brian Guinness –, weil sie Oswald Mosley, den »Führer« der britischen Faschisten, einfach sexier findet und heiraten möchte; Unity zieht nach München, schmeißt sich an den »echten Führer« ran – und zwar so, dass ihr Vater öffentlich dementieren muss, seine Tochter sei mit »Herrn Hitler« verlobt – und schießt sich 1939, als England Hitler den Krieg erklärt, eine Kugel in den Kopf. Nur Deborah, die Jüngste, überlebt das irre Jahrhundert um vierzehn Jahre als geschäftstüchtige Duchess of Devonshire.
Jessica, die Zweitjüngste, haut minderjährig mitsamt ihrem Geliebten und Cousin ab in den Spanischen Bürgerkrieg und wandert 1939 in die USA aus, die manche Verwandten für noch dégoutanter halten als das Land der Hunnen. Die antifaschistische Republikanerin wird Mitglied der amerikanischen kommunistischen Partei, Bürgerrechtsaktivistin und Journalistin, das »rote Schaf« eben.
Milieus und Zeitgeist
In der Tat zwei Welten und zwei Leben, beide gespickt mit Irrwitz und Turbulenzen, die man nur zum Teil unter »Kein Wunder bei der Familie!« verbuchen kann. Der Löwenanteil gebührt der rebellisch-sturen, verrückten Jessica Mitford selbst, sie ist völlig zurecht die faszinierendste der Schwestern für ihre Erzählerin.
Susanne Kippenberger hat wirklich ein Kunststück vollbracht. Sie hält gleichzeitig ein zweistelliges Personenkarussell – Schwestern plus Liebhaber und Männer, Kinder und Enkel, Freunde und Kontakte, historische Figuren – in elegant schwingenden Bahnen, und sie kann Zeitgeist lebendig werden lassen. Mit Jessica, zum Beispiel, lebt man mitten im multiethnischen proletarischen Oakland der 50er/60er Jahre, zwischen schwarzer Bürgerrechtsbewegung, red diaper kids und antikommunistischem Gesinnungsterror. Die Milieus und Mentalitäten dort sind so detailfreudig geschildert wie die Gepflogenheiten der britischen jeunesse dorée zwischen den beiden Weltkriegen oder die Requisiten, die Deborah hin und wieder verhökern muss, um das Schloss zu halten – die Holbeins und Rubens‘ und Rembrandts, zum Beispiel, oder mal ein Skizzenbuch von van Dyck.
Das alles ist wunderbar leichtfüßig erzählt, warmherzig, aber ohne Anbiederung. Richtig tolles, erbauliches Lesefutter. Man wünscht ihm auch angelsächsische Leser zuhauf, möglichst bald, und vermisst eigentlich nur eins: ein Personenregister.
Eine erste Version der Rezension wurde am 16. Dezember 2014 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht, ein Gespräch mit Pieke Biermann ist als Audio on Demand verfügbar.
Titelangaben
Susanne Kippenberger: Das rote Schaf der Familie
Jessica Mitford und ihre Schwestern
Berlin: Hanser 2014
595 Seiten, 26 Euro
Reinschauen
| Leseprobe