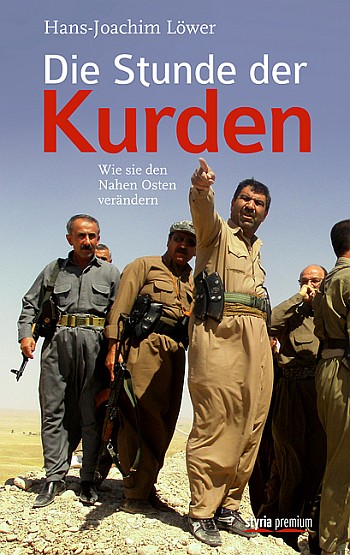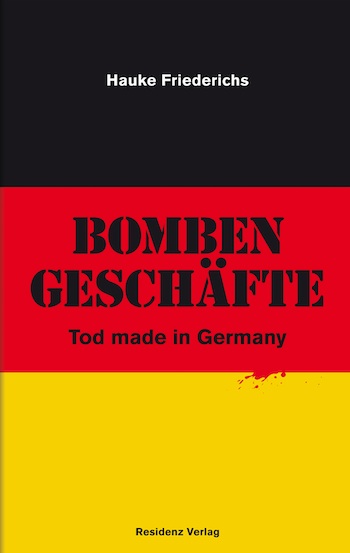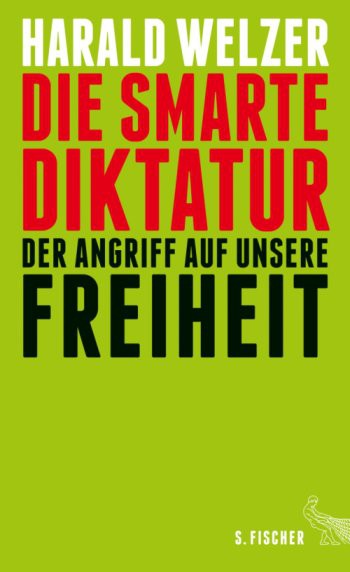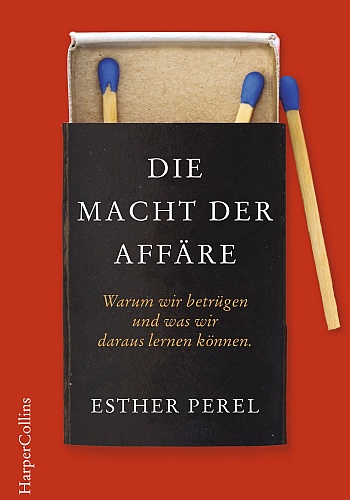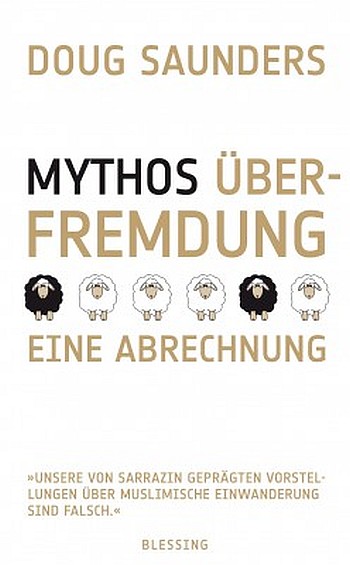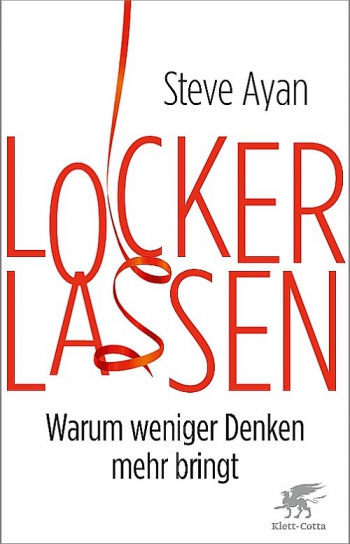Gesellschaft | David Harvey: Siebzehn Widersprüche und das Ende des Kapitalismus
Verglichen mit der Fülle kapitalismuskritischer Arbeiten, die in den letzten Jahren erschienen und an dieser Stelle regelmäßig rezensiert wurden – Naomi Klein, Thilo Bode, Joseph Vogl, Jean Ziegler u.a.m. –, arbeitet David Harvey unkonventionell, er richtet seinen Blick auf das Kapital, die Perspektive von Klassenkämpfen ist für ihn gleich Null, die radikale Linke sei »heute weitgehend marginalisiert«. Von WOLF SENFF
 Er unterscheidet, wie im Titel angekündigt, siebzehn Widersprüche: ›Grundwidersprüche‹, ›bewegliche‹ sowie ›gefährliche‹ Widersprüche. Das hört sich dogmatisch an, Harvey geht aber in seiner scheinbar naiven, konsequenten Argumentation über marxistische Denkmuster hinaus, etwa indem er »Gebrauchswert« überzeugend definiert und sich folgerichtig gegen die Privatisierung von und für den Gebrauch von grundlegenden Bereichen wie Wohnungsbau, Bildungssystem und Gesundheitswesen ausspricht. Einfachheit des Denkens führt ihn zu unmissverständlichen Ergebnissen, die an Klarheit keine Wünsche offen lassen.
Er unterscheidet, wie im Titel angekündigt, siebzehn Widersprüche: ›Grundwidersprüche‹, ›bewegliche‹ sowie ›gefährliche‹ Widersprüche. Das hört sich dogmatisch an, Harvey geht aber in seiner scheinbar naiven, konsequenten Argumentation über marxistische Denkmuster hinaus, etwa indem er »Gebrauchswert« überzeugend definiert und sich folgerichtig gegen die Privatisierung von und für den Gebrauch von grundlegenden Bereichen wie Wohnungsbau, Bildungssystem und Gesundheitswesen ausspricht. Einfachheit des Denkens führt ihn zu unmissverständlichen Ergebnissen, die an Klarheit keine Wünsche offen lassen.
Zur Grundbefindlichkeit
Seine Auflistung von siebzehn Widersprüchen mag auf den ersten Blick ebenfalls schematisch und holprig wirken, aber sie läuft im Ergebnis auf eine facettenreiche, vielschichtige Untersuchung hinaus. Er verweist auf Interessengegensätze zwischen einzelnen Fraktionen des Kapitals sowie generell auf dessen »gleichzeitig schöpferische und destruktive Kraft«.
Die Taylorisierung suchte einst »die Produktionsprozesse so weit zu zerlegen, dass ein ›dressierter Gorilla‹ in der Lage wäre, die einzelnen Aufgaben zu übernehmen«; zwar habe sich die internationale Arbeitsteilung während der vergangenen fünfzig Jahre beträchtlich verändert und sei global durchaus funktional organisiert, doch die Grundbefindlichkeit des Menschen »unter Herrschaft des Kapitals« sei »leer und sinnlos«, er produziere für eine »lebensfeindliche, sinnentleerte Welt«, neoliberale Politik habe sich auch in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten »verheerend« ausgewirkt.
Unbeständig und chaotisch
Harvey Beschreibung der Gegenwart ist schonungslos, er sieht das Kapital, das sich die geographischen Räume nach seinen Bedürfnissen gestaltet, in einem beständigen Prozess der Wanderung über den Planeten, bedingt durch neue Technologien (Verlagerung vom industriellen Zentrum Detroit nach IT-Silicon Valley), durch billige Arbeitskraftressourcen u.a.m. Oft hinterlässt es Verwüstung und Wertverfall, und es herrscht eine »ungleiche geographische Entwicklung«, die auch durch eine eher kontroverse Logik staatlichen Handelns wenig beeinträchtigt werde.
Harvey konstatiert eine »unheilige Allianz zwischen Staatsmacht und Finanzkapital«. Hedgefonds und private Aktienfonds seien auf Zerstörung und Vernichtung angewiesen, selbst wenn es um die Lebensgrundlagen ganzer Völker gehe. Harvey verortet uns »in einer chaotischen und unbeständigen Zeit« und erklärt uns auf wunderschön kaltblütige Weise, weshalb die Verteilung von Einkommen und Vermögen nicht gleichgewichtig sein könne und weshalb die Einkommensschere sich weiter öffne.
Nein, sie ändern nichts
»Das Kapital hat mittlerweile auf dem Gebiet des technologischen Wandels und der Globalisierung eine rücksichtslose Dynamik entfaltet, der es gleichgültig ist, unter welchen Bedingungen und ob überhaupt noch produziert wird.« Wenn aber kein gesellschaftlicher Wert mehr produziert werde, führe das in eine katastrophale Krise.
Es ist deprimierend, aber zweifellos politisch gewollt, dass wir durch die hiesigen Medien nur begrenzt über die politischen Realitäten informiert werden, und es ist für einen normalen Menschenverstand unfassbar, dass trotz der harschen Kritik an den herrschenden Zuständen nichts, aber auch gar nichts verändert wird.
Autonomieverlust
Bei Harvey lesen wir von breiten Sympathien in den USA für eine politische Bewegung, die sich gerechtere Verhältnisse auf die Fahnen schreibe, ebenso für Arbeiterinitiativen und solidarisches Wirtschaften. Mit den realen Veränderungen scheint es ähnlich zu sein, irgendwo wird mit allen verfügbaren Methoden gemauert.
Einen weiteren kaum lösbaren Widerspruch sieht David Harvey in der Kolonisierung des alltäglichen Lebens, des Bereichs der gesellschaftlichen Reproduktion. Er beschreibt einen Verfall des Alltags und einen Verlust an individueller Autonomie unter dem Einfluss von Kapital und kapitalistischem Staat. Die »Finanzialisierung« des Alltags verlange etwa beim Thema Alkohol und Drogen staatliche Interventionen, deren Bürokratisierungszwänge wiederum den Autonomieverlust steigern.
Von Freiheit und von Herrschaft
Eine von den realen Problemen ablenkende »Freiheitsrhetorik« diene der Durchsetzung machtpolitischer oder wirtschaftlicher Ziele, sie sei eine »Maske für Heuchler wie Bush« und diene Zielen wie Profit, Enteignung und Herrschaft. »Freiheit« sei das ursprüngliche Konzept der klassischen liberalen Nationalökonomie, verbunden mit Adam Smith und Friedrich Hayek, und wesentlich durch freie Unternehmerschaft und Privateigentum definiert.
Harvey spottet über diese bürgerliche Freiheit, die so frei sei, in Not und Elend zu helfen, indem wohltätige »Investmentmanager, Unternehmensführer und Staatschefs […] mit der rechten Hand nach der Lösung für Probleme [suchten], die sie mit der linken geschaffen hatten«, und zitiert zu dieser »Gewissenswäsche« ausführlich Peter Buffett, den Sohn des berüchtigten Großinvestors Warren Buffett – bürgerliche Freiheit und bürgerliche Herrschaft würden einander bedingen. Wie jedoch ein freier, ein von Entfremdung befreiter Mensch einst leben werde, das lasse sich heute nicht voraussagen. Der Weg dorthin sei kein determinierter Prozess, er »ist nicht vorherbestimmt, sondern hängt von uns selbst ab«.
Interne Widersprüche beim Kapital
Den ersten seiner »gefährlichen Widersprüche« sieht Harvey im Zwang zu exponentiellem Wachstum, das aufgrund in vielerlei Hinsicht endlicher Ressourcen gar nicht realisierbar sei. Bereits die Deindustrialisierung und das Verlagern profitabler Sektoren auf das Finanzkapital hätten dazu geführt, dass »parasitäre Formen des Kapitals« zunähmen, »Bond-Inhaber und Notenbanker beherrschen die Welt«, und »diese unproduktive Klasse werde das Industriekapital so lange auspressen, dass es nicht mehr produktiv arbeiten könne«.
Er hält das Kapital für in sich hinreichend flexibel, um bis auf Weiteres einer Gefährdung natürlicher Grundlagen zu begegnen. Weit gefährlicher könne sich auch hier auswirken, dass eine unproduktive Klasse von Grundbesitzern ihr Interesse darin sehe, die Erträge abzuschöpfen.
Grundlegender noch sei die Tatsache einzuschätzen, dass das Kapital alle Aspekte der Natur vereinnahme und der »Logik der Kommerzialisierung« unterwerfe; es finde eine »Vergewaltigung der Natur durch die Warenform« statt, das Kapital zerstöre damit ebenfalls »die gesittete und vernünftige Natur des Menschen«. Darin sieht er die »Saat für eine humanistische Revolte«.
Von Eliten und ihren Politikdarstellern
André Gorz folgend, plädiert er dafür, sich von fremdbestimmtem Konsumverhalten zu lösen und sich im Alltag von entfremdeten Bedingungen zu emanzipieren. Eine »progressive antikapitalistische Antwort auf die Widersprüche unserer Zeit« liege in einem revolutionären Humanismus und dem Verlangen nach einer Welt, die dem Einzelnen »die wahre Entfaltung seiner Natur oder die Chance auf ein glückliches und erfülltes Leben garantiert«, und er ruft mit Frantz Fanon die Menschen dieser Erde dazu auf, ihren »verantwortungslosen Dornröschenschlaf« aufzugeben.
Was gibt es da hinzuzufügen. Er hat recht, und man kann sich immer nur fragen, wie viel es noch braucht an Steigerung des Elends, an Völkerwanderung auf dem Planeten, an Zerstörung, an ›failed states‹, damit die herrschenden »Eliten« und ihre Politikdarsteller endlich ein Hauch von Ahnung streift, Ahnung dessen, was sich real ereignet.
Titelangaben
David Harvey: Siebzehn Widersprüche und das Ende des Kapitalismus
(Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, übers. von Hainer Cober)
Berlin: Ullstein 2015
384 Seiten. 22 Euro