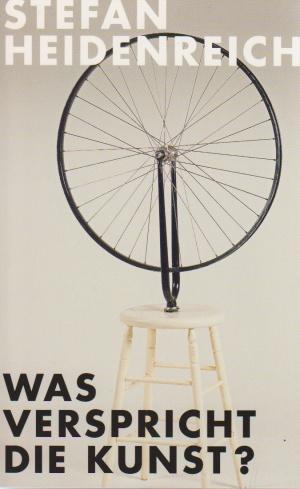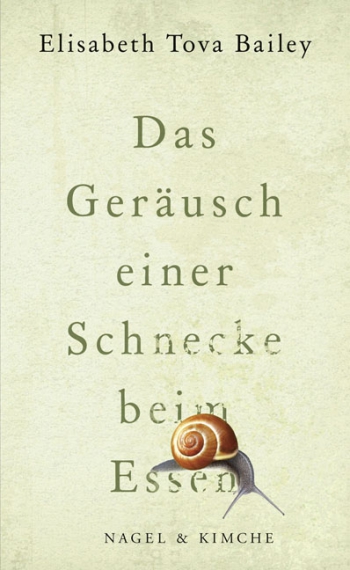Kulturbuch | Hans-Joachim Löwer: Die Stunde der Kurden
In den letzten hundert Jahren sind etliche Völker und Religionsgemeinschaften im Nahen Osten unter die Räder gekommen. Viele von ihnen fristen seit Jahrzehnten ein Leben von Ausgrenzung und Verfolgung, einige wie die christlichen Minderheiten Syriens und des Iraks sind erst in jüngster Zeit wieder zwischen die Fronten geraten. Ein lange bekämpftes und unterdrücktes Volk, das es anscheinend geschafft hat, dem Zirkel der Gewalt zu entrinnen, stellt der Reisejournalist Hans-Joachim Löwer in ›Die Stunde der Kurden‹ vor. Von PETER BLASTENBREI
 Die Kurden waren vielleicht niemals so sehr im europäischen Bewusstsein wie gerade jetzt. Die monatelange und schließlich siegreiche Verteidigung der Kleinstadt Kobanê an der syrisch-türkischen Grenze gegen IS-Kämpfer haben dem lange vergessenen Volk auf tragische Weise zu Aufmerksamkeit und Anteilnahme im Westen verholfen. Bis dahin hatte man hierzulande wohl allenfalls vom irakischen Kurdistan gehört, das 1988 Schauplatz eines der schlimmsten Verbrechen Saddam Husseins, des Giftgasangriffs auf Halabdscha, geworden war und das nach 2003 mit US-Hilfe den Status einer autonomen Region innerhalb des Irak erreichte.
Die Kurden waren vielleicht niemals so sehr im europäischen Bewusstsein wie gerade jetzt. Die monatelange und schließlich siegreiche Verteidigung der Kleinstadt Kobanê an der syrisch-türkischen Grenze gegen IS-Kämpfer haben dem lange vergessenen Volk auf tragische Weise zu Aufmerksamkeit und Anteilnahme im Westen verholfen. Bis dahin hatte man hierzulande wohl allenfalls vom irakischen Kurdistan gehört, das 1988 Schauplatz eines der schlimmsten Verbrechen Saddam Husseins, des Giftgasangriffs auf Halabdscha, geworden war und das nach 2003 mit US-Hilfe den Status einer autonomen Region innerhalb des Irak erreichte.
Eben diesen Teil Kurdistans, die autonome Region im Nord-Irak, hat der Autor 2014 besucht. Das Buch, das dabei entstanden ist, gliedert sich thematisch in 20 Kurzkapitel von meist nur wenigen Seiten, gruppiert um Löwers jeweilige Interviewpartner. Zwei erfolgreiche Unternehmer sind darunter, der Parlamentspräsident, der Gouverneur von Kirkuk, ein Wissenschaftler, ein verkrüppelter Minenräumer, eine Generaldirektorin im Innenministerium, der Leiter einer Militärschule, das geistliche Oberhaupt der Jesiden und ein chaldäischer Bischof, Offiziere, Flüchtlinge, Museumsführer und andere mehr.
Offene Fragen
Die einzelnen Interviews, deren Informationswert naturgemäß stark schwankt, werden sparsam ergänzt durch Zahlen und Hintergrundmaterial. Sie liefern insgesamt ein buntes, aber keineswegs umfassendes oder auch nur innerlich konsistentes Bild vom irakischen Teil Kurdistans.
Unser Autor ist schnell zu begeistern und kommt angesichts der Wunder des neuen Kurdistan aus dem Staunen nicht heraus. Dass damit seine eigenen Aussagen von denen seiner jeweiligen Gesprächspartner abhängen, liegt auf der Hand. Schlimmer noch, das ganze Projekt Autonomes Kurdistan hat Löwer derartig fasziniert, dass er vergessen hat, weiter nachzufragen. Oder er hielt es für unhöflich, Fragen zu stellen, die sich doch eigentlich von selbst aus dem Wortlaut der Interviews ergeben.
Ein paar Kostproben können nicht schaden:
Die meisten befragten Kurden und Kurdinnen sehen die Autonomie als Vorstufe für die Unabhängigkeit Kurdistans – und wissen doch, dass die Schutzmacht USA genau das nicht will, von der Regierung in Bagdad ganz zu schweigen.
Sulaimaniah und Erbil sind in wenigen Jahren zu Millionenstädten herangewachsen, etwa 50 Prozent der Kurden lebt heute hier. Was heißt das für die Menschen? Wo liegen die Gründe für die massive Landflucht und was werden die Folgen sein?
Die Bewohner der alten Zitadelle von Erbil wurden vom umtriebigen Bürgermeister an den Stadtrand umgesiedelt, um eine gründliche Modernisierung und Sanierung zu erlauben. Wie leben sie dort? Werden sie zurückkommen können?
Illustre Gesprächspartner
Die auffallend geachtete Stellung der Frauen bei den Kurden ist Lexikonwissen. Doch was ist heute davon noch übrig, wenn pro Monat viele Hundert Anzeigen über Misshandlungen, darunter Vergewaltigungen und Verbrennungen, bei der dafür eingerichteten Regierungsstelle eingehen (S.96)?
Kurdistan ist wirtschaftlich fast komplett von Öl und Gas abhängig. Unter welchen Bedingungen werden sie gefördert und von welchen Firmen? Wie viel Geld davon bleibt in Kurdistan? Was wird mit der Ölstadt Kirkuk geschehen, wenn einmal die unmittelbare Bedrohung durch die IS endet? Denn Kirkuk gehört zum Irak, wird aber schon lange von den Kurden beansprucht und wurde 2014 besetzt.
Hier rächt sich auch, dass Löwer mit Ausnahme von Flüchtlingen, die ihm Untaten der IS schilderten, nur mit Offiziellen gesprochen hat, mit Beamten, Offizieren, hohen Geistlichen und Unternehmern und nie mit Handwerkern, Arbeitern, Bauern, Händlern, gewöhnlichen Menschen eben. So liegt über dem gesamten Buch ein wenig von der Patina offiziell organisierter Touren in einer der verblichenen osteuropäischen Volksdemokratien.
Gute Kurden, böse Kurden
Löwer macht seine Gesprächspartner, das Volk und das politische und wirtschaftliche System, das sie repräsentieren, zu leuchtenden Vorbildern für den gesamten Nahen Osten. Insbesondere Arabern und Muslimen zeigt er seine ganze Geringschätzung, ja, Verachtung: Sie müssten von den Kurden lernen, sich »erfolgreich zu modernisieren«. So zum Beispiel wie einer von Löwers Gesprächspartnern, der, obwohl gleichfalls Muslim (wie fast alle Kurden), sich nicht mit dem Koran »in Zucht nimmt«, sondern mit täglich zwei Stunden Fitnesstraining, bevor er den Abend bei einem Glas Whisky im Sheraton-Hotel ausklingen lässt (S.55). Nein, das ist keine Satire.
Wer das unter Moderne versteht und wem nicht einmal auffällt, dass er soeben mit einem vielfachen Millionär gesprochen hat, identifiziert leicht die nordirakischen Kurden auch im politischen Sinn als UNSERE Kurden, als DIE Verbündeten des Westens in der Region. Den PKK-Führer Öcalan, eindeutig ein böser Kurde, erwähnt Löwer dementsprechend nur ein einziges Mal – als »faschistoide Kultfigur« (S.77). Das hat nun wirklich überhaupt nichts mehr mit einer überaus komplexen Realität zu tun, in der der zweite Mann Kurdistans und frühere irakische Präsident Dschelal Talebani, der türkische Staatspräsident Erdoğan und die PKK um ein prekäres Gleichgewicht im Angesicht der IS ringen.
Das autonome Kurdistan ist keine Insel der Seligen und die tapferen Menschen, die dort leben, sind keine Übermenschen, auch wenn sie zu Recht stolz sind auf das, was sie sich geschaffen haben. Doch die Stunde der IS wird vorübergehen und dann wird sich zeigen müssen, welche Freunde zuverlässig sind, welche Probleme man sich mit einer überstürzten Entwicklung ins Haus geholt hat und wie lange sich zum Beispiel unbegrenzter Kapitaltransfer wirtschaftlich und sozial durchhalten lässt.
Konjunkturinduzierte Begeisterung ohne Problembewusstsein und ohne solide Sach- und Sprachkenntnis hilft da nicht weiter.
Titelangaben
Hans-Joachim Löwer: Die Stunde der Kurden.
Wie sie den Nahen Osten verändern
Graz: Styria 2015
208 Seiten, 24,99 Euro