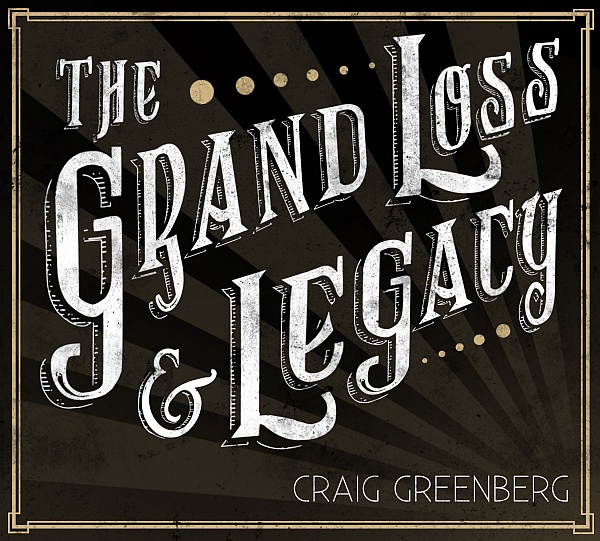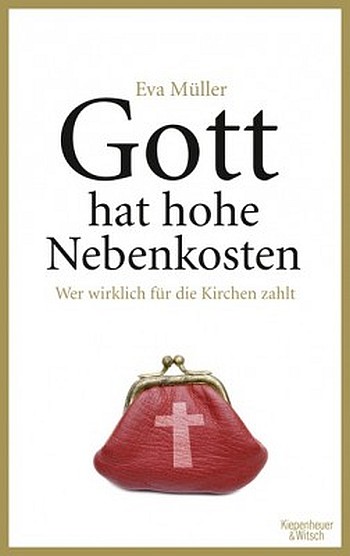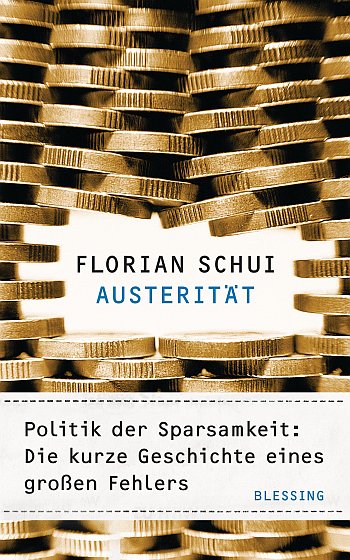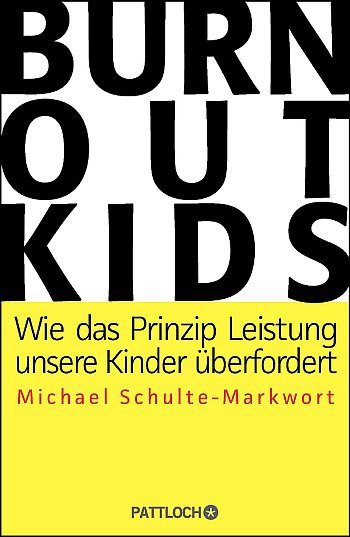Gesellschaft | Tyma Kraitt (Hg.): Irak. Ein Staat zerfällt
Der Irak kommt seit über dreißig Jahren nicht aus den Schlagzeilen heraus. Und weil es eben die Schlagzeilen westlicher Medien sind, wird da fast ausschließlich über Blut und Tränen, Krieg, Terror und Massaker berichtet, kaum je über historisch-politische Fluchtlinien, Hintergründe oder wirtschaftliche und soziale Strukturen. Der von Tyma Kraitt (Österreichisch-Arabische Gesellschaft) herausgegebene Band Irak. Ein Staat zerfällt will dem abhelfen. Von PETER BLASTENBREI
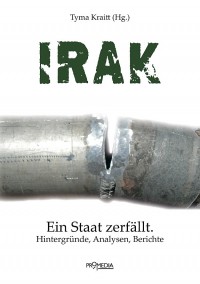 Der Band wird eingeleitet von zwei Übersichtsartikeln, zur Geschichte des Landes seit seiner Entstehung 1918/1921 von der Herausgeberin und zu den Nationalitäten und Religionen im Irak von Liselotte Abid. Beide liefern in der Art von Lexikonartikeln ohne hohe Ansprüche notwendige Grundinformation. Das gelingt gut mit Ausnahme einiger Passagen bei Frau Abid, wo die vielfältigen religiösen Splittergruppen doch arg durcheinandergeraten.
Der Band wird eingeleitet von zwei Übersichtsartikeln, zur Geschichte des Landes seit seiner Entstehung 1918/1921 von der Herausgeberin und zu den Nationalitäten und Religionen im Irak von Liselotte Abid. Beide liefern in der Art von Lexikonartikeln ohne hohe Ansprüche notwendige Grundinformation. Das gelingt gut mit Ausnahme einiger Passagen bei Frau Abid, wo die vielfältigen religiösen Splittergruppen doch arg durcheinandergeraten.
Seit einigen Jahren geistern immer wieder politische Diskurse über das sogenannte »Scheitern von Staaten« durch die Kommentarspalten. Der Kontext legt dabei oft genug den Verdacht nahe, dass es sich, wie bei Huntingdons clash of cultures und Fukuyamas ›Ende der Geschichte‹, um eine sehr zweckgeleitete Form von Wissenschaft handelt. Auch der Irak wurde zwischenzeitlich zum »gescheiterten Staat« erklärt – nur, hier hat eindeutig jemand daran gedreht.
Ein Staat wird gescheitert
Das begann bereits mit den UN-Sanktionen ab 1991 gegen das Land. Hans-Christof von Sponeck, bis 2000 Leiter des Irak-Hilfsprogramms »Öl für Lebensmittel«, stellt dieses härteste Sanktionsregime aller Zeiten (13 Jahre in Kraft!) aus erster Hand dar. Die USA und Großbritannien manipulierten die Weltorganisation für den von ihnen geplanten Regimewechsel ohne Rücksicht auf die Menschen im Irak und schreckten dabei nicht einmal vor dem Stopp von Hilfsgütern für Hungernde zurück.
Der Irak war daher bereits 2003 ein wirtschaftlich ruiniertes und sozial aus den Fugen geratenes Land. Joachim Guilliard beschreibt das radikal neoliberale Regime, das regierungsnahe US-Großkonzerne wie Halliburton oder Bechtel entworfen hatten und das die Besatzungsmächte dem Land überstülpten. Mit dem kompletten Austausch von Armee, Polizei und Verwaltung und der Entlassung von 500.000 Mitarbeitern der Staatsbetriebe erreichten die USA ihr Nahziel eines ohnmächtigen Zentralstaats. Angehörige der unter Saddam Husain bevorzugten sunnitischen Minderheit waren (und sind) jetzt die bösen Iraker, gegen die Besatzer und einheimische Gegner mit allen, auch terroristischen Mitteln vorgehen.
Opfer und Opportunisten
1959, das Jahr nach dem Sturz der Monarchie, war im Irak ein frauenpolitisches Stichjahr. Mit Dr. Naziha al-Dulaimi bekam das Land seine erste Ministerin (zwei Jahre vor der Bundesrepublik!) und mit dem von ihr mit erarbeiteten Gesetz Nr.188 ein bis heute gültiges fortschrittliches Personenstandsrecht. Myassa Kraitt sieht die starke Stellung der irakischen Frauen in dieser neuen Rechtslage und in der seit den 1970er Jahren erheblich verbesserten Frauenbildung (1990 nur noch 12 Prozent Analphabetinnen). Seit 2003 machen die herrschenden konservativ-klerikalen Kräfte massiv dagegen Front, und es steht zu befürchten, dass hier bald eine der letzten säkularen Bastionen fallen könnte.
Zu den vielleicht interessantesten Artikeln des Bandes gehört wegen der ungewöhnlich weiten Perspektive der von Reza Nourbakhch-Sabet über die Marschland-Araber. Von Saddam Husain nach dem Aufstand 1991 bis auf Reste vertrieben, wurde ihre Heimat, die südirakischen Marschen, durch Trockenlegung zerstört (»Ökozid«). Von der Frage einer partiellen Renaturierung lenkt der Autor den Blick auf die allgemeine, sich rasch verschärfende Wasserfrage im gesamten Irak. Ursachen dafür sind in den neuen türkischen Tigrisdämmen zu suchen, in Staudamm-Manipulationen der IS, aber auch im Klimawandel.
Auf den ersten Blick sind die irakischen Kurden zu Nutznießern der Zerschlagung des irakischen Zentralstaats geworden. Niemand verfolgt sie mehr, sie können ihr Land selbst aufbauen. Erkauft ist das aber mit einer unkontrollierten neoliberalen Öffnung, klientelarer Verknöcherung der Politik entlang der traditionellen Parteien DPK und PUK, schweren sozialen Spannungen und wachsender Repression im Inneren (Nikolaus Brauns). Die Türkei, lange Zeit nur als Unterdrückerin der Kurden bekannt, hat sich erstaunlich schnell mit dem neuen Zustand abgefunden. Öl, Gas und eine gewisse ideologische Nähe von Erdoğan und Barzanis DPK wirkten als Schmiermittel. Allerdings scheint sich Ankara dauerhaft die Option Erbil oder Bagdad offenhalten zu wollen (Ali-Cem Deniz).
Unebenheiten
Bei Sammelbänden lassen sich Qualitätsunterschiede zwischen den Einzelbeiträgen nie ganz vermeiden. Das ist immer bedauerlich, doch ganz besonders dann, wenn gerade unbestreitbar kompetente Mitarbeiter unterdurchschnittliche Artikel abliefern.
So erliegt Karin Kneissl leider der Versuchung, das regionale Ölproblem einfach hundert Jahre zurück zu verlängern. Das ist verlockend, historisch aber unsinnig. Der 1.Weltkrieg wurde nicht um Energie geführt, und der Irak entstand schon gar nicht »entlang von Pipelines« (S. 55) – aus dem einfachen Grund, dass dort erst 1927 zur industriellen Ausbeutung geeignete Ölquellen gefunden wurden. Und die 1914 frisch auf Öl umgestellte Royal Navy fuhr im Krieg, allen Legenden zum Trotz, fast ganz mit Treibstoff aus den USA.
Fast noch schlimmer steht es mit dem Beitrag des bekannten Konfliktforschers Werner Ruf, der Öl, Gas und die Geostrategie der Region behandeln soll. Soll, denn ich muss gestehen, dass ich bis jetzt nicht ganz begriffen habe, um was der Artikel geht. Öl und Gas kommen vor, Geostrategie, der IS und seine Scheußlichkeiten, Syrien, der Westen, die Golfstaaten, die Interessen Saudi-Arabiens beim ägyptischen Militärputsch und, ach ja, der Irak auch, aber nirgends ein roter Faden. Bunt durcheinander, wenig konsistent und hochspekulativ, gestützt auf meist unkritisch zitierte Informationen aus Mainstream-Medien – und an besonders neuralgischen Stellen (z.B. Selbstfinanzierung des IS) kann sogar der Nachweis fehlen.
Von solchen Unebenheiten abgesehen bietet der Band solides und umfassendes Grundwissen und verlässliche Interpretationen zu einem der explosivsten Krisenherde der Welt, der politisch Interessierte noch lange beschäftigen wird – nicht nur des IS wegen.
Titelangaben
Tyma Kraitt (Hg.): Irak. Ein Staat zerfällt. Hintergründe, Analysen, Berichte
Wien: Promedia Verlag, 2015
224 Seiten, 17,90 Euro