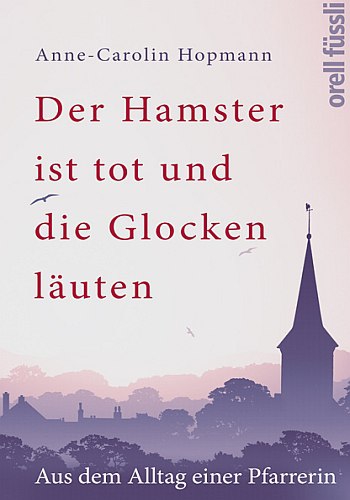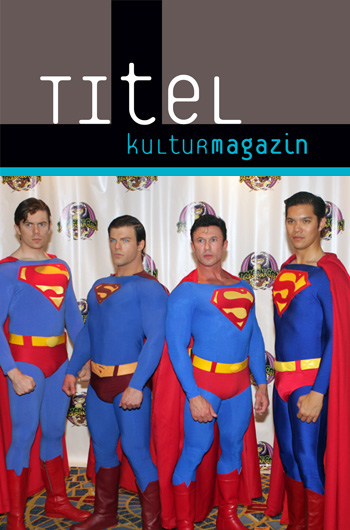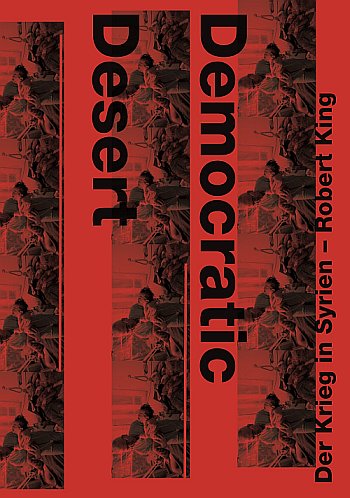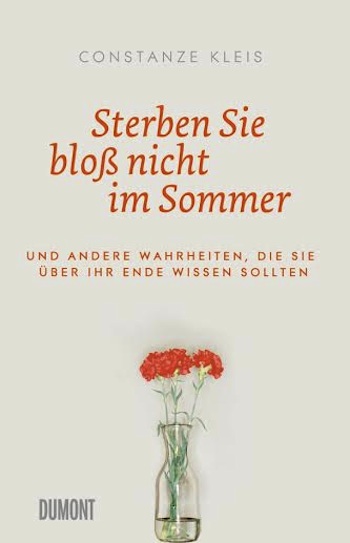Gesellschaft | Philip Roscoe: Rechnet sich das? Wie ökonomisches Denken unsere Gesellschaft ärmer macht
Philip Roscoe ist quasi prädestiniert, eine Kritik des neoliberalen Denkens zu verfassen. Der Wirtschaftswissenschaftler und Dozent für Management hat auch Theologie und Arabisches Denken des Mittelalters studiert. Der plakative Titel Rechnet sich das? Wie ökonomisches Denken unsere Gesellschaft ärmer macht wird damit dem philosophisch aufgeladenen Inhalt des Buches nicht gerecht. VIOLA STOCKER ließ sich tiefer leiten.
 Roscoe ist ein ruhiger Denker. Seine Analyse menschlicher Verhaltensweisen ist gründlich und oft beschämend entblößend. Bei aller derzeitigen Ökonomiekritik und der Medienwirksamkeit der »Occupy Wallstreet«-Bewegung zeigt er in einem einführenden Kapitel auf, wie durchdrungen die Menschheit ist vom Wirtschaftlichkeitsdenken. Natürlich ist es in Zeiten des Internets und komplexer Rechensysteme noch einfacher geworden, auch im eigenen Alltag Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Doch lässt man sich auch zunehmend durch Algorithmen fremdbestimmen.
Roscoe ist ein ruhiger Denker. Seine Analyse menschlicher Verhaltensweisen ist gründlich und oft beschämend entblößend. Bei aller derzeitigen Ökonomiekritik und der Medienwirksamkeit der »Occupy Wallstreet«-Bewegung zeigt er in einem einführenden Kapitel auf, wie durchdrungen die Menschheit ist vom Wirtschaftlichkeitsdenken. Natürlich ist es in Zeiten des Internets und komplexer Rechensysteme noch einfacher geworden, auch im eigenen Alltag Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchzuführen. Doch lässt man sich auch zunehmend durch Algorithmen fremdbestimmen.
Philosophische Grundlagen im Liberalismus
Es ist erstaunlich, wie genau Roscoe aufzeigt, dass das derzeitige marktwirtschaftliche Konzept eine logische Konsequenz aus den philosophischen Traditionen des 17. und 18. Jahrhunderts ist. Dort erstmals fallen Begriffe wie Naturrecht, Selbstinteresse, oder Hobbes‘ berühmtes Bonmot vom »Homo homini lupus«. Aus der Erfahrung der zahlreichen Kriege, politisch wie religiös motiviert, ließ sich für die friedenshungrigen Philosophen die menschliche Leidenschaft nur durch einen Staatsvertrag, der die Grundrechte garantierte, regeln.
Von hier aus ist es nur ein kurzer Schritt zu Adam Smith, der, aus der verheerenden Erfahrung des Merkantilismus und Absolutismus heraus, der Überzeugung war, ließe man nur dem Markt freie Hand, würde sich das Wirtschaftsgeschehen zum Besten des Menschen regeln. Offensichtlich, und das betont Roscoe, gründet unser marktwirtschaftliches System auf grausamen Erfahrungen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es ein naturgegebenes System sein muss.
Konstruktion des Homo Oeconomicus
Roscoe wirft der Wirtschaftswissenschaft vor, ein System als naturgegeben anzunehmen, das konstruiert ist. Der oft bemühte Idealtypus vom Homo Oeconomicus, einem Wesen, das sich von Selbstinteresse und Nutzenoptimierung leiten lässt, wird durch ihn meisterhaft zerpflückt. Während nämlich suggeriert wird, dass jeder Mensch nach diesem Prinzip funktioniere, findet Roscoe genügend Situationen, für die das nicht zutrifft. Er zitiert soziologische Studien über Prostitution und Organspenden. Weshalb gibt es Menschen in wohlsituierten Lebensentwürfen, die ihre Organe auch nicht gegen beliebig hohe Bezahlung abgeben? Weshalb werden nicht alle Frauen Prostituierte, wo doch der durchschnittliche Wochenlohn den einer Supermarktmitarbeiterin deutlich übersteigt?
Ökonomisches Denken hat Grenzen. Doch nicht nur das. Roscoe entblättert die Systemstrukturen geschickt. Jedes seiner Argumente wurzelt sowohl in philosophischen, statistischen als auch praktischen Beobachtungen. Ungleich der Naturgesetze à la Newton sind ökonomische Gesetze eben nicht per se existent. Sie bestehen immer innerhalb eines bestimmten Paradigmas. Roscoe vergleicht den Homo Oeconomicus zynisch mit einem studentischen »Schnorrer« und kann anhand statistischer Studien nachweisen, dass die Zahl derselben an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten höher ist als an geisteswissenschaftlichen. Generiert das System die eigenen Kinder?
Eine Reise nach Tlön
Das Zitat aus Borges Roman birgt für Roscoe eine Wahrheit, die auch in der Linguistik längst diskutiert wird: Die Performativität der Sprache. Entwickelt von John L. Austin zeigt es auf, wie der Sprecher durch die Anwendung der Sprache seine Umwelt generiert. Unlogisch? Früher gab es viel mehr Ausdrücke, die die Welt veränderten, man denke nur an: »hiermit taufe ich dich« oder »ich verfluche dich«. Ein Sprecher, der seine Welt als ökonomische beschreibt, wird sich entsprechend verhalten.
Tlön ist aber eine Kunstwelt, de facto non existent, die aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nur durch die Rückbeziehung auf sie wichtiger wird als die reale Welt. Ist dies mit der Wirtschaft geschehen? Hat sich die Menschheit ein Land – Tlön – konstruiert, aus dem es kein Entrinnen gibt?
Tatsächlich bleibt Roscoe hier Antworten schuldig. Das mag mit an seiner Analysetechnik liegen. Wer die Gegenwart von der Vergangenheit und der Philosophiegeschichte her aufarbeitet, hat vielleicht über die Zukunft weniger zu sagen.
Auswege in die Realität
Es liegt an jedem Einzelnen, zu entscheiden, wie er die modernen Instrumente der Wirtschaft anwenden möchte. Roscoe betont das innovative Potential regionaler Tauschwährungen, die aber in Deutschland weit weniger verbreitet und ökonomisch einflusslos sind. Medienwirksamen Aktionen wie der »Occupy«-Bewegung dagegen gibt er wenig Chancen. Für Roscoe ist es wichtig, dass das System der Marktwirtschaft möglichst mit eigenen Waffen geschlagen wird. Inwieweit dies nur ein weiterer Kriegsschauplatz in Tlön wäre, bleibt abzuwarten.
Titelangaben
Philip Roscoe: Rechnet sich das? Wie ökonomisches Denken unsere Gesellschaft ärmer macht
Aus dem Englischen von Ingrid Proß – Gill
München: Carl Hanser Verlag 2014
316 Seiten. 21,90 Euro
| Leseprobe