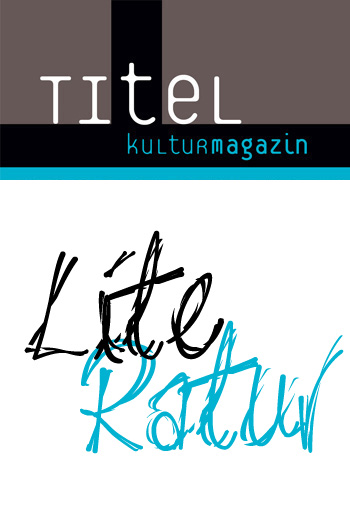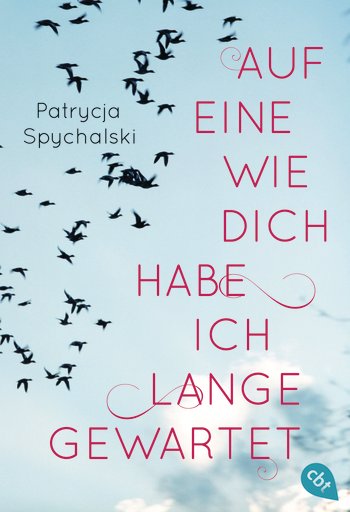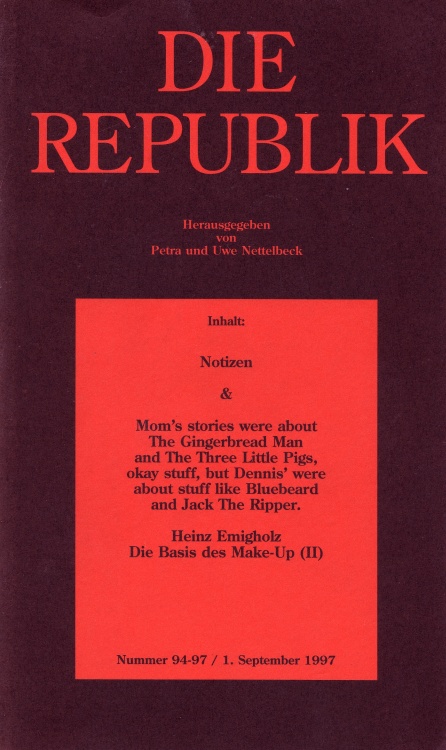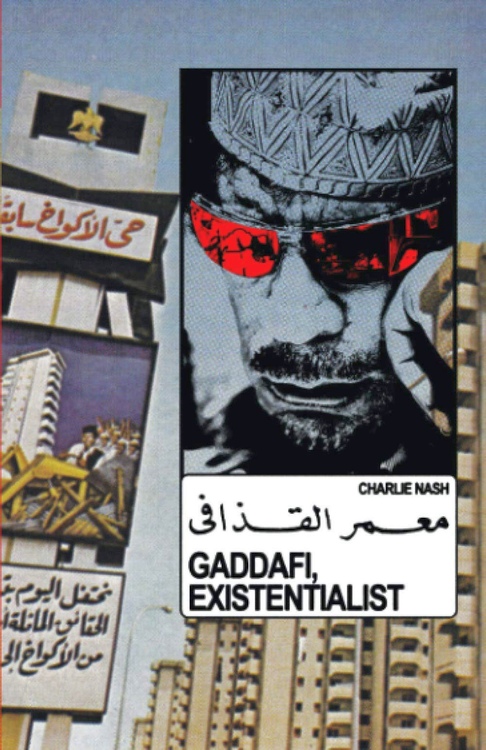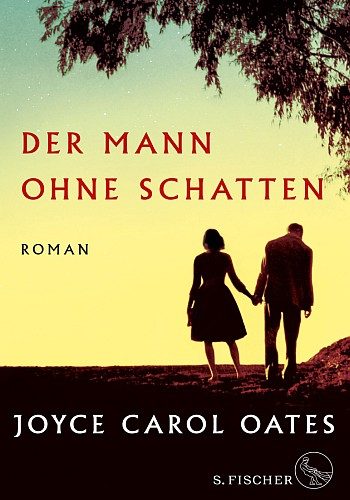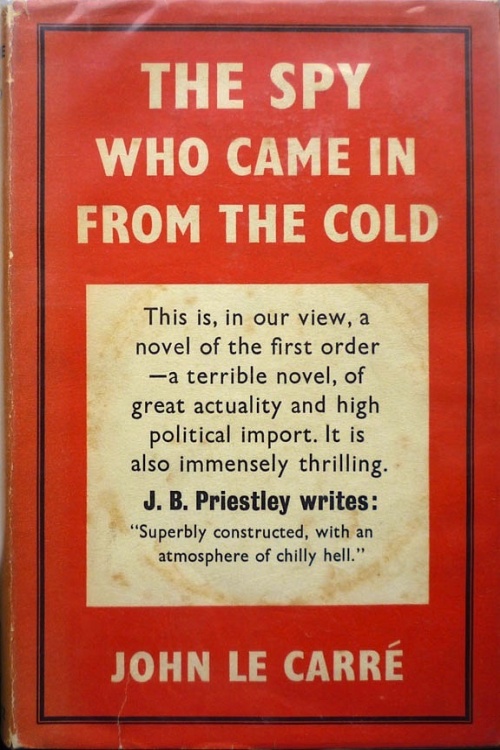Menschen | Zum Tode des Schriftstellers Rafael Chirbes
»Ich recherchiere nicht, suche keine Daten. Ich nehme auf, was ich auf der Straße mitbekomme. Die Lektüre von Marx hat mir geholfen, das Wesentliche wahrzunehmen, das, was eine Gesellschaft ausmacht. Und mein Unterbewusstsein«, hatte der bedeutende spanische Romancier Rafael Chirbes einmal erklärt. Von PETER MOHR

»Auch heute bin ich noch unten, wirtschaftlich gesprochen, vielleicht nicht mehr so tief wie vorher. Ich mache neben dem Schreiben andere Dinge, um Geld zu verdienen. Mein Haus konnte ich mir übrigens von dem Geld kaufen, das der Verkauf des Romans ›Der lange Marsch‹ in Deutschland einbrachte«, hatte Rafael Chirbes vor zwei Jahren in einem Interview mit der ›Neuen Zürcher Zeitung‹ erklärt.
Mit ›Der lange Marsch‹ (1996) hatte er früh eines seiner zentralen Sujets gefunden – Spanien auf dem dornenreichen Weg von der Franco-Diktatur zur Demokratie. Chirbes verfolgte in diesem Roman über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten das Leben von sieben höchst unterschiedlichen spanischen Familien.
Nach dem Geschichtsstudium in Madrid arbeitete der am 27. Juni 1949 in der Nähe von Valencia geborene Autor als Sprachlehrer und Journalist, bevor er in den 1980er Jahren mit dem Schreiben begann. Chirbes, der insgesamt neun Romane, dazu Erzählungen und viele kritische Essays verfasst hatte, war stets ein subtiler Beobachter, ein Chronist der Missstände, der sein Ohr am Puls der kleinen Leute hatte.
»Ich habe den Roman in der Region spielen lassen, in der ich selbst lebe. Es ist eine Welt ohne Prinzipien, in der die Umwelt zerstört wird«, bekannte Chirbes über seinen 2008 in deutscher Übersetzung erschienenen Roman ›Krematorium‹. Die Bausünden in der Küstenregion zwischen Valencia und Murcia gehen in diesem Roman auf das Konto der Romanfigur Rubén Bertomeu, die unzählige Apartment-Hochhäuser und Bungalow-Siedlungen errichtete und erfolgreich vermarktete. Bestechung und Korruption sind dem erfolgreichen Unternehmer nicht fremd, Rücksichtnahme ist nicht seine Sache. Als seinem schwer erkrankten Jugendfreund Federico Brouard, der ihn und seine architektonischen Sünden viele Jahre lang bekämpfte, finanziell das Wasser bis zum Hals steht, kauft er dem drogenabhängigen Schriftsteller ein Grundstück unter Wert ab und errichtet weitere Apartmenthäuser. Doch jener Rubén wird nachdenklicher, denn sein jüngerer Bruder Matías ist an Krebs gestorben.
Rafael Chirbes lässt seinen vielstimmigen, reflexiven Roman am Vormittag der Einäscherung spielen – an nur einem einzigen Tag, wie auch seinen letzten Roman ›Am Ufer‹ (2013/wie fast alle Romane in dt. Übersetzung im Antje Kunstmann Verlag erschienen), in dem sich Chirbes mit der Wirtschaftskrise in seinem Heimatland auseinander setzte und die normierte, ordnungsbestimmte mitteleuropäische Mentalität mit der mediterranen Lebensweise verglich. Die Kleinstadt Olba fungierte dabei als eine Art Spiegelbild für das krisengeschüttelte Spanien, das unter dem Platzen der sogenannten »Immobilien-Blase« dramatisch zu leiden hatte.
Am Samstag ist Rafael Chirbes, der zuletzt in der Nähe von Alicante gelebt hatte, im Alter von 66 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Spanien hat einen seiner bedeutendsten Schriftsteller der Nachkriegszeit verloren – eine Art kritisches Gewissen, eine deutlich vernehmbare, mahnende Stimme, die von ganz unten kam.