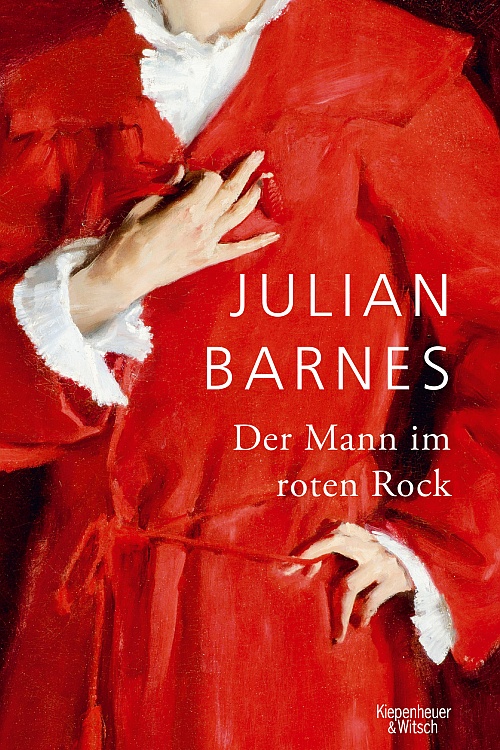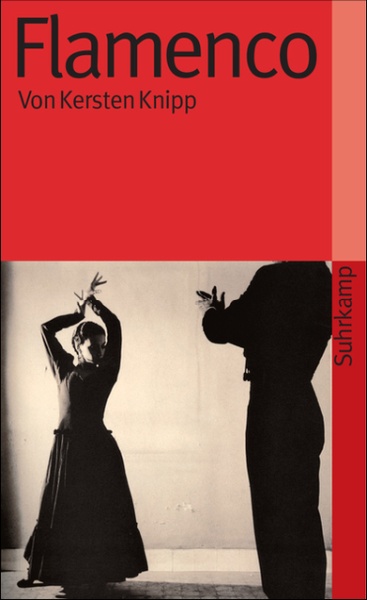Vor 50 Jahre, am 14. Mai 1973, hielt Muammar al-Gaddafi in Tripolis eine Rede über Existentialismus. Libyen sei daran nicht interessiert, weil man das letzte Geheimnis der Existenz, das auch die Wissenschaft nicht erklären kann, mit Religion beantworte. Der britische Journalist Charlie Nash tritt den Gegenbeweis an. Sein kurioses Büchlein »Gaddafi, Existentialist« entdeckt einen existentialistischen Faden in Leben und Werk des libyschen Revolutionsführers, Despoten, Außenseiters und Visionärs. Eine faszinierende Neuinterpretation – die das schillernde Gaddafi-Enigma durch das Prisma der Philosophie betrachtet. Von SABINE MATTHES
 Am 1. September 1969 brachte Muammar al-Gaddafi (19.6.1942 – 20.10.2011) den Libyern in einer unblutigen Revolution die Freiheit. Er wurde zum Fürsprecher der Unterdrückten – half Palästinensern, Kurden, Sahrauis, Kashmir, IRA und ANC. Nelson Mandela nannte ihn seinen »Waffenbruder im Kampf für Frieden und Menschenrechte« und einen Enkelsohn »Gaddafi«. Ronald Reagan – der US-amerikanische Rivale in Sachen Freiheitskampf – nannte ihn den »Mad Dog of the Middle East«. Susan Sontag hätte den stolzen Beduinen und Exzentriker vielleicht als popkulturelles Phänomen unter »Camp“ eingeordnet. Gaddafi veröffentlichte basisdemokratische Theorien, kritisierte Schulpflicht und westliche Demokratie als Diktatur der Mehrheit. Er ersann surrealistische Kurzgeschichten und zur Lösung des Nahostkonflikts einen gemeinsamen Staat namens »Isratine«. Die Einführung seiner neuen islamischen Zeitrechnung, die mit Mohammeds Geburt 40 Jahre früher begann, war Avantgarde und Provokation für viele Muslime. Als spendabler Idealist investierte Gaddafi Milliarden in den Traum der vereinten United States of Africa und deren Infrastruktur. Er mutierte vom gefeierten Revolutionsführer zum Despoten – zum gefallenen Engel und Verräter der eigenen Ideale. Am 20. Oktober 2011 grausam ermordet in einer blutigen Revolte, die Libyen in Chaos und Bürgerkrieg stürzte. Für Westafrika begann mit Gaddafis Tod die Destabilisierung durch Dschihadisten.
Am 1. September 1969 brachte Muammar al-Gaddafi (19.6.1942 – 20.10.2011) den Libyern in einer unblutigen Revolution die Freiheit. Er wurde zum Fürsprecher der Unterdrückten – half Palästinensern, Kurden, Sahrauis, Kashmir, IRA und ANC. Nelson Mandela nannte ihn seinen »Waffenbruder im Kampf für Frieden und Menschenrechte« und einen Enkelsohn »Gaddafi«. Ronald Reagan – der US-amerikanische Rivale in Sachen Freiheitskampf – nannte ihn den »Mad Dog of the Middle East«. Susan Sontag hätte den stolzen Beduinen und Exzentriker vielleicht als popkulturelles Phänomen unter »Camp“ eingeordnet. Gaddafi veröffentlichte basisdemokratische Theorien, kritisierte Schulpflicht und westliche Demokratie als Diktatur der Mehrheit. Er ersann surrealistische Kurzgeschichten und zur Lösung des Nahostkonflikts einen gemeinsamen Staat namens »Isratine«. Die Einführung seiner neuen islamischen Zeitrechnung, die mit Mohammeds Geburt 40 Jahre früher begann, war Avantgarde und Provokation für viele Muslime. Als spendabler Idealist investierte Gaddafi Milliarden in den Traum der vereinten United States of Africa und deren Infrastruktur. Er mutierte vom gefeierten Revolutionsführer zum Despoten – zum gefallenen Engel und Verräter der eigenen Ideale. Am 20. Oktober 2011 grausam ermordet in einer blutigen Revolte, die Libyen in Chaos und Bürgerkrieg stürzte. Für Westafrika begann mit Gaddafis Tod die Destabilisierung durch Dschihadisten.

Zehn Jahre danach wagt der britische Journalist Charlie Nash mit seinem kuriosen Büchlein »Gaddafi, Existentialist« eine faszinierende Neuinterpretation. Nash schreibt über US- und britische Politik und hat ein Faible für Seltsames, Abwegiges, Underground-Subkulturen, Technologie, Ideologie und Außenseiter. Er beleuchtet das Phänomen Gaddafi nicht moralisch-politisch, sondern anhand einer philosophischen Frage: War Gaddafi Existentialist? Nashs Betrachtung erinnert an Jean-Paul Sartres existentialistische Analyse von Jean Genet. Sartre illustrierte in seiner famosen Fallstudie »Saint Genet, Komödiant und Märtyrer« (1952, dt. 1982) seine existentialistischen Themen Authentizität, Freiheit und Verantwortung. Nash tut dasselbe und entdeckt einen existentialistischen Faden in Gaddafis Leben und Werk.
Nashs philosophische Versuchsanordnung – Gaddafi plus Existentialismus – mutet zunächst bizarr an, surreal. Aber erweist sich als erstaunlich überzeugend und öffnet dem Leser den Horizont für ganz eigene Gedankenspiele. Könnte zum Beispiel Colonel Kurtz/Marlon Brando in Francis Ford Coppolas filmischem Meisterwerk »Apocalypse Now« ein existentialistisches Alter Ego von Colonel Gaddafi sein? »Der Mann ist klar im Kopf, aber seine Seele ist verrückt«, diagnostiziert der Fotograf/Dennis Hopper im Film. Colonel Kurtz sei »ein Mann, der Gewalt und Terror nutzt für das moralisch größere Gute«, der als Gottkönig herrscht und sich am Ende, in der Einsamkeit seines Irrtums und Scheiterns, in einem existentialistischen Plädoyer rechtfertigt: »Haben Sie jemals echte Freiheit erwogen? Freiheit von den Meinungen anderer? Sogar von ihren eigenen Meinungen?« Vor seiner Hinrichtung – ein furios ekstatischer Blutrausch, wie die rituelle Schlachtung eines Opfertiers, mit dem gleichzeitig die verwegene Hoffnung auf Erlösung explodiert und erlischt – fordert Colonel Kurtz: »Sie haben kein Recht, mich einen Mörder zu nennen. Sie haben das Recht mich zu töten. Aber Sie haben kein Recht, über mich zu urteilen.« Kurtz und Gaddafi sahen sich, wie Ordnungshüter inmitten eines weit größeren Wahnsinns, als moralische Männer, auch wenn die Moral sie verlassen hatte.
Colonel Kurtz, Gaddafi und Jean Genet waren auf unterschiedliche Art Rebellen und Außenseiter, mit einer poetischen und moralischen Vision. In Sartres Augen hatte Jean Genet – der Dieb, Homosexuelle, Verräter und Außenseiter – frei entschieden, Paria und Dichter zu sein; er lebe »die wahre Einsamkeit, die des Monstrums, …, die unsere ist …«. Für Sartre verkörperte Jean Genet die DNA des Existentialismus: Authentizität, Freiheit und Verantwortung. Genet erfand sich selbst und bekannte sich stolz zu seinem Außenseitertum, wie Gaddafi. Für Charlie Nash ist Gaddafi ein solcher Außenseiter, dass er sogar ganz Libyen zu einem Außenseiter-Staat machte! Für seine existentialistische Analyse bezieht Nash sich hauptsächlich auf Gaddafis Kurzgeschichten und will den meist sarkastischen, höhnischen Kritiken eine andere Sicht entgegensetzen.
Nash beschreibt Gaddafi als »bewussten Außenseiter« und »unterbewussten Existentialisten«. Laut einiger Gerüchte soll Colin Wilsons Buch »The Outsider« (1956), das die philosophische Rolle des Außenseiters untersucht, Gaddafis Lieblingsbuch gewesen sein. Wilson wurde, wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, weitläufig ins Arabische übersetzt und viel gelesen. Spannend ist, wie deren Konzepte des europäischen Existentialismus – Unabhängigkeit, Emanzipation, Befreiung – während der Dekolonisierung benutzt und in einen arabischen Existentialismus übersetzt wurden. Yoav Di-Capua beschreibt in seinem Buch »No Exit: Arab Existentialism, Jean-Paul Sartre, and Decolonization« (2018), dass Sartre als ein Fürsprecher der arabischen Welt galt. Zumindest bis 1967, als er nicht die palästinensische Sache unterstützte und vom Helden zum Verräter wurde. Jean Genet dagegen blieb seinem Herzen und der Sache der Unterdrückten treu, unterstützte die Palästinenser und sagte zu Edward Said über Sartre: »Er ist ein bisschen feige, er hat Angst, dass ihn seine Freunde in Paris beschuldigen, Antisemit zu sein, wenn er was auch immer sagt, um für die Rechte der Palästinenser einzutreten.« Für Genet waren Mut und Schönheit palästinensischer Freiheitskämpfer und Transsexueller wesensverwandt.

(Peter Zapffe, Abdel rahman badawi, CC BY-SA 4.0)
Köchler, eine schillernde Figur, der sich leidenschaftlich für Menschenrechte und internationale Gerechtigkeit einsetzt und mit Genet und dem senegalesischen Präsidenten Léopold Senghor bekannt war, wurde von Kofi Annan im Jahr 2000 zum internationalen Beobachter beim Lockerbie-Prozess ernannt. Er hatte die UNO auf schwerwiegende Mängel in der Prozessführung hingewiesen und den Verdacht eines Fehlurteils, was sich teils bestätigte. Allgemein kritisiert er, aus Sicht einer philosophischen Ethik, die »Politik der doppelten Standards«, wo das Label »Terrorist« für nicht-staatliche Akteure gilt, aber nicht für reguläre Armeen. Er spricht vom »metaphysischen Feind«, denn »der Terrorist des einen, ist der Freiheitskämpfer des anderen«.

(Abb. © i-p-o)
Am 14. Mai 1973 hielt Gaddafi auf der Konferenz der Euro-Arabischen Jugend in Tripolis eine Rede über Existentialismus. Darin lehnt er diesen als »eine Manifestation der Angst« ganz eindeutig ab. Er erklärt: »diese Theorie sucht nach dem Geheimnis der Existenz, während wir dieses Geheimnis verstehen, und zwar durch die Religion.« Gaddafi war in genau jenen konservativen Werten verankert – Familie, Tradition, Nation, Religion –, die Sartre und de Beauvoir ablehnten. Dennoch kommt in seinen Geschichten eindeutig ein existentialistisches Gefühl der Entfremdung und Leere zum Ausdruck. Nash erklärt Gaddafis Entfremdung mit mehreren Gründen. Er wechselte vom bescheidenen Leben eines Beduinen zum geschäftigen Führer einer Nation. Seine persönliche Interpretation des Islam stand oft im Widerspruch zu der anderer Intellektueller. Gaddafi fühlte eine doppelte Loyalität zur arabischen und zur afrikanischen Welt. Seine politische Ideologie stand zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten und entfremdete ihn auf der Weltbühne. Nash interpretiert Gaddafis Opposition zum Existentialismus als eine Opposition zu einem atheistischen Existentialismus, der Religion rundweg zurückweist. Die atheistische und hedonistische Natur der Pariser Existentialistenszene widersprach Gaddafis eigener Ideologie. Als er aber in den 1970er Jahren Paris besuchte, um der Welt seine Ideologie vorzustellen, trug er schwarzen Rollkragenpullover und Blazer und sah ganz wie ein Pariser Existentialist aus!
Generell waren Gaddafis kreative Outfits und Requisiten präzise Statements ganz ohne Worte – seine persönliche Art subversiver Guerillakunst. Ständig evaluierte er die Welt und seinen Platz darin. Sein Vater und Großvater waren im Kampf gegen die italienische Kolonialmacht verwundet beziehungsweise getötet worden. So wollte er beim Staatsbesuch in Italien die Italiener mit ihren gut verdrängten Kolonialverbrechen konfrontieren. Er heftete sich ein Foto des 1931 von der Kolonialmacht in Ketten gelegten libyschen Widerstandskämpfers Omar Mukhtar an die Brust und liess im italienischen Fernsehen dessen Lebensverfilmung »Lion of the Desert« (1980), mit Anthony Quinn in der Titelrolle, zeigen. Auch Gaddafis Beduinenzelt Inszenierungen zeugten von einer inneren Freiheit: zur eigenen Andersartigkeit stehen und stolz jedem Spott trotzen.
 1993 erschien in Libyen Gaddafis Sammlung von zwölf Kurzgeschichten »Das Dorf, das Dorf, die Erde, die Erde, und der Selbstmord des Astronauten« (deutsch 2004 im belleville-Verlag). In ihnen sieht Charlie Nash die stärksten Argumente, Gaddafi entgegen dessen eigener Ablehnung dennoch als Existentialisten zu deuten. »Die Stadt« erinnert an Alfred Kubins Roman »Die andere Seite« mit der in ewigem Dämmerlicht liegenden Alptraumstadt »Perle«. Diese Verachtung der Großstadt reflektiert wohl Gaddafis Erfahrung mit London, wo ihm, dem Beduinen aus der Wüste, statt warmer Gastfreundschaft sicher ein kalter, unbarmherziger Wind furchteinflößender Anonymität entgegenschlug. Diese Missachtung des Urbanen ist vielleicht auch der Grund, warum man in der schönen Hauptstadt Tripolis, mit den magischen langen De-Chirico-Schatten, erstaunlich wenig Kultureinrichtungen, Lokale und Cafés – das Lebenselixier der Pariser Existentialisten – sah. Für Nash ist »Die Stadt« ein Beweis für Gaddafis »optimistischen Existentialismus«, der sich »nicht nur in nihilistischem Grauen wälzt«, sondern auch ein Gegenmittel in Form des Dorfes und des Landes bietet.
1993 erschien in Libyen Gaddafis Sammlung von zwölf Kurzgeschichten »Das Dorf, das Dorf, die Erde, die Erde, und der Selbstmord des Astronauten« (deutsch 2004 im belleville-Verlag). In ihnen sieht Charlie Nash die stärksten Argumente, Gaddafi entgegen dessen eigener Ablehnung dennoch als Existentialisten zu deuten. »Die Stadt« erinnert an Alfred Kubins Roman »Die andere Seite« mit der in ewigem Dämmerlicht liegenden Alptraumstadt »Perle«. Diese Verachtung der Großstadt reflektiert wohl Gaddafis Erfahrung mit London, wo ihm, dem Beduinen aus der Wüste, statt warmer Gastfreundschaft sicher ein kalter, unbarmherziger Wind furchteinflößender Anonymität entgegenschlug. Diese Missachtung des Urbanen ist vielleicht auch der Grund, warum man in der schönen Hauptstadt Tripolis, mit den magischen langen De-Chirico-Schatten, erstaunlich wenig Kultureinrichtungen, Lokale und Cafés – das Lebenselixier der Pariser Existentialisten – sah. Für Nash ist »Die Stadt« ein Beweis für Gaddafis »optimistischen Existentialismus«, der sich »nicht nur in nihilistischem Grauen wälzt«, sondern auch ein Gegenmittel in Form des Dorfes und des Landes bietet.
»Die Erde, die Erde« zeigt Gaddafi als Umweltaktivisten! Es klingt wie ein Echo auf James Lovelocks populäre »Gaia-Hypothese« von 1979. Lovelock war Mitarbeiter der Mars-Mission der Nasa – ernüchtert, dass man dort keinerlei Anzeichen von Leben vorfand, konzentrierte er sich auf die Ökologie und Verletzlichkeit des eigenen Planeten, fasste Mutter Erde als genuines Lebewesen auf und wurde zum Orakel und Vorreiter der Ökologie-Bewegung. Gaia war in der griechischen Mythologie die personifizierte Erde und Urmutter der Götter. Auch Gaddafi beschwört uns, Mutter Erde zu schützen: »Die Erde ist in der Tat eure Mutter. Sie hat euch aus ihren Eingeweiden geboren. Sie ist es, die euch aufzieht, speist und tränkt … zerfetzt nicht ihr Fleisch, verwundet nicht ihren Körper! … denn wenn ihr sie vernachlässigt, werdet ihr nach ihr keine Mutter mehr finden.« Nash erklärt, dass »Gaddafis Utopie« ein ländliches, selbstversorgendes Dorf sei, wo man mit der Natur und den Menschen in Harmonie lebe. »Gaddafis Dystopie« sei dagegen der unnatürliche urbane Dschungel der Stadt, wo Verderben, Gier und Ausbeutung herrschten. In »Die Erde, die Erde« wolle Gaddafi seine Leser ermutigen, »den utopischen Weg einzuschlagen, anstatt des dystopischen«.
»Der Selbstmord des Astronauten« könnte von der existentialistischen Erfahrung des russischen Kosmonauten Sergei Krikalev inspiriert sein. Der war 1991 allein im Weltraum gestrandet und Monate später in einer völlig fremden Realität gelandet, weil die Sowjetunion sich aufgelöst hatte und sein Land nicht mehr existierte. Für Nash ist dies Gaddafis absolut existentialistischster Text, weil es explizit um eine existentielle Krise geht. Nach der Rückkehr vom weiten Horizont des Weltraums und der Galaxie, zurück zum bescheidenen Leben auf Erden »implodiert seine Identität«, und er begeht Selbstmord.
 Der Tod ist in der existentialistischen Literatur durchweg ein entscheidender Faktor für die Bedeutung/Bedeutungslosigkeit des Lebens. Gaddafis Tod erinnert mich nicht nur an Colonel Kurtz, sondern auch an den Tod des Matrosen Ryuji in Yukio Mishimas Roman »Der Seemann, der die See verriet« (1963). Der Matrose wird von einer Gang Jugendlicher mit dem Tod bestraft, weil er deren Phantasie und Ideal verraten hatte und vom unkonventionell-glorreich-schillernden Helden auf See zum banalen Landbewohner verblasst war. Ähnlich wie Gaddafi für Libyen hatte der avantgardistische Nationalist Yukio Mishima nach der Essenz der japanischen Identität gesucht. Zerrissen zwischen traditionellen Samuraiwerten und der Moderne, wählte er einen melodramatischen Tod durch rituellen Selbstmord – als die ultimative existentialistische Geste. Wie der Matrose Ryuji das Meer verraten hatte, als er zum Landbewohner wurde, so hatte Gaddafi die Revolution verraten. Und wird dafür ebenso mit einem grausamen Tod bestraft. Gaddafis Ende erfüllt auf tragische Weise seine eigene Philosophie aus dem »Grünen Buch«: Wenn Revolutionen in Macht und Despotie verwandelt werden, sind sie nicht länger Revolutionen.
Der Tod ist in der existentialistischen Literatur durchweg ein entscheidender Faktor für die Bedeutung/Bedeutungslosigkeit des Lebens. Gaddafis Tod erinnert mich nicht nur an Colonel Kurtz, sondern auch an den Tod des Matrosen Ryuji in Yukio Mishimas Roman »Der Seemann, der die See verriet« (1963). Der Matrose wird von einer Gang Jugendlicher mit dem Tod bestraft, weil er deren Phantasie und Ideal verraten hatte und vom unkonventionell-glorreich-schillernden Helden auf See zum banalen Landbewohner verblasst war. Ähnlich wie Gaddafi für Libyen hatte der avantgardistische Nationalist Yukio Mishima nach der Essenz der japanischen Identität gesucht. Zerrissen zwischen traditionellen Samuraiwerten und der Moderne, wählte er einen melodramatischen Tod durch rituellen Selbstmord – als die ultimative existentialistische Geste. Wie der Matrose Ryuji das Meer verraten hatte, als er zum Landbewohner wurde, so hatte Gaddafi die Revolution verraten. Und wird dafür ebenso mit einem grausamen Tod bestraft. Gaddafis Ende erfüllt auf tragische Weise seine eigene Philosophie aus dem »Grünen Buch«: Wenn Revolutionen in Macht und Despotie verwandelt werden, sind sie nicht länger Revolutionen.
 Für mich ist »Die Flucht in die Hölle« Gaddafis faszinierendste und existentialistischste Geschichte. Unheimlich, visionär – wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Gaddafi schreibt: »Die Tyrannei eines Einzelnen ist die schändlichste aller Tyranneien, doch der Despot ist ein Einzelner, den die Gemeinschaft beseitigen kann … Die Tyrannei der Massen dagegen ist die brutalste Art von Tyrannei, denn wer kann sich allein gegen den reißenden Strom, gegen die blinde, umfassende Macht stellen?« Er liebe die Freiheit der Massen, wenn sie »losbrechen, nachdem sie ihre Fesseln gesprengt haben“ und fürchte sie, »wie ich meinen Vater liebe und fürchte.« Er fühlt sich gejagt von der Kakophonie der Millionen Wörter und Wünsche aus Millionen Mündern, »dieser kollektiven Flamme, die mir meinen Rücken verbrennt …« Er fürchtet, so schrecklich wie Danton und Robespierre zu enden, und beschließt, »in die Hölle zu fliehen.« Er steigt in das feierliche Schweigen der Hölle hinab, wo auch die wilden Tiere Zuflucht suchen, »denn in der Hölle können sie leben, unter euch nur sterben. Alles um mich herum verschwand, außer mir selbst. Meiner eigenen Existenz wurde ich mir bewusster als an jedem anderen Ort und zu jeder anderen Zeit.« Seine Seele und er suchten Schutz und umschlangen einander und wurden zum ersten Mal eins. »Nichts blieb außer der Hölle und vor allem ihr Herz.«
Für mich ist »Die Flucht in die Hölle« Gaddafis faszinierendste und existentialistischste Geschichte. Unheimlich, visionär – wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Gaddafi schreibt: »Die Tyrannei eines Einzelnen ist die schändlichste aller Tyranneien, doch der Despot ist ein Einzelner, den die Gemeinschaft beseitigen kann … Die Tyrannei der Massen dagegen ist die brutalste Art von Tyrannei, denn wer kann sich allein gegen den reißenden Strom, gegen die blinde, umfassende Macht stellen?« Er liebe die Freiheit der Massen, wenn sie »losbrechen, nachdem sie ihre Fesseln gesprengt haben“ und fürchte sie, »wie ich meinen Vater liebe und fürchte.« Er fühlt sich gejagt von der Kakophonie der Millionen Wörter und Wünsche aus Millionen Mündern, »dieser kollektiven Flamme, die mir meinen Rücken verbrennt …« Er fürchtet, so schrecklich wie Danton und Robespierre zu enden, und beschließt, »in die Hölle zu fliehen.« Er steigt in das feierliche Schweigen der Hölle hinab, wo auch die wilden Tiere Zuflucht suchen, »denn in der Hölle können sie leben, unter euch nur sterben. Alles um mich herum verschwand, außer mir selbst. Meiner eigenen Existenz wurde ich mir bewusster als an jedem anderen Ort und zu jeder anderen Zeit.« Seine Seele und er suchten Schutz und umschlangen einander und wurden zum ersten Mal eins. »Nichts blieb außer der Hölle und vor allem ihr Herz.«
| SABINE MATTHES
| Abb.: Peter zapffe, Abdel rahman badawi, CC BY-SA 4.0
Titelangaben
Charlie Nash: »Gaddafi, Existentialist«
Lockside Ephemera, USA 2021 – erscheint in Kürze auf Deutsch
Webseite des Autors: www.charliewnash.net
Dank an Father Frank Gelli für den Hinweis