Film | Raf Reyntjens: Paradise Trips. Eine belgisch-niederländische Coproduktion
»Der Sommer der Liebe«, schrieb der als Student in San Francisco lebende Student der Politischen Wissenschaft, Hans Pfitzinger († 2010) in seinen Erinnerungen ›Love and Peace‹ und all die Hippies aus dem Jahr 2007, »fing am 16. April 1943 in Basel an. Dort, im pharmazeutischen Labor der Chemiefirma Sandoz, spürte erstmals ein Mensch die Wirkung von LSD …« Gedanken zu einer sehr komischen Tragödie über die Wiedergeburt einer Gesellschaftsform von DIDIER CALME
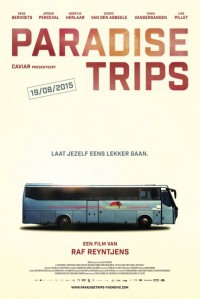 »In besagtem Labor bekam Dr. Albert Hofmann, der nach Arzneimitteln auf der Basis von Mutterkorn forschte, versehentlich eine winzige Menge Lysergsäurediethylamid an eine Fingerkuppe. Danach wurde dem Doktor sehr seltsam zumute, und er beschloß, für heute mit der Arbeit Schluß zu machen. Auf dem Heimweg setzte die volle Dröhnung ein: Der erste LSD-Reisende war mit dem Fahrrad unterwegs.«
»In besagtem Labor bekam Dr. Albert Hofmann, der nach Arzneimitteln auf der Basis von Mutterkorn forschte, versehentlich eine winzige Menge Lysergsäurediethylamid an eine Fingerkuppe. Danach wurde dem Doktor sehr seltsam zumute, und er beschloß, für heute mit der Arbeit Schluß zu machen. Auf dem Heimweg setzte die volle Dröhnung ein: Der erste LSD-Reisende war mit dem Fahrrad unterwegs.«
Der sich eigentlich seit Kurzem im Ruhestand befindliche Mario Dockers (Eugeǹe ›Gene‹ Bervoets) ist im sommerlichen 2015 mit dem Bus unterwegs zu seinem ersten wirklichen Trip. Der gepflegte moderne Reisebus gehört ihm, doch es will ihm partout nicht gelingen, ihn zu verkaufen; ein wenig mag es auch daran liegen, dass er sich nur unter größten Erschwernissen von diesem Transportmittel ins Paradies zu trennen vermag. Diese anhaltende Situation heitert die ohnehin nicht mehr von sonderlichen Aufflammungen gekennzeichnete langjährige Ehe zwischen ihm und seiner Frau Linda (Tania Van der Sanden) nicht eben auf. Sie möchte, dass endlich Ruhe und Behaglichkeit, von vielen Menschen auch als Frieden bezeichnet, in den am Rande des belgischen Antwerpen gelegenen Bungalow der siebziger Jahre einkehrt, er in Ruhe vor dem Fernsehgerät, in dem er kurzzeitig recht angewidert die Revolte der Sechziger über sich ergehen lässt, sitzen und sein Bier trinken kann, während die Gattin ihm sein tägliches Beefsteak (das nicht mit dem gleichnamigen deutschen sogenannten Hacksteak zu verwechseln ist, sondern aus einem tellergroßen Stück Rindfleisch besteht) mit daumendicken Fritten, in etwa das belgische Nationalgericht, zubereitet, sie ihm den herrisch angemahnten riesigen Topf Mayonnaise dazustellt, er also nicht immerfort unterwegs sein muss in ganz Europa und die Restfamilie sich selbst überlässt. Doch einmal noch zeigt sich eine Schicksalsfügung – noch einmal muss er fahren: ersatzweise für den Freund und Kollegen Gino, der verhindert ist, und unter Freunden hilft man sich nun einmal. Die Gattin ist zutiefst betrübt bis ungehalten. Ach, Linda, versucht er sie zu beruhigen, es dauere doch nur eine Woche, dann sei ein für allemal Schluss.
 Seine Fahrgäste setzen sich zusammen aus Hippies der jüngeren, quasi nachgerückten oder auch wiedergeborenen Generation, die sich ein neues, im idyllischen Kroatien gelegenes Woodstock als Reiseziel ausgesucht haben. Sie und ihr Chauffeur Dockers scheinen von Beginn an nicht so recht zu harmonieren. Deshalb stellt er sich vor der Abfahrt vorn neben dem Pilotensitz in voller männlicher Größe auf und ein und für allemal klar: Während dieses ›Paradise Trips‹ (so der leuchtend prangende Name seines Unternehmens) in seinem Bus sei er der Chef; wer Ärger mache, der flöge raus.
Seine Fahrgäste setzen sich zusammen aus Hippies der jüngeren, quasi nachgerückten oder auch wiedergeborenen Generation, die sich ein neues, im idyllischen Kroatien gelegenes Woodstock als Reiseziel ausgesucht haben. Sie und ihr Chauffeur Dockers scheinen von Beginn an nicht so recht zu harmonieren. Deshalb stellt er sich vor der Abfahrt vorn neben dem Pilotensitz in voller männlicher Größe auf und ein und für allemal klar: Während dieses ›Paradise Trips‹ (so der leuchtend prangende Name seines Unternehmens) in seinem Bus sei er der Chef; wer Ärger mache, der flöge raus.
»Ob die Hippies allgemein als politische Bewegung zu sehen waren«, so Pfitzinger in seinem Aufsatz zur Genesis dieser in der Mitte der sechziger Jahre in den USA entstandenen, von der Staatsmacht massiv bekriegten subkulturellen Friedensbewegung, »darüber ließ es sich schon damals trefflich streiten. Was sich im Lebensstil ausdrückte, hatte aber unstreitig politische Aspekte: Zusammenleben in Kommunen, mit Hanf, Pilzen, LSD, Meskalin zur Erweiterung des Bewußtseins; drastische Beschränkung des privaten Eigentums; Kreativität statt Konsum; Freiheit statt Autorität. Selbstbestimmte Stämme sorgen dafür, daß Regierung und herkömmliche Machtstrukturen überflüssig werden. Die Speerspitze der Bewegung, eine Art führerlose Kerntruppe der Blumenkinder, waren die Diggers. Bei aller scheinbaren Unbekümmertheit hatten sie eine radikal-utopische Grundhaltung. Sie organisierten das Gemeinschaftsleben in Haight/Ashbury so, als sei die Revolution bereits erfolgreich gelaufen: Jeden Tag verteilten sie umsonst Essen und Kleidung im Park, gründeten die (auch heute noch bestehende) Haight-Ashbury Free Clinic für kostenlose Gesundheitsfürsorge, dazu gab es gratis juristische Hilfe für alle Konflikte mit der Staatsmacht. Finanziert wurden diese Aktivitäten durch Benefizkonzerte, bei denen Spenden gesammelt wurden. Die Diggers verachteten die herkömmlichen politischen Institutionen – der Staat wurde, solange er sich nicht einmischte, einfach ignoriert. Finanzielle Unterstützung von den Behörden hätte Verrat bedeutet. Was sich zwischen 1964 und 1967 am Golden Gate Park abspielte, ist durchaus vergleichbar mit der Pariser Kommune oder den Gemeinschaften der Anarchosyndikalisten im Katalonien des Spanischen Bürgerkriegs. Dass in allen Fällen die Staatsmacht den Sieg davontrug, ändert nichts an der Gültigkeit des Strebens nach einer selbstbestimmten, humanitären Gesellschaft. Der ›Summer of Love‹ war sicher nicht der letzte Versuch in diese Richtung.«
Der zunächst Letztbekannte liegt vor. Der belgische Regisseur des Jahrgangs 1975, Raf Reyntjens, hat ihn spielfilmisch dokumentiert. Er wirft dem Filmbeobachter einen Trip ein.
Besondere Vorkommnisse während der Fahrt sind nicht zu vermelden; jedenfalls nimmt der Herr des Busses sie nicht wahr, etwa den multidurchrassten Hund, einem das Leben der Hippies stets begleitenden Tier, der hinten auf der letzten Bank endlich mal den Kopf aus der Reisetasche stecken darf und mit dem Mario Dockers später zwischenzeitlich noch nähere, ihm nicht unbedingt angenehme Bekanntschaft machen wird. Dem Bus folgt ein stattliches, beinahe busgroßes Wohnmobil, bei dessen Eignerin es sich um die Organisatorin Miranda (Noortje Herlaar) des paradiesischen Trips handelt, die sich zu Beginn natürlich-freundlich vorgestellt und dem Busunternehmer die zuvor vereinbarte Summe Geldes ausgehändigt hat. Als Begründung für ihren Solo-Trip verweist sie auf ihren im Wohnwagen noch schlafenden Sohn. Doch Herrn Dockers scheint das ohnehin gleich, scheint es sich doch um eine der Fahrten wie alle anderen zu handeln, die er im Lauf der Jahrzehnte unternommen hat. Der Chef dreht den Zündschlüssel, und es erklingen Schlagertöne in ›vlaams‹, der belgischen Variante des Niederländischen. Belgien ist nicht nur ein im Grunde zweigeteiltes Land unterschiedlicher Sprachen, sondern auch das zweier Mentalitäten: da der französisch orientierten wallonischen, dort der flämischen, für das symbolisch das Chanson ›Le plat pays‹ von Jacques Brel aus dem Jahr 1962 stehen mag, der es unter dem Titel ›Mijn vlakke land‹ (Mein flaches Land) auch in der Sprache seiner Heimat Westflandern eingespielt hat und in dem es unter anderem heißt: Mit einem Himmel so tief, dass ein Kanal sich verirrt / Mit einem Himmel so tief, der demütig macht / mit einem Himmel so grau, dass ein Kanal sich dran aufhängt …
An der Musik hängt sich keiner der Reisenden weiter auf, allenfalls wird in einigen Gesichtern ein Grinsen sichtbar, das unter toleranter Ignoranz zu verbuchen sein könnte. Die Gruppe weiß, sie wird bald andere Klänge vernehmen. Die Fahrt verläuft ohne besondere Vorkommnisse, sieht man von dem den Chauffeur des Busses irritierenden Ereignis eines nackten Hinterteils ab, das ihm vom Rückfenster des Wohnmobils entgegengestreckt wird, das die Führung auf dem Weg in das abgelegene, offenbar nur schwierig zu findende kroatische Woodstock der Neuzeit übernommen hat, in dem es so gut wie keinen Mobilfunkempfang gibt und wohl auch jedes Navigationsgerät sich verweigert.
 Der Popo gehört zu einem etwa zehnjährigen Jungen namens Sunny (Cédric Van den Abbeele), der nach Ankunft im kroatischen, chaotisch wimmelnden Woodstock-Heerlager des Friedens sich in aller Ruhe vor dem Wohnmobil platziert hat, das der temporäre Hippietransportunternehmer Mario Dockers aufsucht, da er mit der Organisatorin Miranda einiges regeln möchte, da einiges nicht seinen Vorstellungen von Regeln und Ordnung entspricht, etwa eine mittels geschmissenem Stein zerstörte Scheibe seines Busses. Der Besitzer des entzückenden Hinterns sitzt auf demselben und dippelt mäßig engagiert, aber routiniert auf einem kleinen Computerspielgerät herum, mit dem man Männchen erschießen kann. Es handelt sich um jenen Sohn namens Sunny, der zu Beginn der Abreise in Antwerpen noch in der fahrbaren Kleinwohnung schlief. Es könne dauern, bis die Frau Mama erscheine, er wisse es nicht. Auf die Frage des Alten, ob er sich während der Wartezeit hinsetzen dürfe, nickt der Gameplayer ein wenig und weist dem Besucher selbstgefällig einen Platz an seiner Seite an, begründet mit der lakonischen Anmerkung, sein nun neuer temporärer Nachbar sei der erste normale Mensch, dem er hier unter all diesen schrecklichen Hippies begegne.
Der Popo gehört zu einem etwa zehnjährigen Jungen namens Sunny (Cédric Van den Abbeele), der nach Ankunft im kroatischen, chaotisch wimmelnden Woodstock-Heerlager des Friedens sich in aller Ruhe vor dem Wohnmobil platziert hat, das der temporäre Hippietransportunternehmer Mario Dockers aufsucht, da er mit der Organisatorin Miranda einiges regeln möchte, da einiges nicht seinen Vorstellungen von Regeln und Ordnung entspricht, etwa eine mittels geschmissenem Stein zerstörte Scheibe seines Busses. Der Besitzer des entzückenden Hinterns sitzt auf demselben und dippelt mäßig engagiert, aber routiniert auf einem kleinen Computerspielgerät herum, mit dem man Männchen erschießen kann. Es handelt sich um jenen Sohn namens Sunny, der zu Beginn der Abreise in Antwerpen noch in der fahrbaren Kleinwohnung schlief. Es könne dauern, bis die Frau Mama erscheine, er wisse es nicht. Auf die Frage des Alten, ob er sich während der Wartezeit hinsetzen dürfe, nickt der Gameplayer ein wenig und weist dem Besucher selbstgefällig einen Platz an seiner Seite an, begründet mit der lakonischen Anmerkung, sein nun neuer temporärer Nachbar sei der erste normale Mensch, dem er hier unter all diesen schrecklichen Hippies begegne.
Es würde den hiesigen Rahmen sprengen, ginge der Filmbeobachter auf jede Einzelheit dieses an in jeder Hinsicht komischen Details überreichen Films ein, der sich überdies durch seine naht- und bruchlose, flüssige Erzählweise auszeichnet, die dramaturgisch ausgefeilt der Logik dieses subkulturellen Alltags Folge leistet, lediglich hin und wieder durchbrochen von den Marotten eines brummigen, sich bürgerlich-anständig gerierenden Miesepeters. Deshalb sei vor allem auf die Essenz dieser Komödie eingegangen, die, was an der Natur dieses Genres liegt, sofern es sich um eine gelungene handelt: Alles dreht sich um eine tiefernste Angelegenheit. Nicht allein von einem Generationenkonflikt ist sie bestimmt, den hat es ohnehin immer gegeben und wird es immer geben. Auch das Streben nach einer besseren, weil friedlicheren, nicht von Konsum und sonstigen Zielrichtungen eines ausufernden Kapitalismus beherrschten Gesellschaft ist nicht unbedingt ein neueres Thema, jedenfalls nicht erst seit den sechziger Jahren, als es sich via Aldous Huxley, Ken Kesey bzw. Timothy Leary, zumindest in den USA herumgesprochen hatte, LSD sei ein wirksames Mittel gegen die Übel dieser Welt; es wird erst dann erschöpft sein, wenn ›Love and Peace‹ sich durchgesetzt haben sollten. Raf Reyntjens umspinnt als Drehbuchautor und Regisseur mit seinem Kokon Paradise Trips eine Familientragödie.
Als Sunny den alten Busfahrer fragt, ob er Kinder habe, verneint der es. Die Gegenfrage, wer sein Vater sei, beantwortet der Zehnjährige lapidar, der sei ein Versager, ein Krimineller, der bereits im Gefängnis gesessen habe. Dabei handelt es sich jedoch, der Filmbeobachter beginnt es recht bald zu ahnen, bei diesem Versager und Kriminellen um den Sohn des Busunternehmers Mario Dockers, um Jim Dockers (Jeroen Perceval). Der immer Gesetz und Ordnung achtende Vater Mario war es, der seinen Sprössling wegen Drogenhandels bei der Polizei angezeigt hatte, also aus ihm erst einen Kriminellen gemacht hatte.
 Überhaupt stellt sich im letzten Drittel des Films als höchst gelungene Überraschung heraus: Der paradiesische Trip war von Marios Frau Linda als Wiedervereinigung geplant, gemeinsam mit Miranda, der Mutter von Sunny und Frau des Versagers Jim, einem unbedingt friedenswilligen, unerbittlichen Gegner des Konsumismus‘, der nicht einmal einen Schluck Coca Cola in sich hineinlässt und seinen Sohn einen Kapitalisten heißt, allein deshalb, weil der diese braun gefärbte Limonade und Burger und Fritten von McDonalds bevorzugt, meist versorgt durch Mama. Auch dem gewöhnlichen Alltag gegenüber, etwa des wohnwagenhäuslichen Abwaschs durch seine Frau, die gerade schwere Wasserkanister angeschleppt hatte, zeigt Jim sich ungehalten ablehnend, vor allem, wenn er sich dadurch in seiner Meditation gestört fühlt.
Überhaupt stellt sich im letzten Drittel des Films als höchst gelungene Überraschung heraus: Der paradiesische Trip war von Marios Frau Linda als Wiedervereinigung geplant, gemeinsam mit Miranda, der Mutter von Sunny und Frau des Versagers Jim, einem unbedingt friedenswilligen, unerbittlichen Gegner des Konsumismus‘, der nicht einmal einen Schluck Coca Cola in sich hineinlässt und seinen Sohn einen Kapitalisten heißt, allein deshalb, weil der diese braun gefärbte Limonade und Burger und Fritten von McDonalds bevorzugt, meist versorgt durch Mama. Auch dem gewöhnlichen Alltag gegenüber, etwa des wohnwagenhäuslichen Abwaschs durch seine Frau, die gerade schwere Wasserkanister angeschleppt hatte, zeigt Jim sich ungehalten ablehnend, vor allem, wenn er sich dadurch in seiner Meditation gestört fühlt.
Es sei deshalb von allen diesen ungemein zahlreichen, abwechslungsreichen und vielfältigen Szenen eine herausgegriffen, nicht zuletzt, da sie am ehesten das beschreibt, wie es im Programmheft ›Paradise Trips‹ trefflich charakterisiert ist: »Ein Film über den ›Clash of Cultures‹ inmitten derselben Kultur, über Jung und Alt, über Urteile und Vorurteile, Väter und Söhne – vor allem aber darüber, dass es nie zu spät ist, noch mal von vorne anzufangen.«
Mario Dockers, der zwischendrin diverser Ärgernisse wegen und weil er sich in dieser wirren Umgebung schlicht nicht zurechtfand, sogar wutentbrannt mit seinem Bus weggefahren, aber dann wieder zurückgekehrt war, auch wohl deshalb, da seine Frau Linda zu Hause in Antwerpen das Telefon nicht abnahm, hatte sich innerlich gesetzt, nicht zuletzt aufgrund zweier Gespräche mit einer etwa gleichaltrigen, außerordentlich gelassenen, nichts als die Menschen, das Leben und die Liebe liebenden Frau mit dem vielleicht etwas zu karikaturistischen, andererseits sie auch wieder exzellent beschreibenden Namen Esmeralda (Marie Louise Stheins), neben die sich der Filmbeobachter gerne sofort auf deren Sofa des Friedensheerlagers gesetzt hätte, die man sich als klassische, keiner Blutsverwandtschaft, sondern der Menschheit an sich anhängenden Hippiemutter, vielleicht als eine der ersten Generation vorstellen mag. Sie lässt ihm von einer in diesem Umfeld ungewöhnlich, weil gänzlich unflippig, eher konventionell gekleideten und frisierten, ausgesprochen schönen jungen Frau, der das Glück über die baldige Mutterschaft ins wohl ohnehin liebreizende Gesicht geschrieben steht, eine prächtige vegetarische, nein, vegane Mahlzeit servieren und beschreibt dem davon nicht sonderlich Entzückten genüsslich die einzelnen Gemüsesorten, die wohl chemiefreien flämischen Äckern entwachsen, aber auf Marios Teller noch nie vorgekommen sein dürften. Doch die beiden trinken auch Bier miteinander, aus Dosen, und sie leeren einige. Mario gerät in eine gewisse Sprachlosigkeit. Doch man müsse, so seine Gesprächspartnerin, schließlich auch nicht immerzu reden. Auf Esmeraldas Empfehlung hin wankt Mario sogar auf den riesigen Tanzplatz, der der rituellen Anbetung der Techno- und Friedensgötter dient, und beginnt, wenn auch anfänglich vielleicht etwas zu zögerlich, sich rhythmisch leicht zu den dann (zwischenzeitlich) überschallauten Tönen zu bewegen. Als ihm ein mit einem indianischen Federschmuck versehener Tänzer eine Flasche hinhält, deren Inhalt wie Bier aussieht, was Marios gewohntem Geschmack nahezukommen scheint, nimmt er an und trinkt ausgiebig. Die im übrigen immer souverän geführte ruhige Kamera – überhaupt besticht der gesamte Film, für den Filmbeobachter tatsächlich ein wenig überraschend, durch seine Ruhe, keinerlei wilde Rhythmen suggerierenden Schnellschnitte sind zu sehen, die zwischenzeitlich anschwellende Lautstärke, begleitet von grelleren, teilweise sehr bunten Bildern, entspricht der Logik der in der Regel unterschiedlichen Hör- und Sehgewohnheiten zeitlich wie kulturell voneinander entfernter Generationen – zeigt in einer recht lang anhaltenden Einstellung den Getränkeanbieter in einer Art Lachanfall, neudeutsch wohl eher unter dem Begriff Lachflash bekannt, den Mario sicherlich gar nicht weiter deutet oder schlicht nicht wahrnimmt, da ihm ohnehin alles so ziemlich egal geworden zu sein scheint.
Die Begründung dafür wird direkt nachgeliefert: Die Sichtweise des Mannes, der in den Anfängen des Films durchaus in die Kategorie des besorgten und anständigen, gesetzes- und regelgetreuen, Bier, Beefsteak und Fritten bevorzugenden Bürgers eingeordnet werden darf, beginnt sich zu verändern, Farben und Formen beginnen zunehmend zu verschwimmen, die Umgebung sich zu bewegen, ein psychedelisches Bild erscheint, das er durchwandelt, dahinter ein seltsam, exotisch oder auch esoterisch anmutender Wald mit recht weit voneinander entfernten und doch gleichsam nahen, unwirklich erscheinenden, hochgewachsenen Stämmen, und mitten darin ein außergewöhnlicher, klar geformter Fliegenpilz, dem seitlich eine fadenähnliche Myzele anhängt, die die Assoziation einer Nabelschnur zulässt. Der unwirklich gelöste Mario durchgeht diese Landschaft voller Wunderlichkeit, als zunächst schemenhaft, dann in absoluter Klarheit der sogenannten Wirklichkeit sein Sohn sich ins Bild hineinentwickelt, der dem »schlimmsten Faschisten von Antwerpen« mit voller Wucht seine sich im Lauf der Zeit aufgestaute Wut ins Gesicht schlägt. Des Geprügelten Nase blutet daraufhin heftig, wie das im richtigen Leben wegen seines altersbedingten Bluthochdrucks tatsächlich häufig der Fall ist. Nach einem Umschnitt zeigt die Kamera in Nahaufnahme das Gesicht des vom Trip Heruntergekommenen friedlich auf einer sommerlichen Wiese liegend, auf der nicht mehr blutenden Nase sitzt ein außergewöhnlich schön gefärbter, bordeauxrot schillernder Schmetterling, in der Nähe wedelt der durch- und durch durchrasste Hund, der ihn immerzu irgendwie störte, freundlich mit dem Schwanz. Mario steht auf und geht gemächlich einige immer fester werdende Schritte, als er seinen Sohn auf einem Felsen sitzen sieht, den er dann lebensmutig um ein Gespräch bittet, das tatsächlich, wenn auch unter leichten Anfangsschwierigkeiten, in Gang kommt und an dessen Ende sich abzuzeichnen beginnt: Die Versuchsanordnung zur Schaffung der Geburt eines Hippies scheint funktioniert zu haben; die beiden klatschen sich verabschiedend ab, wie das die Jungen heutzutage zu tun pflegen, anstatt sich die Hand zu reichen. Ob das mit dem jungen Sunny auch gelingen wird, scheint allerdings fraglich. Denn der hatte seinem Vater Jim zuvor bereits für den Fall einer eventuellen Wiedervereinigung eine Bedingung abgerungen: wenigstens einen Schluck Coca Cola zu trinken. Der hat’s getan, und es war weitaus mehr als ein Schluck.
 Die Gesellschaft(en) haben sich ohnehin verändert, zumindest der Veränderungswille scheint sich, jedenfalls ausgerechnet in den kapitalistisch strukturierten, aber möglicherweise dieses Ersatzglaubens wegen nicht mehr so extrem Religionen verhafteten Ländern, umformiert zu haben. Allenthalben lehnen sich, vor allem, wie in diesem Spielfilm nahezu dokumentarisch gezeigt, jüngere Menschen auf, die diesen gleichförmigen, von politisch führenden Befürwortern des frei florierenden globalen Marktes geprägten Konsummechanismen nicht mehr folgen möchten. Noch vor wenigen Jahren war es beispielsweise unvorstellbar, es könnten sich so viele Menschen vom Automobil, vom Fleisch ab- und dem Tier als gleichberechtigt zuwenden. Es bleibt abzuwarten, ob es sich als eine Mode im Sinne eines heutzutage häufiger als in früheren Epochen rascher wechselnden Zeitgeistes erweist oder doch um eine anhaltende, nachhaltige – übrigens ein aus der Romantik stammender Begriff – Weltanschauung; für die früher der als positiv besetzte Begriff Zeitgeist stand, der sich in der deutschen Sprache mittlerweile eher zum Schimpfwort hin gewandelt hat.
Die Gesellschaft(en) haben sich ohnehin verändert, zumindest der Veränderungswille scheint sich, jedenfalls ausgerechnet in den kapitalistisch strukturierten, aber möglicherweise dieses Ersatzglaubens wegen nicht mehr so extrem Religionen verhafteten Ländern, umformiert zu haben. Allenthalben lehnen sich, vor allem, wie in diesem Spielfilm nahezu dokumentarisch gezeigt, jüngere Menschen auf, die diesen gleichförmigen, von politisch führenden Befürwortern des frei florierenden globalen Marktes geprägten Konsummechanismen nicht mehr folgen möchten. Noch vor wenigen Jahren war es beispielsweise unvorstellbar, es könnten sich so viele Menschen vom Automobil, vom Fleisch ab- und dem Tier als gleichberechtigt zuwenden. Es bleibt abzuwarten, ob es sich als eine Mode im Sinne eines heutzutage häufiger als in früheren Epochen rascher wechselnden Zeitgeistes erweist oder doch um eine anhaltende, nachhaltige – übrigens ein aus der Romantik stammender Begriff – Weltanschauung; für die früher der als positiv besetzte Begriff Zeitgeist stand, der sich in der deutschen Sprache mittlerweile eher zum Schimpfwort hin gewandelt hat.
Auch die Elle der sechziger, siebziger Jahre ist nicht mehr anzulegen, mit der sämtliche alten gesellschaftlichen Werte über Bord geworfen wurden wie beispielsweise die Ehe mit ihrer vor Amts- und Würdenträgern gelobten Treue bis in den Tod. Dennoch wird wieder geheiratet, wenn auch mittlerweile überwiegend von Männern oder Frauen innerhalb des gleichen Geschlechts. Andererseits, der Film- und Lebensbeobachter erinnert sich an ein noch nicht allzu lang zurückliegendes Gespräch, in dem Mitgliedern der ehemaligen, berühmt-berüchtigten Berliner Kommune 1, aus der heraus die außerparlamentarische Opposition, das neue deutsche Lotterleben der Nachkriegsgeneration schlechthin sich mit entwickelte, wie Rainer Langhans von zweien seiner Töchter von unterschiedlichen Müttern mitgeteilt wurde, man verlobe sich, und heiraten würde man ebenfalls, basta. Das widerspräche zwar dieser bemerkenswert köstlichen, aber auch nachdenklich machenden Utopie ›Paradise Trips‹.
 Andererseits ist die Liebe unter den Menschen, auf die Raf Reyntjes mit dieser belgisch-niederländischen Produktion verweist, schließlich kein Nicht-, sondern ein immerwährender Sehnsuchtsort, ob nun mit oder ohne Trauschein, ob immerwährend oder lediglich temporär. Er hat, wenn auch zunächst einmal im Kino, nachgewiesen, daß die den Frieden und das Miteinander liebenden Hippies möglicherweise diejenigen sind, auf die man bauen kann. Sie haben zumindest eine Familie wieder zusammengebracht und neue Freundschaften über Generationen entstehen lassen, und zwar, indem sie Gesetze außer Kraft gesetzt und Regeln unterlaufen haben.
Andererseits ist die Liebe unter den Menschen, auf die Raf Reyntjes mit dieser belgisch-niederländischen Produktion verweist, schließlich kein Nicht-, sondern ein immerwährender Sehnsuchtsort, ob nun mit oder ohne Trauschein, ob immerwährend oder lediglich temporär. Er hat, wenn auch zunächst einmal im Kino, nachgewiesen, daß die den Frieden und das Miteinander liebenden Hippies möglicherweise diejenigen sind, auf die man bauen kann. Sie haben zumindest eine Familie wieder zusammengebracht und neue Freundschaften über Generationen entstehen lassen, und zwar, indem sie Gesetze außer Kraft gesetzt und Regeln unterlaufen haben.
Die Schlusseinstellung des Films zeigt eine völlig überfüllte Autobahn, rechts ein Schild, das darauf hinweist, in België, also angekommen zu sein in diesem drangvoll beengten und beengenden Alltag, inmitten des ganzen Verkehrsaufkommens ein Bus mit der Aufschrift ›Paradise Trips‹. Man ist wieder zurück in dem ganzen Schlamassel. Doch für einige könnte er sich als ein veränderter, möglicherweise gar als das Paradies erweisen, beispielsweise für Linda, die ihre Familie samt Enkel und sonstigen Anschlüssen wieder beisammen und der ihr Gatte Mario telephonisch sogar zum ersten Mal seine Liebe erklärt hat.
Titelangaben
Paradise Trips
Mario Dockers: Gene Bervoets
Jim Dockers: Jeroen Perceval
Sunny: Cédric Van den Abbeele
Linda: Tania Van der Sanden
Miranda: Noortje Herlaar
Cindy: Linde Pillet
Lexander: Pieter Verelst
Walther: Pascal Maetens
Esmeralda: Marie Louise Steihns
Flora: Charlotte Timmers




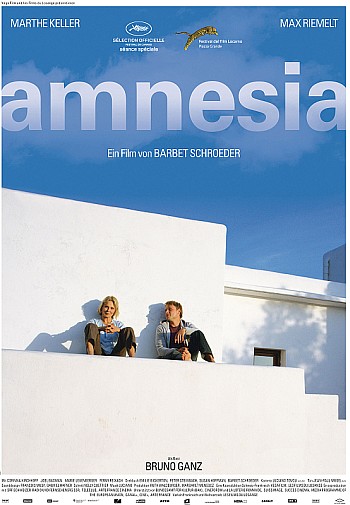
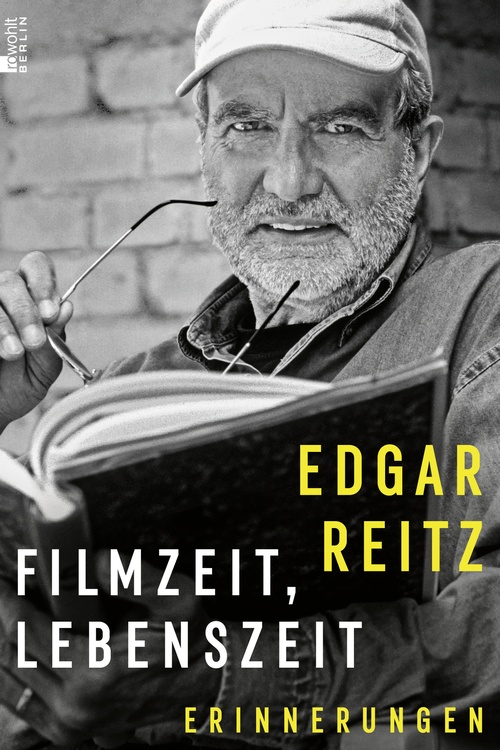

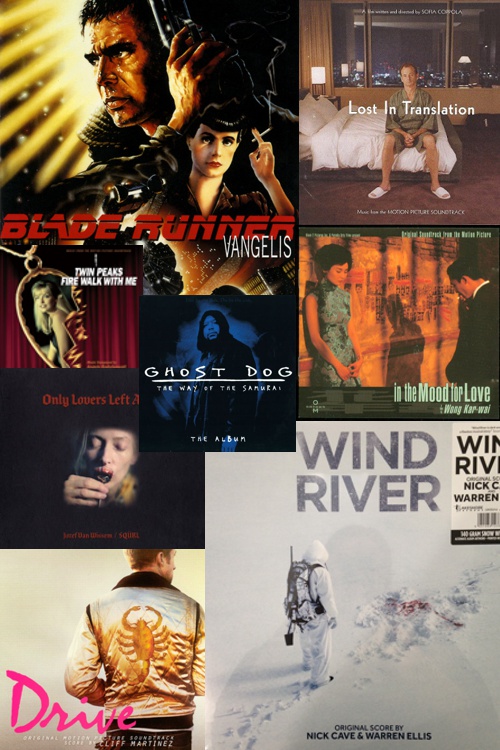
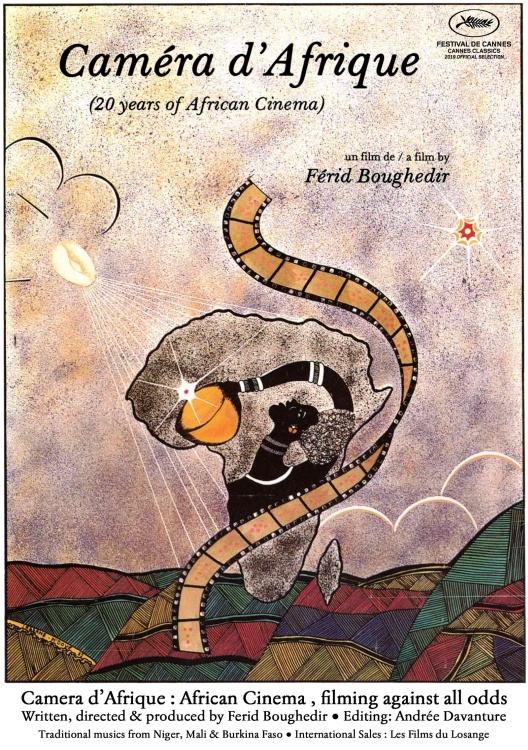


[…] Zuerst erschienen im Oktober 2915 in: https://titel-kulturmagazin.net/2015/10/22/auf-dem-trip/#more-15455 […]