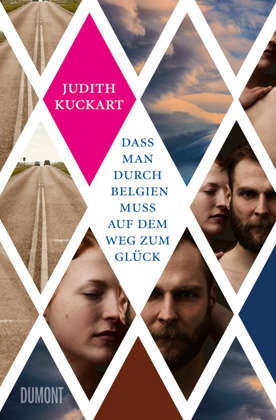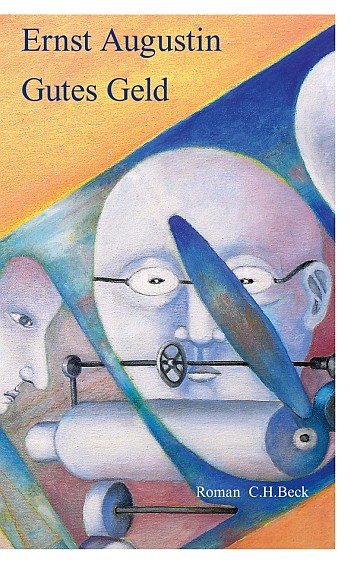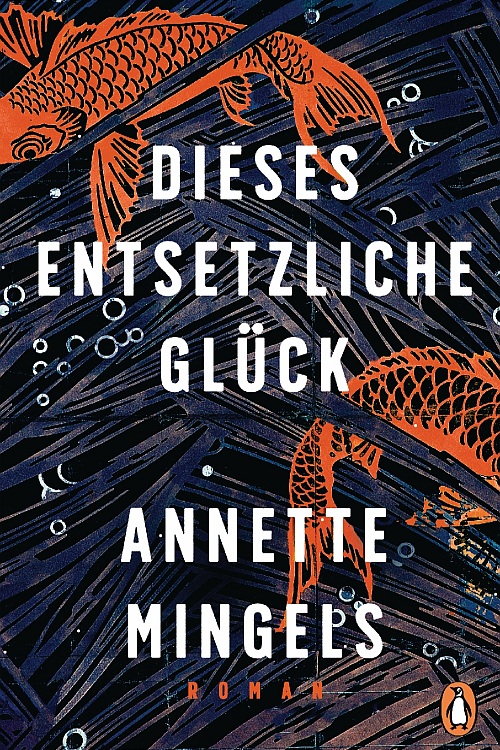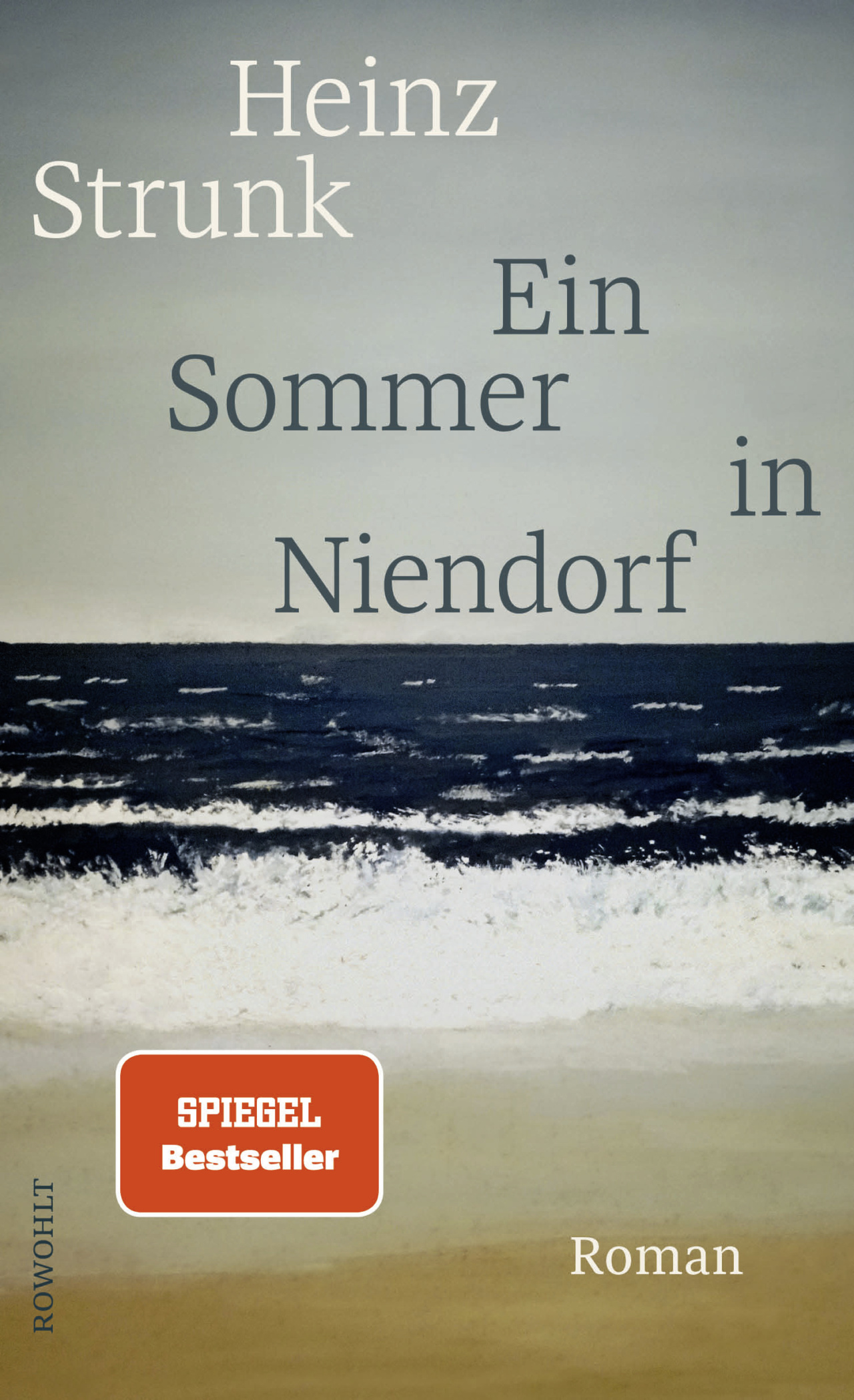Roman | Tanguy Viel: Das Verschwinden des Jim Sullivan. Ein amerikanischer Roman
Tanguy Viel schreibt seit einigen Jahren kürzere Romane. In seinem neuesten Buch ›Das Verschwinden des Jim Sullivan‹, das wieder bei Wagenbach erschienen ist, treibt er sein Spiel mit den »Kochrezepten« amerikanischer Schreibfabriken und führt diese ad absurdum. Sein »amerikanischer Roman« ist dennoch zutiefst französisch. Von HUBERT HOLZMANN
 Tanguy Viel, ein französischer Autor, der 1973 in der Bretagne geboren ist, improvisiert in seinem Roman über eine amerikanische »Urszene«: Der amerikanische Rockgitarrist Jim Sullivan, der in den späten 60ern mit seinem Album ›U.F.O.‹ debütiert hat, verschwindet im Jahr 1975 plötzlich in der Wüste von New Mexico. Allein sein VW-Bus wird nach einiger Zeit gefunden, mit Sullivans Gitarre. Vom Musiker fehlt jede Spur. Für seine Fans der Beginn eines Mythos: Wurde Sullivan von einem UFO abgeholt?
Tanguy Viel, ein französischer Autor, der 1973 in der Bretagne geboren ist, improvisiert in seinem Roman über eine amerikanische »Urszene«: Der amerikanische Rockgitarrist Jim Sullivan, der in den späten 60ern mit seinem Album ›U.F.O.‹ debütiert hat, verschwindet im Jahr 1975 plötzlich in der Wüste von New Mexico. Allein sein VW-Bus wird nach einiger Zeit gefunden, mit Sullivans Gitarre. Vom Musiker fehlt jede Spur. Für seine Fans der Beginn eines Mythos: Wurde Sullivan von einem UFO abgeholt?
Um diese kurze Nachricht konstruiert er seinen Text, zieht seine Kreise mit immer größerem Radius. So rückt sich Viel zunächst in seiner Pariser Schreibstube den neuen Stoff zurecht. Sein Plan ist es, auch einmal einen Roman zu schreiben, der über Frankreichs Grenzen hinaus gelesen wird. Also muss ein internationaler Roman her. Der Erzähler Viel sinniert über die Weite Amerikas und vergleicht sie mit der kleinen französischen Welt.
Bilder aus der »Neuen Welt«
Es sind immer dieselben scheinbar romantischen Bilder von den französischen Städten, die er zu überwinden versucht: »in Frankreich haben wir, das muss man schon zugeben, mit der unangenehmen Tatsache zu tun, dass es in mehr oder weniger allen Städten Kathedralen gibt und ringsum Straßen mit Kopfsteinpflaster, die die internationale Dimension der Örtlichkeiten zerstören und einen daran hindern, sich zu einer globalen Betrachtung der Menschheit aufzuschwingen«.
Ein großes Vorhaben – als erstes wird also sein Arbeitszimmer mit einer Amerika-Karte tapeziert. Denn der Erzähler wird den Pazifik keineswegs überqueren, etwa dort auf dem anderen Kontinent Studien betreiben, die Mentalität der Menschen in der neuen Welt erforschen oder Landschaftsbilder vor Augen haben. Nein. Er holt kurzerhand die fremde Welt in seine Schreibstube. Die Bilder von drüben sind nämlich schon alle in seinem Kopf – oder besser in seinem »Bücherschrank«, in dem »mittlerweile mehr amerikanische als französische Romane« stehen.
Also konstruiert der Erzähler – Tanguy Viel könnte sich durchaus hinter dieser Figur verbergen – seinen Text auf dem Reißbrett. So wie auch schon manche amerikanische Stadt geplant wurde. Schnell hat der Autor eine Stadt gefunden, einen Helden bestimmt und einen Plot gewählt. Viel wählt einen Mann aus der Mittelklasse. Er ist Dwayne Koster, ein Unidozent für amerikanische Literatur, der aus beruflichen Gründen mit seiner Frau und den Kindern in die Automobilstadt Detroit zieht, die nach den frühen Jahren des Aufschwungs mittlerweile von Arbeitslosigkeit und Armut geprägt ist. Dort wird ihm nach ein paar glücklichen Jahren ein Abenteuer mit einer sehr jungen Studentin zum Verhängnis. Die Beziehung mit seiner Frau Susan geht in die Brüche und Dwayne selbst stürzt gesellschaftlich total ab, wird zum Alkoholiker und stalkt seine Exfrau.
Moby Dick und Tennyson
Dwayne Koster ist dabei ein durchschnittlicher amerikanischer Charakter. Wie John Williams Stoner ist es auch Tanguy Viels Held, der ebenfalls aus der Provinz stammt, gewohnt, Niederlagen einzustecken. Natürlich wurmt es ihn, dass ein neu berufener Uniprofessor, der die Aufmerksamkeit aller Studenten auf sich zieht, viel mehr Erfolg als Dwayne hat. Sogar Dwaynes Frau Susan ist von Dwaynes Konkurrent angetan. Auch die Affäre mit der kleinen Studentin wird für Dwayne zur Katastrophe. Was will auch eine junge Frau von dem alternden, mehr oder minder eher erfolglosen, unerotischen Alten?
Imposant ist allerdings die Hartnäckigkeit, mit der Dwayne gegen sein Schicksal ankämpft. Dass Dwayne Vorlesungen über den Autor von ›Moby Dick‹, Herman Melville, hält, ist kein Zufall. Ebenfalls ein von Viel durchaus bewusst gewähltes literarisches Motiv ist der berühmte Fensterblick von Alfred Lord Tennyson aus ›Enoch Arden‹: Wie der Enoch, der nach einer langen Seefahrt als Verschollen gilt, kann auch Dwayne als Ausgestoßener und verkrachte Existenz seine ehemalige Familie aus der Entfernung durch das Wohnzimmerfenster beobachten. Dwayne sieht wie der Seemann Enoch zu seinem Unglück seine Frau, die glücklich von einem anderen Mann umarmt wird. Dann natürlich die großen Autos, die Gartenpartys, die Überschuldung der Menschen. So weit also das typisch Amerikanische.
Frankreich – USA
Was ist nun aber an dieser Geschichte das eigentlich Französische, das sich da in den amerikanischen Way of Life mischt? Natürlich denkt man sofort an das Spiel mit den typischen Klischees: die Affäre, die Reflexion des Erzählers oder auch das Muster und der Spielplan, dem die Erzählung folgt. Vielleicht ist es auch die offensichtliche Ironie, die der Erzähler gerade dadurch erzeugt, dass er ständig zwischen den Ebenen des Erzählers, der Haupthandlung und der Story um Jim Sullivans Verschwinden hin- und herwechselt. »Doch all das, schrieb ich, all diese Dinge, die er wie im Traum durch die Windschutzscheibe seines Dodge sah, waren sozusagen an einem sehr fernen Ort verschlossen, ein früheres Leben, von dem auf seinem Gesicht nur noch die unauslöschliche Trauer blieb.«
Dem Leser wird die Geschichte von Dwayne Koster im eigentlichen Prozess der Entstehung erzählt. Der Leser bekommt die Skizzen präsentiert, die Vorüberlegungen und die Kulissen, die Tanguy Viel aufstellt. Man darf lesen, was der Erzähler »schreibt«, sich »ausmalt«, wie er die Hauptfigur »versucht zu verstehen«. Was sich da also zunächst als schnelle Skizze präsentiert, erweist sich dann als große psychologische Studie, eingestreute »Flash backs« geben Einblicke in die Hauptfigur, lassen zurückblicken auf familiäre Prägungen und Grunderfahrungen und versuchen nicht zuletzt Dwaynes großes »Fade off« zu erklären. Und alles vor einer großen amerikanischen Kulisse: Kennedy, Vietnam-Krieg und auch »11/9« sind kleine historische Stationen.
Das Ende ist Pathos. Wie Jim Sullivan macht sich auch Dwayne Koster auf den Weg in die Wüste. Er reist seinem Musikidol in den Süden nach. Wie sein Vorbild wohnt er im selben Motel in Nashville. In Jims Song U.F.O. (1969) lauten die Schlussverse »I’m checking out the show with a glassy eye. / Lookong at the sun dancing through the sky. / Did he come by UFO?« Gibt es bei Tanguy Viel dieses undefinierte Objekt? Oder wird sein Erzähler nicht einfach wieder von der französischen Wirklichkeit eingeholt? Das Verschwinden des Jim Sullivan – eine literarische Narretei. Auf jeden Fall auch in der deutschen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel ein kurzweiliges Lesevergnügen.
Titelangaben
Tanguy Viel: Das Verschwinden des Jim Sullivan
Ein amerikanischer Roman
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Berlin: Wagenbach Verlag 2015
128 Seiten. 16,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander