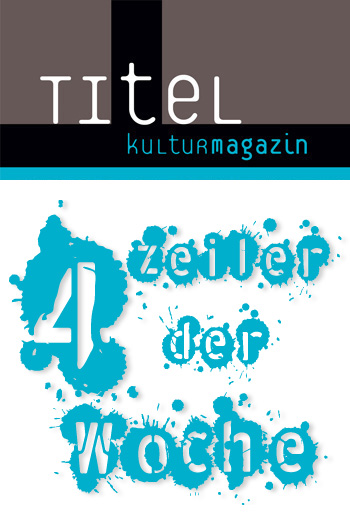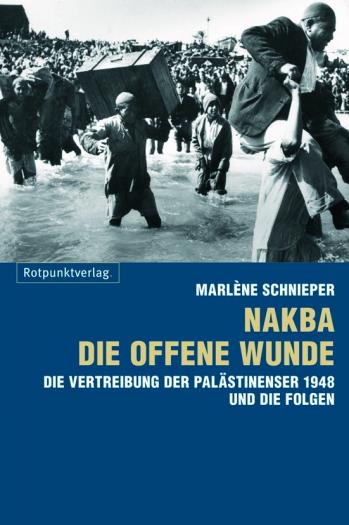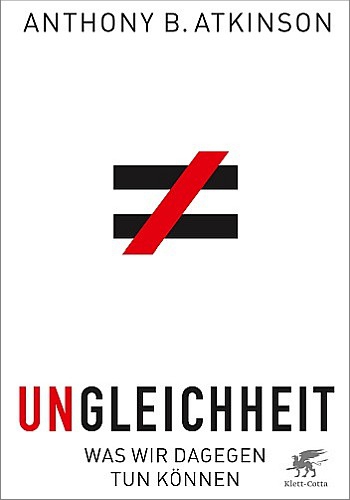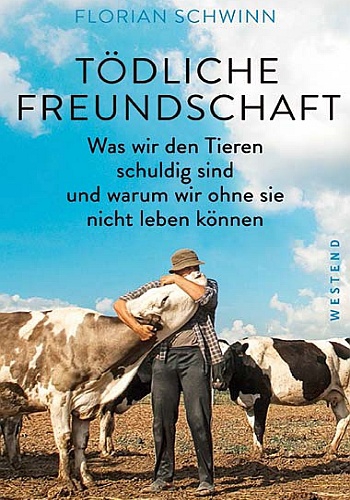Gesellschaft | Marceline Loridan-Ivens: Und du bist nicht zurückgekommen
Sie lesen gerne in der Bahn oder im Bus auf dem Weg zur Arbeit? Und das kleine »Büchelchen« mit den 110 Seiten scheint Ihnen eine gute Lektüre zu sein? Vielleicht überdenken Sie dies noch einmal, oder weinen Sie gerne in der Öffentlichkeit? TANJA LINDAUER über Marceline Loridan-Ivens Roman ›Und du bist nicht zurückgekommen‹.
 78750: eine Zahl, ein Relikt, das von unfassbaren und unvorstellbaren Qualen und einer Brutalität erzählt, die man für unmöglich hält. Sie prangt am Arm, und erinnert jeden Moment an unmenschliche Gräueltaten, die keiner Gedächtnisstütze bedürfen. Und doch ist genau dies geschehen, als Hitler die Macht ergriff. Sie ist tief verwurzelt in der Seele und nagt stetig an ihrer Besitzerin.
78750: eine Zahl, ein Relikt, das von unfassbaren und unvorstellbaren Qualen und einer Brutalität erzählt, die man für unmöglich hält. Sie prangt am Arm, und erinnert jeden Moment an unmenschliche Gräueltaten, die keiner Gedächtnisstütze bedürfen. Und doch ist genau dies geschehen, als Hitler die Macht ergriff. Sie ist tief verwurzelt in der Seele und nagt stetig an ihrer Besitzerin.
Diese Zahl wird die französische Filmemacherin Marceline Loridan-Ivens immer an ihre Vergangenheit im KZ erinnern. Doch nicht nur da, auch im Gedächtnis ist sie tief verwurzelt, so tief, dass die 87-Jährige nun ihre Erfahrungen schildert, schonungslos, erschütternd und zutiefst ehrlich. Sie war 15, als sie und ihr Vater deportiert wurden. Froim Rozenberg kam nach Auschwitz, Marceline nach Birkenau. Getrennt und doch in ihrem Schicksal vereint. Kurz vor seinem Tod konnte der Vater seiner Tochter noch eine Botschaft zukommen lassen, auf einem Fetzen Papier. Sie hütete es wie einen Schatz, doch an den Inhalt kann sie sich nicht mehr erinnern. Jetzt, 70 Jahre später, beantwortet sie den Brief: »Und du bist nicht zurückgekommen«.
Vom Überleben und Weiterleben
In ihrem Brief an den Vater erzählt die Französin schonungslos vom Leben und Überleben im KZ. Der Geruch von Tod, der Stacheldraht, die Krankheiten, die Gräueltaten oder vom »Kommando Kanada«, wo sie die Kleider der Toten sortieren muss. Doch sie erzählt auch, wie das Leben nach dem KZ ist. Sie schläft auf dem harten Boden, die Weichheit eines Bettes erscheint ihr unerträglich. Sie stößt auf Unverständnis, die Mutter, die verschont blieb, möchte ein normales Leben weiterführen. Sie möchte die Augen fest verschließen. »Erzähl ihnen nichts, denn sie verstehen es nicht.«
Das lernt Marceline schnell, doch ein normales Leben führen, das scheint ihr unerträglich, unmöglich. »Ich mag meinen Körper nicht. Es ist, als trüge ich immer noch die Spur den ersten Blick eines Mannes auf mir, eines Nazis. Nie zuvor hatte ich mich nackt gezeigt.« Mengele entschied so über den Gesundheitszustand und entschied über Leben und Tod. »Deshalb war das Entkleiden lange Zeit für mich mit dem Tod verbunden. […] Ich habe nie Kinder gehabt. Ich habe nie welche gewollt. Du hättest es mir vorgeworfen. Der Körper der Frauen, der meine, der meiner Mutter, der aller anderen, deren Bauch anschwillt und sich dann leert, ist für mich von den Lagern endgültig entstellt worden. Mir graut vor dem Fleisch und seiner Elastizität. Dort habe ich die Haut, die Brüste, die Bäuche zusammensacken sehen …«
»Man erfriert von innen her, um nicht zu sterben«
Das Buch ist mehr als ein Stück Zeitgeschichte, es ist eine Aufarbeitung, eine Erinnerung und Ermahnung. Es berührt und erschüttert bis ins Mark. Es ist ein ehrliches Buch und eine Liebeserklärung an den Vater. Und es ist noch so viel mehr. Und auch, wenn 100 Seiten schnell gelesen sein mögen, sie sind es nicht. Man hält inne, ringt nach Luft und auch Tränen können fließen: Dieses Buch verlangt alles vom Leser ab. Eine unbedingte Leseempfehlung!
| TANJA LINDAUER
Titelangaben
Marceline Loridan-Ivens: Und du bist nicht zurückgekommen
Berlin: Suhrkamp 2015
111 Seiten. 15 Euro
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe