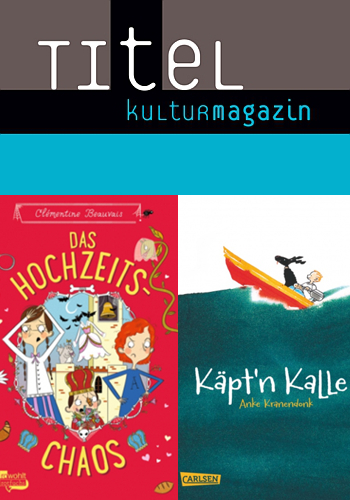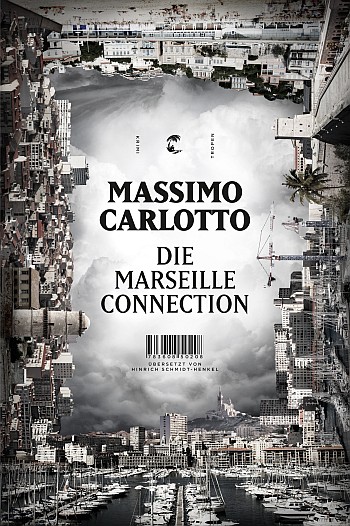Roman | Paul Murray: Der gute Banker
Mit Skippy stirbt (2013 auf Deutsch) hatte Paul Murray eine herzzerreißend komische Variation auf das Genre Internatsroman hingelegt. Jetzt hat er sich das Caper-Novel-Genre, den heiter-leichten bis galgenhumorigen Gaunerroman, vorgeknöpft und das – laut angelsächsischen Kritikern – witzigste Buch über die europäische Finanzkrise geschrieben. Oder über griechische Schulden? Französische Modephilosophie? Was ist ›Der gute Banker‹ denn nun? Von PIEKE BIERMANN
 »Man muss die Leute da abholen, wo sie zu treffen sind!« Dieses Gesetz befolgen gewiefte Politiker, Waren- und Werbefirmen ebenso wie Hochstapler und Betrüger seit eh und je – und Schriftsteller inzwischen auch. Denn selbst eher als anachronistisch empfundene Leser von Büchern sind heute Leute, die »mitgenommen« werden wollen, die mitmischen wollen beim digitalen Interaktivismus. Was macht also ein gewiefter Schriftsteller, wenn er a) keine Game-Shows, sondern weiter Romane verfassen will, aber b) seine Leser nicht mitschreiben lassen möchte, sondern lieber allein schreibt? Er inszeniert eine Mitmach-Fiktion, ein Meta-Mitspiel.
»Man muss die Leute da abholen, wo sie zu treffen sind!« Dieses Gesetz befolgen gewiefte Politiker, Waren- und Werbefirmen ebenso wie Hochstapler und Betrüger seit eh und je – und Schriftsteller inzwischen auch. Denn selbst eher als anachronistisch empfundene Leser von Büchern sind heute Leute, die »mitgenommen« werden wollen, die mitmischen wollen beim digitalen Interaktivismus. Was macht also ein gewiefter Schriftsteller, wenn er a) keine Game-Shows, sondern weiter Romane verfassen will, aber b) seine Leser nicht mitschreiben lassen möchte, sondern lieber allein schreibt? Er inszeniert eine Mitmach-Fiktion, ein Meta-Mitspiel.
Paul Murray ist ein irischer Erzähler mit gediegener Bildung und meisterlicher Absolvent eines Kreativschreib-Studiums. Seinen neuen, dritten Roman eröffnet er mit der Ansage, er habe da eine Idee. Er reißt sie kurz an, skizziert eine Hauptfigur, ein Plot-Skelett, einen Handlungsort, wirft dem Leser ein paar zeitgeistig gut vertäute und nachweislich bewährte Spannungselemente hin – Geld plus Gier, Sex, Crime … Und schon hat er ihn abgeholt: bei seiner Lust, an der auktorialen Omnipotenz des Autors teilzuhaben. Derart mitgenommen merkt der Leser gar nicht, dass ihm der Autor mit der rhetorischen Frage: »Was meinen Sie? Kauft mir das jemand ab?«, soeben die Verantwortung dafür aufgehalst hat.
Here Comes Everybody 2.0
Folgt die Probe aufs Exempel – als Doppelung. Denn just dasselbe Spiel treibt ein Dubliner Schriftsteller namens Paul, ohne Nachnamen, mit Claude Martingale, jenem angerissenen Protagonisten. Claude, Franzose mit Philosophiestudium, arbeitet im Dublin des quasi-steuerfreien Finanzbooms als Analyst bei der BOT, der Bank of Torabundo. Die BOT befindet sich in der »Metamorphose von einem kleinen Player zu einer unaufhaltsamen Macht im Bankenwesen«, ist also demnächst too big to fail.
Ausgerechnet diesen mittleren Bankschwengel, der »die Tage im Dienst des Geldes« verbringt, die Nächte dito, der »keine Freunde, keine Hobbys, kein Leben außerhalb der Bank« hat, hat Paul zum modernen Jedermann erkoren, über ihn will er seinen zweiten Roman schreiben. Claude ist von der Idee ebenso hingerissen wie seine Kollegen und Vorgesetzten. Er verschafft Paul Zugang zum Bankinnern und kriegt ewig nicht mit, dass Paul in seiner grotesken Geldklemme nicht wirklich einen Roman plant. Dafür fühlt sich der gute Claude, der weiß, wie Armsein geht, weil er selbst ein mühsam aufgestiegenes Arbeiterkind ist, viel zu verantwortlich – zuerst für das Gelingen des Romans und bald gleich für Pauls gesamte kreative Potenz.
Wille zu Witz & Wortspiel
Der gute Banker ist der altbewährte Roman im Roman, erzählt von der persona ficta eines ebenso gefaketen Autors. Eine Meta-Meta-Fiktion aus immer neuen Metaebenen, Twists, Querverweisen und Würfeleien mit Realitäts- und Kulturbausteinen: Paul spintisiert, er werde aus seinem Claude Jedermann »Joyces Ulysses II« machen, und diesmal als Krimi, der das Genre aus den Angeln hebt; ein angeblich verschwundener, also geheimnisvoller Pariser Philosoph namens François Texier wird zur wandelnden Paraphrase derridadaesker Simulacra-Theoreme; die Bilder einer kellnernden Malerin erinnern »entfernt an ein Kreuzworträtsel beim Sex mit einem Tortendiagramm« und heißen »Simulacrum Nr. XY« … Claudes Nachname Martingale schließlich ist Kasino-Hazardeuren geläufig als die alte Roulette-Methode der systematischen Einsatzverdoppelung, die allen mathematischen Genies und Bank-Superrechnern zum Trotz scheitern muss …
Überhaupt, sprechende Namen. Die von Paul für Claudes Liebesleben eingeplante malende, kellnernde Griechin heißt vorn Ariadne (da beißt keine Maus den Faden ab – Pardon! Kalauer!) und hinten Acheiropoieton (wie eine nicht von Menschenhand verfertigte, ergo wundertätige Ikone); Pauls russischer Komplize, vorgestellt als Poet und Professor für zeitgenössische Kunst und unverkennbar tumb, vulgär und oversexed, heißt Igor Struma (klingt irgendwie wie Duma, ist aber Kropf auf Medizinlateinisch); die Kritikerin, die Pauls erstes Buch verrissen hat, heißt Mary Cutlass (wie Buschmesser); der umgarnte Verlag heißt Asterisk, was jeder mit dem comicgewordenen Wortspiel assoziiert und der in alter Buchdruckkunst Bewanderte als * kennt. (Nein, das derzeit so hysterisierte Gender-Sternchen scheint nicht gemeint zu sein.)
Murrays Wille zu Witz & Wortspiel ist also unübersehbar und führt auch wirklich hin und wieder zu brüllendem Gelächter. Ebenso wie manche schönen Sprüche – zum Beispiel wenn die Banker jammern, dass sie von der Kunstwelt so wenig geehrt werden, obwohl sie doch die allermeisten Kunstwerke kaufen. Auch manche Seitenhiebe auf griechische Schulden & deutschen Sparwahn sitzen perfekt wie das Motto des neuen Oberbankers Porter Blankly: Kontraintuitiv sein!
SitCom-Dramaturgie ohne Dosenlacher
Aber leider zündet vieles nicht, weil Murray einfach too many words zu allem und jedem macht, auch zu Witzen. Die Übersetzung ist da leider kongenial, weil oft – anstatt zu verknappen und entfetten – noch (typisch deutsch) umständlicher. Auch satirisches finetuning fehlt hier und da – zum Beispiel bei dem Gemälde mit dem Titel »La Marque et le Vide«, das mit dem geheimnisvollen Texier zu tun hat und in englischer Übersetzung der Originaltitel des Romans ist: ›The Mark and the Void‹. Auf Deutsch wird daraus »Die Spur und die Leere«. Das klingt nach gar nichts, zumindest nicht nach Spott über franko-philosophische Terminologieblasen, den etwas wie »Zeichen und Vakuum« zumindest angedeutet hätte.
All das tut auch den Figuren auf Dauer nicht gut, sie geraten unter allzu viel Rabulistik aus Derivaten-Schnerivaten, Subprime-Schnappreim, Swaps und Swaptions zu flachen Karikaturen. Murrays Tour de Force durch die auf Lüge und Meta-Money basierende Geldwirtschaft mit ihren platzenden Blasen, failing states und protestcampenden Gegnern, durch Dublins multisexuelles Nachtleben und multiethnische Bevölkerung ist en gros perfekt geplottet, aber en détail oft unplausibel: Sind Banker derart treuherzig un-zynisch, Dinnergespräche zwischen Literaturagentin, Lektor, Kritikerin und Schriftstellern derart naiv un-taktisch?
Selbst die sorgfältigste auf Gag und Cliffhangerchen hin inszenierte Sitcom-Dramaturgie wird schnell fade, wenn das Lachen aus der Off-Konserve nicht kommt und der gewiefte Leser das als Romanrecherche getarnte Raubmotiv nach spätestens neunzig Seiten ent-tarnt hat. Also nochmal gefragt: Kauft einem das jemand ab? Aber ja doch, na klar! Ein grundsätzlich komischer Zugriff auf die öden, blöden Zeit- und Geld- und Bankläufte ist in jedem Fall willkommen. Und auch der gute alte Romanleser lässt sich nun mal gern abholen, schließlich ist er von dieser Welt, und die will bekanntlich betrogen sein.
Titelangaben
Paul Murray: Der gute Banker
Deutsch von Wolfgang Müller
München: Kunstmann Verlag 2016
526 Seiten, 25 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinhören
| Eine weitere Fassung war in ›Gutenbergs Welt‹ auf WDR 3 zu hören
Reinschauen
| Leseprobe