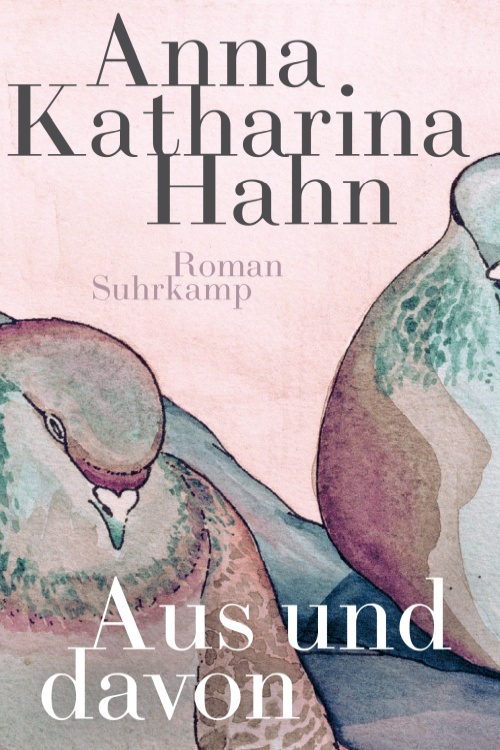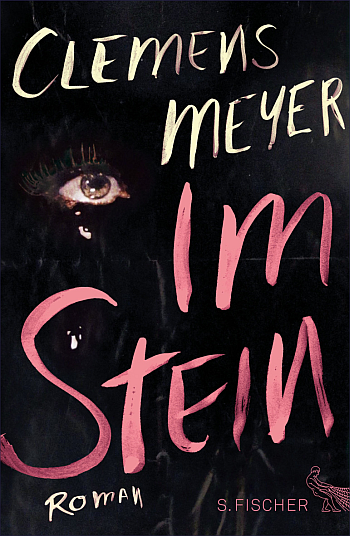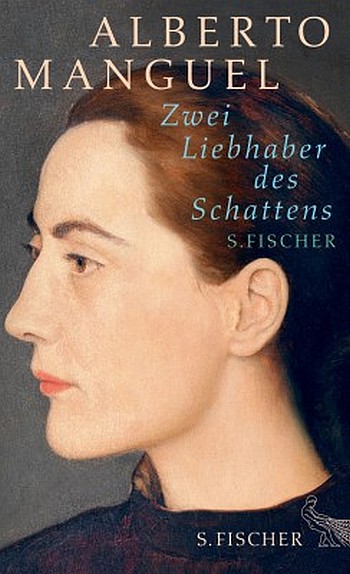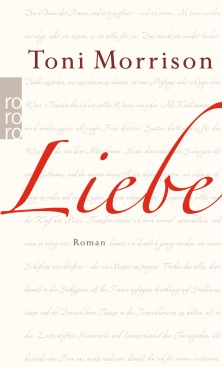Roman | Sophie Divry: Als der Teufel aus dem Badezimmer kam
›Als der Teufel aus dem Badezimmer kam‹ könnte für den ungewöhnlichsten Romantitel des Jahres nominiert werden. Preiswürdig und herausragend ist die Buchgestaltung ebenso. Denn in Sophie Divrys tragikomischem Prekariats-Roman kämpft eine arbeitslose Journalistin – ganz arme Poetin! – mit kreativen Methoden gegen Hunger, Langeweile und Verzweiflung an. Von INGEBORG JAISER
 Der soziale Abstieg erfolgt in Etappen. »Ich habe eine Phase durchgemacht, in der mein Einkommen um zwei Drittel schrumpfte und mein Wohnraum sich von achtzig auf zwölf Quadratmeter reduzierte«, gesteht die Ich-Erzählerin Sophie.
Der soziale Abstieg erfolgt in Etappen. »Ich habe eine Phase durchgemacht, in der mein Einkommen um zwei Drittel schrumpfte und mein Wohnraum sich von achtzig auf zwölf Quadratmeter reduzierte«, gesteht die Ich-Erzählerin Sophie.
Erst wird ihr die Festanstellung gekündigt, dann bleiben die Aufträge als freie Journalistin aus, schließlich geht das Arbeitslosengeld in Sozialhilfe über. Auch an diesen Zustand kann man sich gewöhnen. Doch als die Nebenkostennachzahlungen ihre mageren Ressourcen übersteigen, geht es wahrlich ans Eingemachte.
Luzider Alptraum
Sophie ernährt sich von Ravioli und Getreidekaffee, versetzt ihre literarischen Erstausgaben und überlegt sich, ob sie als nächstes den Toaster oder den Entsafter bei Ebay versteigern soll. Ja, es macht sich genüsslich breit, »dieses große, schlaffe, grausame, klebrige, ekelhafte Biest namens Bedürftigkeit, diese verfluchte Hungertuchnagerei und Kirchenmäusigkeit.« So oft sie auch ihren Maileingang und ihren Kontostand checkt, es geschehen keine Wunder.
Porös vor Hunger und pekuniären Albträumen fiebert, fantasiert und fabuliert sich Sophie durch Speisefolgen und Essenseinladungen. Doch selbst eine Familienfeier bietet nur kurzfristige Erlösung. »Das frische Brot plumpste mir in den Magen wie Rettungsringe, die man einem Menschen zuwirft, wenn er über Bord gegangen ist.« Schon anderntags liegt Sophie mit rebellierenden Gedärmen gequält zu Bette. So eindringlich hat seit Knut Hamsun niemand über Hunger geschrieben.
Sprechender Toaster
So weit, so tragikomisch. Denn Sophie weiß ihrer Misere durchaus auch humorvolle Seiten abzuringen. Sei es im abstrusen Mailverkehr mit ihrem platonischen Freund Hector (einem sexbesessenen, ebenfalls arbeitslosen Musiker), sei es im Kampf gegen den imaginierten Teufel Lorchus, dessen Verlockungen an allen Ecken lauern. Denn auch als arme Poetin gelüstet es einen nach unvernünftigen Genüssen.
Da treibt Sophies ausgehungerter Geist seltsame Kapriolen, entlädt sich in den Wehklagen des Toasters, in träumerischen Nebenschauplätzen und verworrenen Seitensträngen neuer Geschichten. So zerfließt die Binnenerzählung langsam in Meta-Meta-Ebenen und verliert genüsslich den roten Faden. Das dürfte nicht jeden Lesers Geschmack treffen und manchen zum Lektüreabbruch verleiten. Aber beschwere sich keiner: Der Untertitel war Warnung genug!
Konkrete Poesie und rabenschwarze Icons
Dennoch birgt Sophie Divrys Prekariatsroman – neben den eindringlichen Schilderungen sozialer Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit, Armut und bürokratische Schikanen – auch große Überraschungen: das sorgsam gestaltete Buch wartet mit einem wahren Feuerwerk an kreativen Wortneuschöpfungen und konkreter Poesie, an experimentellen Layouts und inszenierter Typographie auf. Eine gewaltige Herausforderung für die Buchgestalterin Annika Preyhs und die Übersetzerin Patricia Klobusiczky.
Wer einen neugierigen Blick in ihre Arbeitswerkstätten erhaschen möchte, sollte daher unbedingt die auf rabenschwarzem Papier gedruckten Bonusseiten konsultieren. Der Teufel lässt grüßen!
Titelangaben
Sophie Divry: Als der Teufel aus dem Badezimmer kam
Ein Improvisationsroman voller Unterbrechungen und ohne Anspruch auf Tiefgang
Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky
Berlin: Ullstein 2017
271 Seiten. 21,00 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander