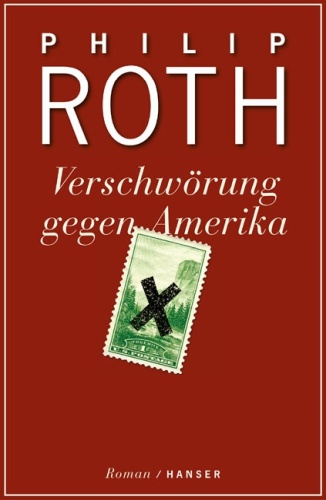Roman | Monika Maron: Munin oder Chaos im Kopf
»Ich wollte eigentlich keinen Roman über die Umweltzerstörung schreiben, sondern vor allem erzählen, was passiert, wenn jemand, in diesem Fall eine Journalistin, das tut, was sie für richtig hält: die Wahrheit zu schreiben«, erklärte die Schriftstellerin Monika Maron 2009 in einem Spiegel-Interview über das Entstehen ihres in der damaligen DDR verbotenen Romans Flugasche (1981). PETER MOHR über ihre neuen Roman Munin oder Chaos im Kopf.
 Was im postfaktischen Zeitalter von der Wahrheit zu halten ist, wie sich geschürte und reale Ängste mit einem Verdrängungskampf am Rand der Gesellschaft zu einem brodelnden Gewaltgebräu mischen – davon erzählt Monika Marons neuer Roman, mit dem sie auf fragwürdige Weise die emotionale Gemengelage der »Angstbürger« thematisiert.
Was im postfaktischen Zeitalter von der Wahrheit zu halten ist, wie sich geschürte und reale Ängste mit einem Verdrängungskampf am Rand der Gesellschaft zu einem brodelnden Gewaltgebräu mischen – davon erzählt Monika Marons neuer Roman, mit dem sie auf fragwürdige Weise die emotionale Gemengelage der »Angstbürger« thematisiert.
Erzählt wird der hybride Roman aus der Perspektive einer in Berlin allein lebenden Autorin namens Mina Wolf, die an einer Arbeit über den Dreißigjährigen Krieg werkelt und vorgibt, Parallelen zur Gegenwart entdeckt zu haben. Danach befinden wir uns in einer religiös aufgeheizten Vorkriegszeit, in der großen weiten Welt ebenso wie im Mikrokosmos der unmittelbaren Nachbarschaft.
Der Roman spielt bewusst mit dem in der Schwebe gehaltenen Erzähl-Ich. Spricht da die fiktive Mina Wolf zu uns oder doch – nur mäßig getarnt – die 76-jährige Berliner Autorin Monika Maron? Maron hat in jüngster Vergangenheit journalistisch schon offen ihre Angst vor dem Islam artikuliert und sich gegen die geöffneten Grenzen ausgesprochen, begründet damit, »dass afrikanische Stammes- und Religionskriege in Deutschland einziehen könnten.«
Hier wird die Stimmungslage der »Angstbürger« ebenso bedient wie dumpfe Stammtischparolen, in denen von »abweisenden Gesichtern der kopftuchtragenden Frauen« die Rede ist.
Minas Arbeit über den Dreißigjährigen Krieg wird wird als »pessimistisch und düster« abgelehnt. Die Intellektuelle zieht sich immer mehr zurück, sucht Zerstreuung und Austausch mit der einbeinigen, sprechenden Krähe Munin, die sie fürsorglich mit Wurst und Hundefutter versorgt. Später lässt Monika Maron ihre Protagonistin in ihrem 2016 erschienenen Band Krähengekrächz lesen. Diese exponierte Form der Selbstreferenzialität muss man nicht goutieren, obwohl es Brücken zwischen beiden Werken gibt. »Vielleicht liegt es am Alter, am allmählichen Verfall und dem nahenden Sterben, das mich das Tier im Menschen so deutlich erkennen lässt«, hieß es vor zwei Jahren in Krähengekrächz.
Von Verfall und Intoleranz ist auch Minas Nachbarschaft geprägt. Eine geistig verwirrte Nachbarin, die einem amtlichen Vormund untersteht, intoniert auf ihrem Balkon (von einem scheppernden Kassettenrekorder begleitet) lautstark kakophone Fragmente von Arien und Operettenmelodien und zieht sich damit den Unmut und Hass ihrer Umgebung zu. Bisweilen wehrt sie sich mit zu Wurfgeschossen umfunktionierten Blumentöpfen.
Der Riss, der durch Minas Leben geht, ist ebenso tief wie der Riss in ihrer Straße, in der sich Alt- und Neubaubewohner, Intellektuelle und Kleinbürger mehr oder weniger feindlich gegenüberstehen. Eine Bürgerinitiative wird gegründet, es gibt zerstochene Autoreifen, Schmähpamphlete und Drohbriefe, aus den Fenstern wehende Deutschlandfahnen und schlussendlich handfeste Gewalt.
»Eigentlich gehöre ich zu denen, die neuerdings als rechts bezeichnet werden«, schrieb Monika Maron im Sommer 2017 (mit einem verständnislosen Unterton) in der Neuen Zürcher Zeitung. Dabei hatte sie öffentlich wiederholt ihre Angst geäußert, »dass afrikanische Stammes- und Religionskriege in Deutschland einziehen könnten« und »… uns unverhohlen unsere Eroberung angekündigt wurde, mit Waffen und Geburtenraten.«
Monika Maron konstruiert aus dem Blickwinkel ihrer Protagonistin einen höchst subjektiven Blick auf die Mechanismen der Gewalt. Erzeugt Angst, wie von Maron unterschwellig suggeriert, wirklich zwangsläufig Gewalt? Darf sie durch einen subjektiv hohen Grad der Bedrohung gar als eine Art Notwehr moralisch legitimiert werden?
Es herrscht tatsächlich ein unüberschaubares Chaos im Kopf der Figur, und man empfindet tiefes Mitleid mit der einbeinigen Krähe Munin, die sich diese wirren Gedanken für ein paar Happen Wurst und ein wenig Hundefutter als Gegenleistung anhören muss.
Bei all den Anspielungen, Querverweisen und falschen Fährten, die Monika Maron ausgelegt hat, finden wir im postfaktischen Zeitalter vielleicht einen Funken Wahrheit in der seichten Welt des Schlagers der frühen 1960er Jahre. Da trällerte eine Italienerin namens Mina in ihrem Song Heißer Sand (allerdings gewaltfrei) von einem verlorenen Land und »die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war.« Diese seichte Mina kann man eher ins Herz schließen als die kopflastige, vereinsamte, dem Populismus zugewandte, mit Krähen Konversation treibende Figur aus Monika Marons Roman.
Titelangaben
Monika Maron: Munin oder Chaos im Kopf
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2018
223 Seiten. 20.- Euro
https://www.osiander.de/details.cfm?isbn=9783100488404&pid=100198
Reinschauen
| Peter Mohr über Monika Maron in TITEL kulturmagazin