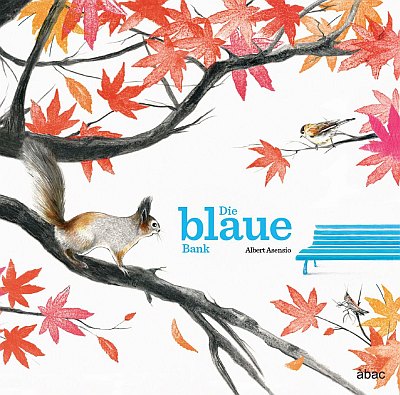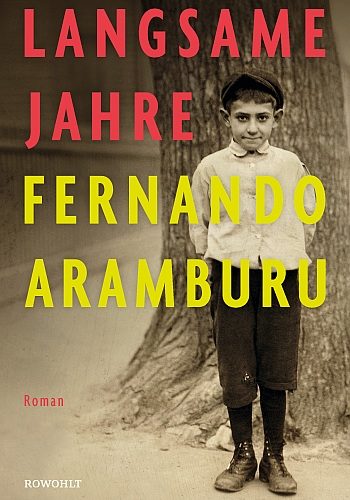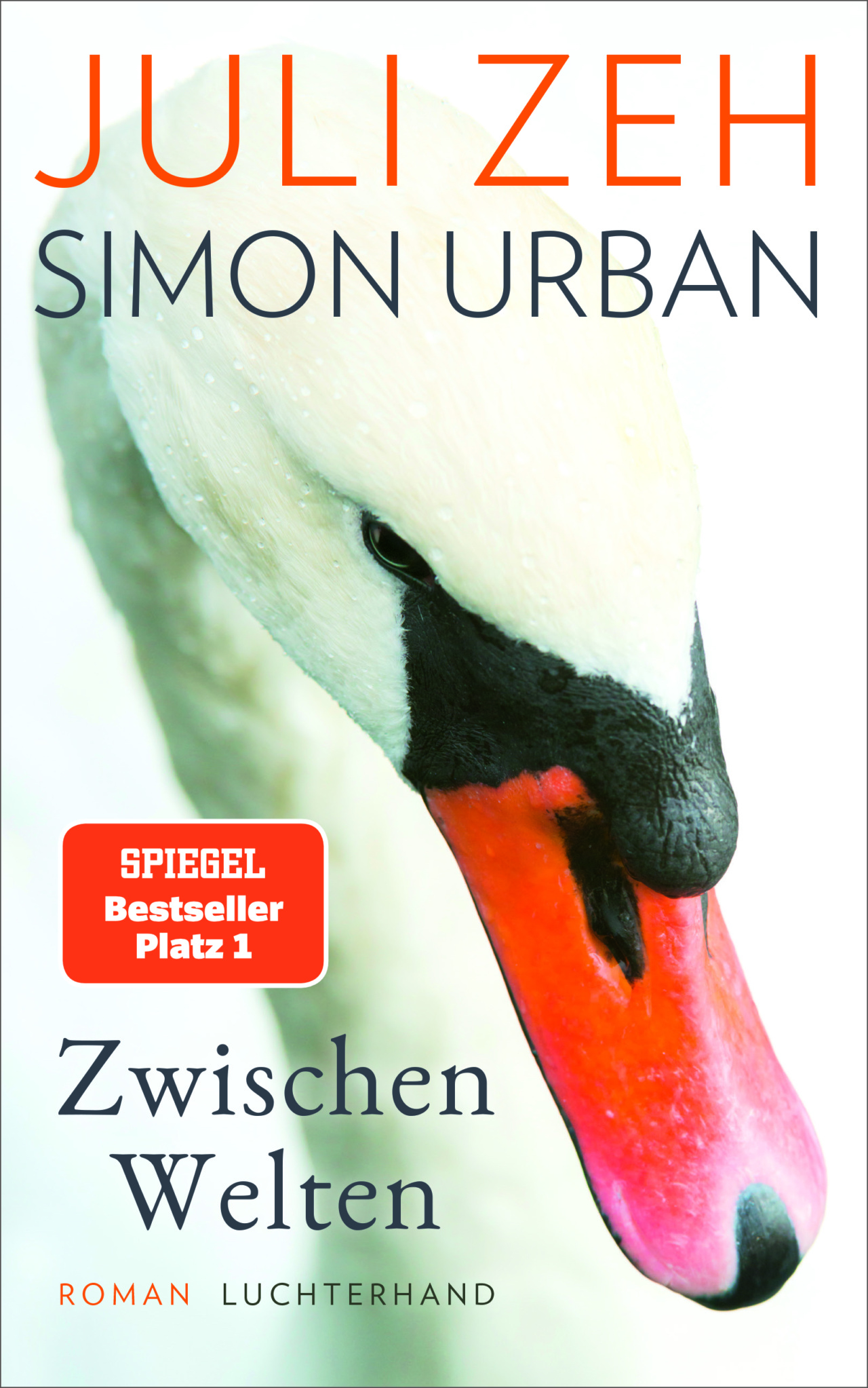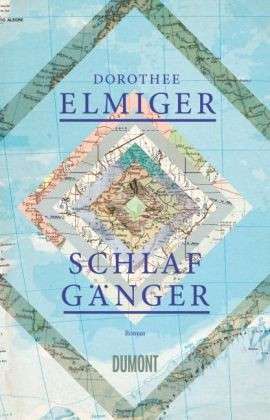Roman | António Lobo Antunes: Ich gehe wie ein Haus in Flammen
Alljährlich im Herbst, wenn das Rätselraten um die Nobelpreiskandidaten in die heiße Phase geht, wird seit rund 15 Jahren sein Name stets ganz hoch gehandelt. Der 74-jährige portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes, der viele Jahre als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Lissabon arbeitete, hat nun seinen 25. Roman Ich gehe wie ein Haus in Flammen vorgelegt, der sich wie eine Summe seines bisherigen Oeuvres liest. Von PETER MOHR
 Wieder steht das Portugal der kleinen Leute, deren existenzielle Sorgen und die nicht aufgearbeitete Zeit der Salazar-Diktatur im Zentrum. Daraus entsteht eine emotionale Melange aus Hoffnungslosigkeit und Melancholie. Schon 1998 ließ Lobo Antunes in seinem Roman Portugals strahlende Größe eine Figur befinden: »Es ist unmöglich, zu zweit unglücklich zu sein, denn Unglücklichsein ist etwas Einsames.«
Wieder steht das Portugal der kleinen Leute, deren existenzielle Sorgen und die nicht aufgearbeitete Zeit der Salazar-Diktatur im Zentrum. Daraus entsteht eine emotionale Melange aus Hoffnungslosigkeit und Melancholie. Schon 1998 ließ Lobo Antunes in seinem Roman Portugals strahlende Größe eine Figur befinden: »Es ist unmöglich, zu zweit unglücklich zu sein, denn Unglücklichsein ist etwas Einsames.«
Relativ einsam und ziemlich unglücklich sind auch sämtliche Bewohner eines Lissaboner Mietshauses mit acht Parteien, das im neuen Roman als Spiegelbild für die portugiesische Mittelschicht fungiert.
Der soziale Abstieg und handfeste Probleme des Älterwerdens prägen den Alltag der so unterschiedlichen Hausbewohner. Sie kämpfen fortwährend gegen Verluste (materieller Natur und wachsender Vereinsamung) und damit einhergehend findet eine ständige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit statt – Erinnerungen an die Kindheit, an die Lieblings-Stofftiere, an die Hochzeitsnacht, aber auch an die schlimme Zeit unter Diktator Salazar.
Es ist eine sozial völlig heterogene Gruppe, die das Mietshaus bevölkert: da ist der Senior Joaquim, der kürzlich seine asthmakranke Frau verloren hat, eine neunundfünfzigjährige, mannstolle Richterin, die bereits in Pension ist und sich durch ihren eigenen Geruch nach »alter Frau« angewidert fühlt, die Geschwister aus der Ukraine, die für ein Ehepaar gehalten werden, eine Schauspielerin, eine Finanzbeamtin, der ehemalige Offizier Augusto, der sich der Mulattin Sofia Rosa erinnert, die er vor 40 Jahren in Luanda verlassen hat, obwohl sie schwanger ist, der verwitwete greise Rechtsanwalt, ein von den Salazar-Schergen gefolterter, traumatisierter Kommunist und ein Trinker, der offensichtlich allen Bewohnern aus der Seele spricht: »wir gehen alle wie Häuser in Flammen, das Schädeldach brennt«.
Die Figuren leben zumeist nur noch in Erinnerungen. Die Kindheit ist wichtiger als die Gegenwart, von der Zukunft, die diese Leute nicht mehr zu haben scheinen, ganz zu schweigen. Die Geister der Toten, der verstorbenen Partner oder Weggefährten, spielen auch eine zentrale Rolle im inneren Kampf gegen die Vereinsamung.
Irgendwie mischt sich alles, Gegenwart, Vergangenheit, Sehnsüchte und Albträume. Die Grenzen verschwimmen vollends, aber es dominiert eine seltsame Note der Deformation. Lobo Antunes‘ Polyphonie ist manchmal schwierig nachzuvollziehen, bisweilen stellt sich die Frage: wer erzählt eigentlich momentan?
»Was und wie ich schreibe, muss unbedingt etwas mit mir zu tun haben, mit meinen Hirngespinsten und Obsessionen«, hatte der portugiesische Schriftsteller vor einigen Jahren in einem Interview über sein dichterisches Credo befunden.
Sein neuer Roman Ich gehe wie ein Haus in Flammen ist ganz sicher nicht sein kompositorisch gelungenstes Werk und auch kein ausdrückliches Empfehlungsschreiben an das Stockholmer Nobelpreiskomitee, aber er ist dennoch ein für diesen großen Erzähler völlig typisches Buch, Prosa aus der Seele Portugals. Fado und Saudade (dt:. Weltschmerz) zwischen zwei Buchdeckeln. Tief traurig, aber emotional authentisch.
Titelangaben
António Lobo Antunes: Ich gehe wie ein Haus in Flammen
Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann
München: Luchterhand Verlag 2017
444 Seiten, 24.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe