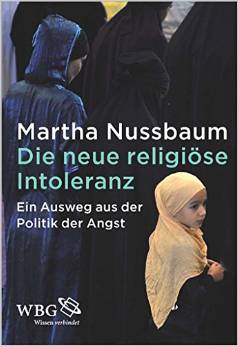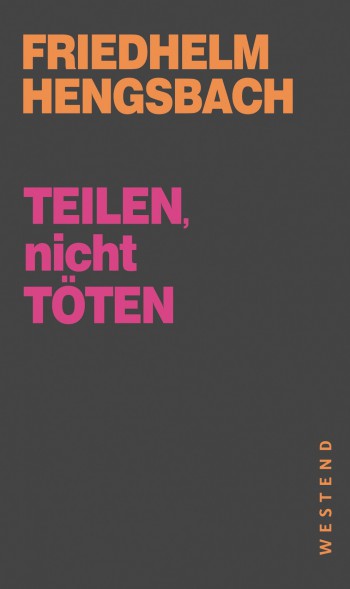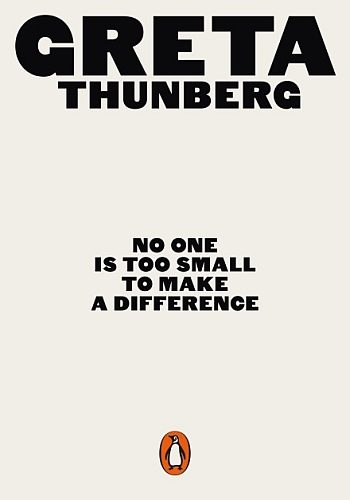Wie ein Märchen liest sich Ferdinand von Schirachs kometenhafter literarischer Aufstieg in den letzten zehn Jahren. Der renommierte Strafverteidiger und Enkel des einstigen NS-Reichsjugendführers hatte 2009 unter dem Titel Verbrechen einen schmalen Band mit Kriminal-Erzählungen vorgelegt, der mehr als 150 000mal verkauft wurde. Offensichtlich hatte der Jurist den »Nerv der Zeit« getroffen und mit den erzählten Fällen aus seinem juristischen Kanzlei-Alltag auch einen latenten Voyeurismus befriedigt. Seine Bücher wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern und sind bisher in 40 Ländern erschienen. Von PETER MOHR
 »Nach all diesen Jahren habe ich begriffen, dass die Frage, ob der Mensch gut oder böse ist, eine ganz und gar sinnlose Frage ist«, heißt es im neuen Band des 55-jährigen Autors, der 48 durchnummerierte Texte enthält, die zumeist einen autobiografischen Hintergrund haben und deren Lektüre selten mehr Zeit erfordert als eine Zigarettenlänge und der Genuss einer Tasse Kaffee.
»Nach all diesen Jahren habe ich begriffen, dass die Frage, ob der Mensch gut oder böse ist, eine ganz und gar sinnlose Frage ist«, heißt es im neuen Band des 55-jährigen Autors, der 48 durchnummerierte Texte enthält, die zumeist einen autobiografischen Hintergrund haben und deren Lektüre selten mehr Zeit erfordert als eine Zigarettenlänge und der Genuss einer Tasse Kaffee.
Eingeleitet wird der Band mit einem stenografisch anmutenden Fragment aus der Kindheit, in dem Ereignisse nüchtern aneinander gereiht werden – vom Tod des Vaters bis zum eigenen Selbstmordversuch mit 15 Jahren. Nur selten verlässt von Schirach seine strenge faktenorintierte Erzähllinie und geht ins Detail, etwa, als er sich an das »Ticken der Standuhr« in seiner Kindheit erinnert.
Rauchen und Kaffee sind Fixpunkte, kurze Phasen des Innehaltens, des Zu-sich-selbst-kommens in einem streng durchgetakteten Alltag. Rauchen ist für ihn aber auch ein Stück Lebensgefühl, in einer Zeit der Rauchverbote in öffentlichen Räumen soll es Ausdruck des Nonkonformismus sein. Das Rauchen wird zur Pose stilisiert, und die erzählerischen Petitessen werden mit prominenten Zeitgenossen wie Lars Gustafsson, Imre Kertész und Michael Haneke ausstaffiert. Außerden widmet sich von Schirach den Lebensläufen der so unterschiedlichen »Juristen-Kollegen« Otto Schily, Christian Ströbele und Horst Mahler.
Obwohl von Schirach über sein eigenes Leben schreibt und sein Inneres nach Außen zu kehren versucht, unterscheidet sich der Stil nicht von seinen literarisch-juristischen Fallgeschichten. Nüchtern, beinahe protokollarisch, ohne spürbaren Ausschlag auf der Empathie-Skala.
Er geht mit zu bewertenden kriminalistischen Fakten offenbar ebenso kühl um wie mit dem eigenen Erleben. Für Emotionen ist kein Platz vorgesehen. Vor Gericht durchaus verständlich, beim erzählerischen Blick auf die eigene Vita eher befremdlich.
Alles wirkt streng rational abgearbeitet, Krisen werden im großen Zusammenhang philosophisch analysiert, und es entsteht das Bild eines jungen Menschen, der sein eigenes Handeln schon früh als an gesellschaftlichen Normen orientierter Funktionsträger in einem soziologischen Makrokosmos versteht.
Hier und da hätte man sich das Einschreiten eines aufmerksamen Lektorats gewünscht. Als von einem Trump-Besuch bei Queen Elisabeth die Rede ist, heißt es: »Prinz Philip, der 80-jährige Ehemann der Queen, muss laut Hofprotokoll bei offiziellen Anlässen immer hinter ihr bleiben.« Prinz Philip hatte bei Trumps Amtsantritt aber schon die neunzig weit überschritten. Aber geschenkt. Es sind eben nur Texte für zwischendurch, bei Kaffee und Zigarette, und ohne nachhaltigen Eindruck.
»Es ist nicht schlimm zu sterben, aber es ist schlimm, aufzuhören zu lieben.« Das ist der emotionalste Satz des Buches, den von Schirach einer alten Frau in den Mund gelegt hat.
Titalangaben
Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten
München: Luchterhand Verlag 2019
187 Seiten, 20.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe




![Deutsches SchauSpielHaus Hamburg: „König Lear“ von William Shakespeare. Regie: Karin Beier. Bühne und Kostüme: Johannes Schütz. Premiere am 19.10.2018 im SchauSpielHaus. Foto v.l.: Maximilian Scheidt, Edgar Selge © Matthias Horn, 2018. Die Bilder dürfen im Rahmen der Ankündigung und Berichterstattung unter Nennung des Copyrights honorarfrei genutzt werden. Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar an presse[at]schauspielhaus.de. Kontakt zur Fotografin: 0163 1905732 / matthias@hornphotography.de](https://titel-kulturmagazin.net/wp-content/uploads/KönigLear-3-350.jpg)