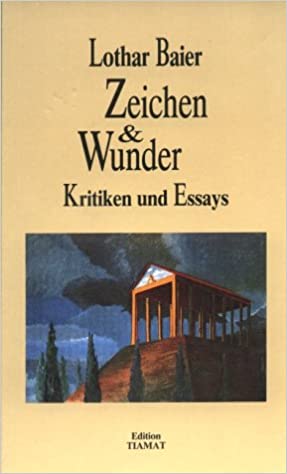Menschen | Zum 75. Geburtstag des Schriftstellers Bernhard Schlink am 6. Juli
»Schuld ist ein Lebensthema. Es ist nicht das Lebensthema, und es ist auch nicht das Thema meiner Bücher, sondern nur eines«, erklärte Bernhard Schlink vor einem Jahr in einem Deutschlandfunk-Interview. Kein Wunder, da sich versierter Jurist und passionierter Erzähler irgendwann in der Person Schlink getroffen haben. Ein Porträt von PETER MOHR
 »Ich war zu alt, als dass die neue Rolle mein Leben entscheidend hätte verändern können. Ich hatte meinen Ort in der Welt bereits gefunden«, bekannte Bernhard Schlink vor zehn Jahren in einem FAZ-Interview über sein »zweites Leben« als Schriftsteller. Er war immerhin schon Mitte vierzig, als er seinen ersten Roman vorlegte, war bis zu seinem 65. Lebensjahr nicht einmal Berufsschriftsteller, und doch hat er mit ›Der Vorleser‹ einen der (vor allem auch international) erfolgreichsten deutschen Romane der letzten 25 Jahre vorgelegt.
»Ich war zu alt, als dass die neue Rolle mein Leben entscheidend hätte verändern können. Ich hatte meinen Ort in der Welt bereits gefunden«, bekannte Bernhard Schlink vor zehn Jahren in einem FAZ-Interview über sein »zweites Leben« als Schriftsteller. Er war immerhin schon Mitte vierzig, als er seinen ersten Roman vorlegte, war bis zu seinem 65. Lebensjahr nicht einmal Berufsschriftsteller, und doch hat er mit ›Der Vorleser‹ einen der (vor allem auch international) erfolgreichsten deutschen Romane der letzten 25 Jahre vorgelegt.
Schlink war fast 20 Jahre Richter am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster und wurde vor fünf Jahren als Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der TU Berlin emeritiert. In den frühen 1980er Jahren hatte er sich nach Promotion und Habilitation in den USA für kurze Zeit auch als Goldschmied und Masseur versucht – eine Art »Selbstfindungstrip«.
»Ich fand immer die Vorstellung schön, dass mein Buch an der Bahnhofsbuchhandlung gekauft, auf die Reise mitgenommen und im Zug gelesen wird«
Der Spagat zwischen Recht und Moral, ein ausgeprägtes Interesse an historischen Fragestellungen und die schnörkellose, aber dennoch präzise Sprache ziehen sich wie ein roter Faden durch die literarischen Werke von Bernhard Schlink, der am 6. Juli 1944 in Großdornberg (nordwestlich von Bielefeld) als Sohn eines Theologieprofessors geboren wurde und in Heidelberg aufgewachsen ist.
Schlink hat nie nach dem Mainstream geschielt und sich auch nicht gescheut, in seinen Werken unbequeme Fragen aufzuwerfen. Mit dem Pensionär Gerhard Selb (Protagonist in insgesamt drei Romanen) hat er zudem eine reichlich unkonventionelle Figur in der deutschen Krimilandschaft etabliert – gesundheitlich angeschlagen wie Mankells Kurt Wallander, eigenbrötlerisch wie Hansjörg Schneiders Kommissär Hunkeler und lebensklug wie einst der von Willy Millowitsch verkörperte TV-Kommissar Klefisch.
Obwohl Schlink bereits 1993 für ›Selbs Betrug‹ den Deutschen Krimipreis erhalten hatte, kam der Erfolg seines Romans ›Der Vorleser‹ zwei Jahre später einer Sensation gleich. ›Der Vorleser‹ wurde in über 50 Sprachen übersetzt und war das erste deutsche Buch, das auf Platz eins der Bestsellerliste der New York Times stand. Auch die Kinoversion mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet und David Kross in den Hauptrollen war ein respektabler Erfolg.
Die Handlung beginnt Ende der 50er Jahre mit der unkonventionellen Liebesbeziehung zwischen dem 15-jährigen Akademikersohn Michael Berg und der über zwanzig Jahre älteren Straßenbahnschaffnerin Hanna Schmitz. Unkonventionell nicht nur des Altersunterschiedes wegen, sondern, weil sich Jüngling Michael auch noch als eifriger Vorleser für die reife Frau betätigt. So plötzlich, wie Hanna in Michaels Leben getreten ist, verschwindet sie auch wieder. Michael beginnt ein Jurastudium und nimmt als Hospitant an einem Kriegsverbrecherprozess teil. Völlig irritiert und ratlos erkennt er auf der Anklagebank seine einstige Geliebte wieder, die in jungen Jahren als SS-Mitglied Aufseherin in einem Konzentrationslager war.
Michael verfolgt den Prozess weiter und erfährt, dass sich Hanna auch im KZ von jungen Häftlingen aus Büchern vorlesen ließ. Dies wird vom Gericht als besonders »grausame Methode« gewertet und die Analphabetin Hanna muss für 18 Jahre ins Gefängnis. Später schickt Michael – inzwischen Juraprofessor – Hanna Tonbandcassetten mit Aufnahmen von belletristischen Werken ins Gefängnis, wo sie unter großen Mühen lesen und schreiben lernt.
Was hat Schlinks grandiosen Erfolg vor 14 Jahren ausgemacht? War es die Tatsache, dass er einer NS-Täterin ein greifbares Gesicht und menschliche Züge verlieh, ohne für sie beim Leser um Mitleid zu buhlen? Oder hatte der Autor mit seiner männlichen Hauptfigur Michael Berg und dessen fast flehender Frage den Nerv der Generation der Nachgeborenen getroffen: »Was sollte und soll meine Generation der Nachlebenden eigentlich mit den Informationen über die Furchtbarkeit der Vernichtung der Juden anfangen?«
Um Geschichte, um Heimat und Suchbewegungen drehte sich auch der 2006 erschienene Roman ›Die Heimkehr‹. Variantenreich verarbeitete Schlink das Heimkehrer-Motiv und Anleihen aus der Odyssee – fraglos der kompositorisch anspruchsvollste Schlink-Roman.
Heftig diskutiert wurde auch sein Roman ›Das Wochenende‹ (2008), in dem ein nach langer Haftzeit entlassenes RAF-Mitglied im Zentrum steht. Trotz seiner großen Bravour als Erzähler konnten die beiden letzten Romane ›Die Frau auf der Treppe‹ (2014) und ›Olga‹(2018) nicht mehr an die emotionale Sprengkraft der Vorgängerwerke heranreichen. In ›Olga‹ fühlte man sich geradezu durch die Seiten getrieben. Die holzschnittartige politische Schwarz-Weiß-Malerei (die gute unbedarfte Olga, der böse Herbert) war zwar vom Autor intendiert, überzeugen konnte sie dennoch nicht. Lediglich der Schlussteil mit Olgas persönlichen Briefen an Herbert ging in die Tiefe und weckte Empathie beim Leser.
»Ich fand immer die Vorstellung schön, dass mein Buch an der Bahnhofsbuchhandlung gekauft, auf die Reise mitgenommen und im Zug gelesen wird«, hatte Schlink, der abwechselnd in New York und Berlin lebt, vor einigen Jahren einmal erklärt. Der Bestsellerautor ist auf eine geradezu sympathische Weise bescheiden geblieben.
| PETER MOHR
| Foto: Roger Eberhard, Bernhard Schlink, CC BY-SA 3.0