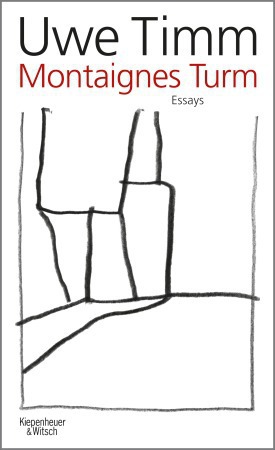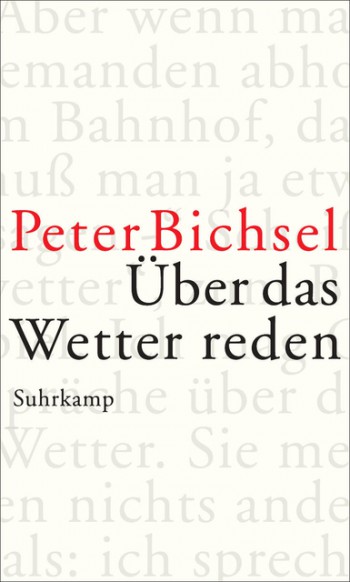Wolf Senff: Wampum
Die Angelegenheit sei kompliziert, sagte Gramner. Wampum, erklärte er, sei ein muschelähnlicher Gegenstand, ein Stäbchen, bis zu zwei Zentimetern lang und der Länge nach durchbohrt, es werde, auf Fäden aufgezogen, zu breiten Gürteln geknüpft oder auch als ein Design in Textilien verarbeitet.
Super, sagte Harmat.
Du kennst es, fragte Rostock.
Nie gesehen, erwiderte Harmat trocken.
Eine kulturelle Preziose der Irokesen, sagte Gramner.
Irokesen, fragte Rostock.
Sechs Nationen, sagte Pirelli, indigene Stämme am St-Lorenz-Strom und am Ontario-See.
Ist das nicht weit entfernt von unserer Lagune, fragte der Ausguck.
Tausende Meilen, ja, hoch im Nordosten, sagte Pirelli, doch es sind indigene Stämme wie die Navaho, von denen Gramner auch erzählt. Diese Six Nations wurden teils von dem traditionellen Rat der Häuptlinge in den Langhäusern regiert, teils von einem Häuptling, der gewählt und vom Bureau of Indian Affairs anerkannt war, die Irokesen waren eine kulturell zutiefst gespaltene Gemeinschaft.
Ihm sei das alles zu verwirrend, sagte der Ausguck.
Ruhe, zischte Thimbleman.
Die Wampum-Produkte, fügte Pirelli flüsternd hinzu, sind eine besondere kulturelle Ikone der Onondaga Nation.
Die sechziger Jahre seien eine Epoche des Umbruchs gewesen, sagte Gramner.
Sechziger Jahre, fragte Harmat: Sind wir denn schon so weit?
Bei uns ist das Jahr 1856, sagte Bildoon.
Gramner schweift wieder in den endlosen Weiten der Zeit, erklärte Pirelli, er redet von den sechziger Jahren des nächsten Jahrhunderts.
Laß ihn, sagte Bildoon, ich will das wissen.
Ruhe, zischte Thimbleman.
Harmat fehlten die Worte.
NAGPRA, erklärte Gramner, sei das Kürzel für den Native American Graves Protection and Repatriation Act, der 1990 verabschiedet worden sei.
Ein Zahlendreh, fragte sich Harmat. Er war kurz davor, vollends die Fassung zu verlieren.
Während der sechziger Jahre sei der indigenen Bevölkerung neues Selbstbewußtsein erwachsen, die Jahrzehnte der Zwangsumsiedlungen und der erzwungenen Assimilation gingen zuende, die indigenen Stämme besannen sich auf ihr kulturelles Erbe.
Was das sei, kulturelles Erbe, fragte Bildoon.
Er solle einfach zuhören, sagte Mahorner.
Ruhe, zischte Thimbleman.
Wir dürfen die Lasten, unter denen sie litten, nicht unterschätzen, mahnte Gramner. Über mehrere Generationen seien sie in Armut und Unterdrückung aufgewachsen. Die indigenen Stämme hätten an sich selbst gezweifelt, die Rückgewinnung ihrer kulturellen Identität sei zu ihrem wichtigsten Ziel geworden.
Das sei ihm zu hoch, sagte Bildoon.
Hör ihm zu, schimpfte Harmat, er erklärt es doch.
In den siebziger Jahren habe sich eine harte Auseinandersetzung über den Anspruch auf die Wampums angebahnt, schlichte Gürtel oder Ketten, die für die Onondaga wie die anderen Nationen der Irokesen einen unschätzbar hohen zeremoniellen Wert besaßen und bei besonderen Anlässen, etwa Vertragsabschlüssen, Hochzeiten, getauscht oder verliehen wurden.
Gramner rede vom zwanzigsten Jahrhundert, fragte Rostock.
Genau, sagte Mahorner, von dessen 1970er Jahren.
Zahllose Wampums seien in Kriegen erbeutet worden, den Leichnamen entrissen, aus Gräbern geraubt und an staatliche Museen oder archäologische Institute abgegeben worden, wo sie nun ausgestellt waren und für archäologische Forschung verfügbar.
Zum Problem sei das geworden, seitdem die neue Generation der Irokesen sie als Teil ihrer eigenen Geschichte und ihrer kulturellen Identität betrachtete und die Wampums zurückforderte. Die Auseinandersetzung wurde heftig, man warf einander Gesetzesverstöße und Rassismus vor, die Onondaga erinnerten daran, daß ihr vom Bureau of Indian Affairs gestützter Häuptling Thomas Webster im Jahr 1891 eine große Menge Wampums an einen US-Regierungsagenten verkauft hatte. Wampums jedoch seien unveräußerliches Eigentum der Gemeinschaft, jeder käufliche Erwerb sei von vornherein ungültig. Dieser Kulturkampf zog sich bis in die erwähnten sechziger Jahre hin.
Kulturkampf, fragte sich Harmat: Ich verstehe kein Wort. Über seine Stirn zog sich eine tiefe Falte.
Der Ausguck sah ihn an und lächelte. Ein erbitterter Kulturkampf, überlegte er, würde ausbrechen, wenn die Seeleute sich entschließen würden, in der Lagune zu schwimmen, gar unter Scammons Anleitung.
Auch Rostock überlegte kurz, was das sein könnte, ein Kulturkampf, und entschied, daß er das ja nicht wissen könne, weil Gramner aus einem Jahrhundert erzählte, das es noch nicht gab. Er liebte Gramners Geschichten, wovon auch immer er erzählte, und wahrscheinlich war es wichtig, auf ihn zu hören.
Touste hielt seine Gitarre, dachte aber nicht daran, Akkorde anzuschlagen, er hatte nicht vor, Gramner zu unterbrechen. Vielleicht wenn eine Pause einträte oder die Dämmerung einsetzte.
Die Ablösung der Segelschiffahrt durch die Dampfer sei ein Kulturkampf, wer würde das bestreiten, sagte sich Eldin und faßte sich an die schmerzende Schulter: Niemand könne vorhersagen, wie das ausgehen werde, man müsse den sogenannten technologischen Revolutionen argwöhnisch begegnen. Für ihn sei der mörderische Gestank Grund genug, die Dampfschiffahrt kompromißlos abzulehnen.
| WOLF SENFF
| Titelfoto: Daderot, Wampum Wrist Ornament, Iroquois or Penobscot, 18th century AD, shell, fiber, and leather with metal cross – Native American collection – Peabody Museum, Harvard University – DSC01592, CC0 1.0