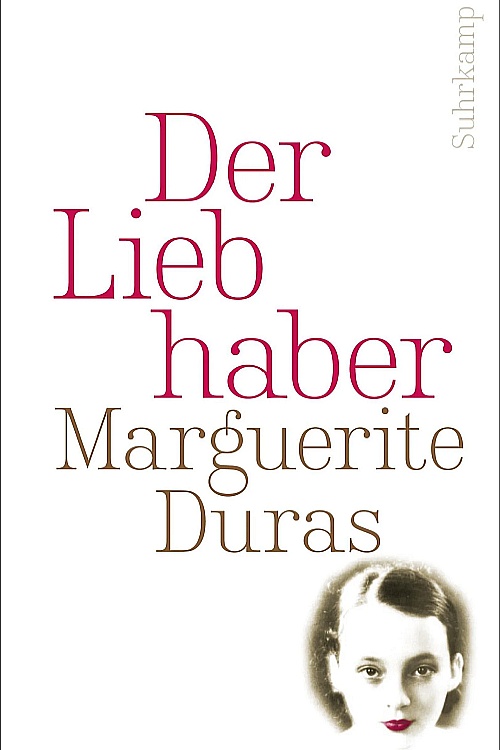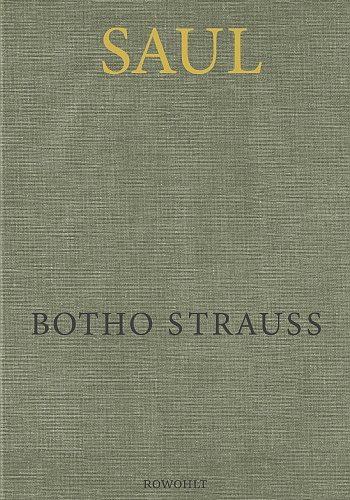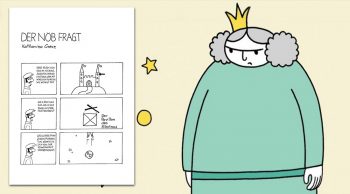Er war ein begnadeter Selbstinszenierer, eitel und polarisierend. Er hat sich gern dem Mainstream widersetzt und genoss seinen Status als spät inthronisierter Popstar der Bücherwelt. Und doch hat er unendlich viel für die Literatur im deutschen Sprachraum getan: Die Rede ist von Marcel Reich-Ranicki. Von PETER MOHR
Seinen letzten großen Fernsehauftritt, als ihm am 11. Oktober 2008 der Deutsche Fernsehpreis verliehen werden sollte, nutzte der Literatur-Papst noch einmal zu einem vehementen Rundumschlag. Er lehnte die Auszeichnung ab und erklärte sichtlich echauffiert: »Wütend gemacht hat mich, dass fast alle preisgekrönten Darbietungen auf einem erbärmlichen Niveau waren.«
13 Jahre lang verriss und lobte Reich-Ranicki in 77 Sendungen des ›Literarischen Quartett‹ im ZDF mit wechselnden Gesprächspartnern Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, ehe die Reihe, die ihn weit über die Kulturszene hinaus bekannt gemacht hat, im Dezember 2001 eingestellt wurde. Niemand verriss Bücher so gnadenlos und lobte so enthusiastisch, kein anderer Kritiker im deutschen Sprachraum war auch nur annähernd so erfolgreich und gleichzeitig so heftig umstritten, kein zweiter hat die Entwicklung der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur so nachhaltig beeinflusst und die Literaturkritik gar als öffentliches (wenn auch fragwürdiges) TV-Bühnenspektakel etabliert.
Marcel Reich-Ranicki wurde am 2. Juni 1920 in Wloclawek an der Weichsel als Sohn polnisch-jüdisch-deutscher Eltern geboren, wuchs ab 1929 in Berlin auf, ehe er 1938 von den Nazis nach Polen deportiert wurde, wo er später im Warschauer Ghetto lebte. In größter existentieller Not suchte er Zuflucht (ausgerechnet) in der deutschen Literatur.
Wie konnte – fragt man sich als Leser seiner überaus erfolgreichen Autobiografie ›Mein Leben‹ – ein Mensch, dessen Biografie bis zum 38. Lebensjahr nur aus »Katastrophen« bestand, dies alles überstehen? Wohl tatsächlich nur durch die beiden Fixpunkte in seinem Leben, durch die doppelte Liebe: Seine Frau Teofila und die deutsche Literatur gaben ihm auch in schlimmsten Zeiten die notwendige, stärkende Rückendeckung.
Schon bevor er 1958 als geläutertes und mehrfach inhaftiertes, ehemaliges KP-Mitglied in die Bundesrepublik übersiedelte, hatte er sich in Polen als Kritiker, Übersetzer und Essayist einen Namen gemacht. Danach schrieb er Kritiken für die ›Zeit‹, für diverse Rundfunkanstalten und leitete fünfzehn Jahre lang (von 1973 bis 1988) den Literaturteil der FAZ.
Er förderte mit überschwänglichem Lob so unterschiedliche literarische Charaktere wie Sarah Kirsch und Peter Maiwald, Ulla Hahn und Thorsten Becker, Wolfgang Koeppen und Thomas Bernhard, Patrick Süskind, Hermann Burger und Andrzej Szczypiorski, den er für den deutschen Buchmarkt »entdeckte«.
Unter Reich-Ranickis Ägide sind bei der FAZ die Serie ›Romane von gestern – heute gelesen‹ und die ›Frankfurter Lyrik-Anthologie‹ (beides liegt in Buchform vor) entstanden. Zahlreiche lesenswerte Essaybände stammen aus seiner Feder, vor allem Brillantes über seinen bevorzugten Autor Thomas Mann.
»Es deckte sich hier ganz und gar: das Hobby und der Job, die Passion und die Profession«, schrieb Reich-Ranicki in seiner Autobiografie über seine Tätigkeit bei der ›FAZ‹.
Reich-Ranicki hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er stark subjektive Urteile gefällt hat, was ihm von Autorenseite oftmals den Vorwurf der arroganten Willkür eintrug. »Der Kritiker, der tut, als würde er ganz und gar objektiv ein Buch beurteilen, betrügt den Leser«, beharrte MRR stets auf seiner Position als Literaturvermittler, die den Leser in den Vordergrund stellte und ein klar ablesbares Urteil implizierte. Er liebte die extremen Töne, polarisierte bewusst und forderte zum Widerspruch heraus. Wer kennt sie nicht, seine apodiktischen Statements vom Kaliber »dieses Buch langweilt mich«, oder »es gibt heute in Deutschland keinen Autor mehr, der einen guten Roman von mehr als 300 Seiten schreiben kann«.
 Das war der »neue« Marcel Reich-Ranicki, der über mehr als ein Jahrzehnt auch das literarisch unversierte TV-Publikum an das »Quartett« zu fesseln verstand – mit seinem oberlehrerhaften Auftreten, mit seinem spontanen Witz und auch mit seiner scharfzüngigen Bosheit.
Das war der »neue« Marcel Reich-Ranicki, der über mehr als ein Jahrzehnt auch das literarisch unversierte TV-Publikum an das »Quartett« zu fesseln verstand – mit seinem oberlehrerhaften Auftreten, mit seinem spontanen Witz und auch mit seiner scharfzüngigen Bosheit.
Reich-Ranicki konnte sehr wohl auch verletzend sein. Dies musste seine langjährige ›Quartett‹-Mitstreiterin Sigrid Löffler im Sommer 2000 erfahren. Über einen Roman des Japaners Haruki Murakami und über Erotik in (und auch außerhalb) der Literatur kam es vor laufenden Kameras zu einer Eskalation, die mit dem sofortigen Rückzug Löfflers endete. Öffentlich ausgetragene persönliche Scharmützel gab es auch mit Günter Grass und Martin Walser – zugespitzt nach dessen Roman ›Tod eines Kritikers‹ (2002), in dem sich Reich-Ranicki nicht nur wiedererkannt haben wollte, sondern dem er auch eine antisemitische Grundhaltung attestierte. »Warum hatte er nicht die Größe einzugestehen, dass das Buch ein Fehler war?«, fragte Reich-Ranicki in einem ›Focus‹-Interview seinen Dauer-Widersacher vom Bodensee.
Auch einer seiner letzten großen öffentlichen Auftritte fiel aus dem üblichen Rahmen. Zu seinem 90. Geburtstag wurde ihm in der Frankfurter Paulskirche die Ludwig-Börne-Ehrenmedaille verliehen – mit Thomas Gottschalk als Laudator und Harald Schmidt als Pianist. Auch das gehörte zu Marcel Reich-Ranicki, der am 18. September 2013 im Alter von 93 Jahren in seiner Wahlheimat Frankfurt gestorben ist. Um es (leicht abgewandelt) mit seinen eigenen Worten zu resümieren: »Es war manchmal schon ein Kreuz mit ihm, aber wie gut, dass wir ihn hatten.«
| PETER MOHR
| Titelfoto: Deutsch: Graffiti an einer Buchhandlung in Menden im Sauerland (mbDortmund)
Titelangaben
Uwe Wittstock: Marcel Reich-Ranicki
Die Biografie
München: Piper Verlag 2020
432 Seiten, 14 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Vom 2. bis 4. Juni ist eine Vitrinenausstellung in der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, Berliner Platz 5, zu sehen