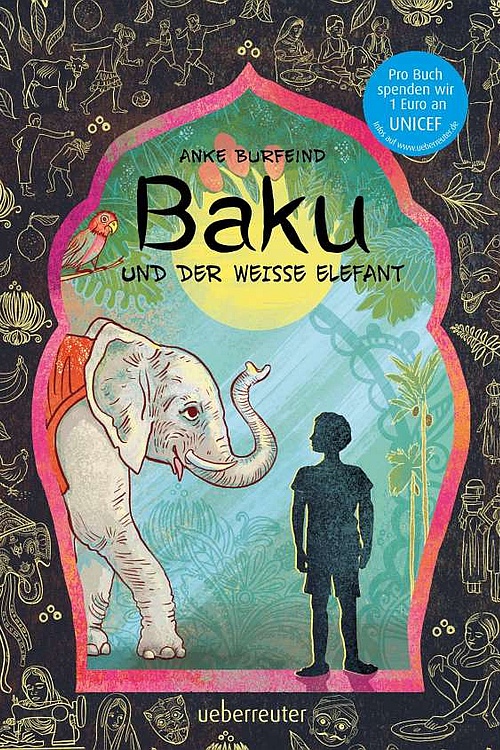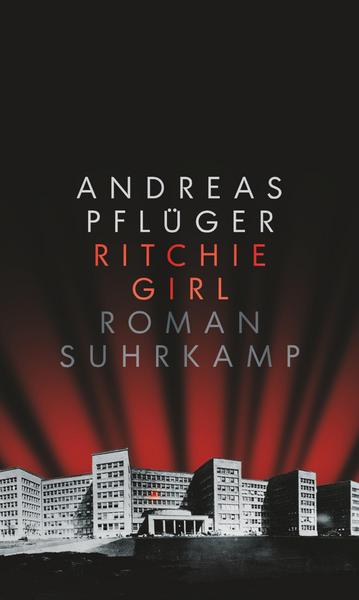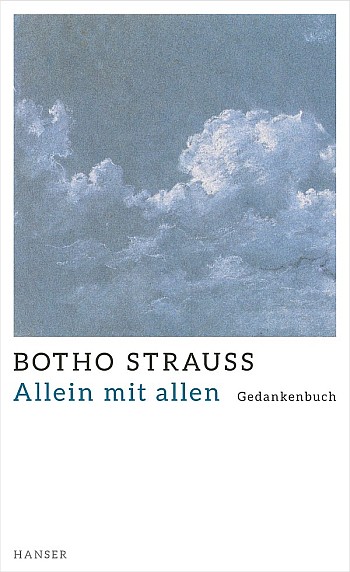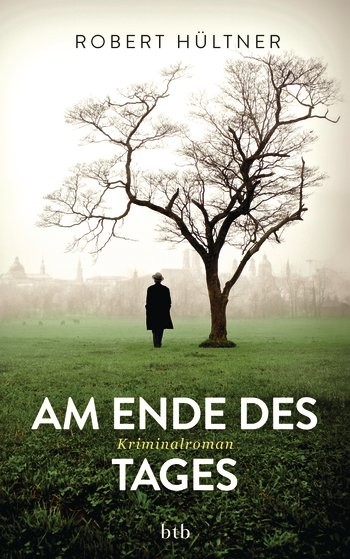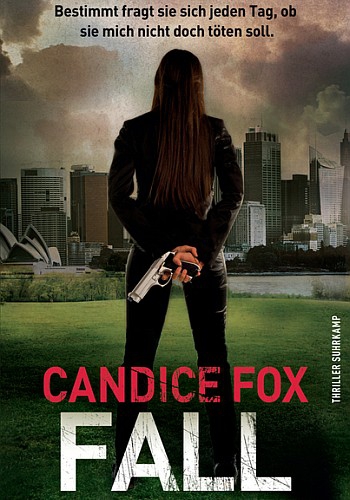Manchmal trügt eine Genrebezeichnung. Hinter Lena Goreliks neuestem Roman Wer wir sind verbirgt sich eine authentische Familiengeschichte, ein außergewöhnliches Erinnerungsbuch. Es ist Selbstvergewisserung, Versöhnung und eine späte Liebeserklärung in einem. Denn der Zauber zweier Sprachen eröffnet neue Dimensionen und Erfahrungsräume. Von INGEBORG JAISER
 Mit drei Jahren lernt das Mädchen Schach spielen, mit vier Jahren lesen. Mathematik hat sowieso schon einen hohen Stellenwert in der Familie, denn Kopfrechnen wird als Zeitvertreib angesehen, beim Warten auf Bus und Tram. Kein Wunder: sind doch beide Elternteile diplomierte Ingenieure, selbst die Großmutter leitet selbstbewusst die Abteilung einer Fabrik. Das Gemeinwohl und der solidarische Zusammenhalt stehen an erster Stelle.
Mit drei Jahren lernt das Mädchen Schach spielen, mit vier Jahren lesen. Mathematik hat sowieso schon einen hohen Stellenwert in der Familie, denn Kopfrechnen wird als Zeitvertreib angesehen, beim Warten auf Bus und Tram. Kein Wunder: sind doch beide Elternteile diplomierte Ingenieure, selbst die Großmutter leitet selbstbewusst die Abteilung einer Fabrik. Das Gemeinwohl und der solidarische Zusammenhalt stehen an erster Stelle.
»Ich« heißt auf Russisch »я« und ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Mit diesem Hinweis wird dem Mädchen schon die kleinste Anwandlung von Egoismus ausgetrieben. Und doch ist die Kindheit geprägt von emotionaler Wärme und Geborgenheit, von ewigen Sommern auf der Datscha, von Familienfesten mit Gitarrenklängen und den Bratkartoffeln der Großmutter.
Reise in ein neues Leben
Dann folgt der große Bruch, die unumkehrbare Zäsur, die sich genau datieren lässt: 2. Mai 1992, 23.55 Uhr. Eine Familie besteigt den Zug in ein neues Leben, von der Fünf-Millionen-Großstadt Sankt Petersburg ins schwäbisch-beschauliche Ludwigsburg. In einem gelben Aktenkoffer Marke »Diplomat« stecken sämtliche Urkunden, in neun Koffern alles, was man im Westen zu brauchen glaubt. Blassgrüne, quadratische Schreibhefte, ein Bügeleisen, Küchenhandtücher. Nur wenig davon wird sich als nützlich erweisen. Doch das ahnen sie noch nicht, die Eltern, die Großmutter, der Bruder und das 11jährige Mädchen namens Lena Gorelik.
Ihr verdanken wir diese als Roman getarnte Familiengeschichte, die in Zeiten der vielpraktizierten Autofiktionalität mit entwaffnender Ehrlichkeit, Offenheit und Glaubwürdigkeit überzeugt. Die heute in München lebende Schriftstellerin und Journalistin Lena Gorelik, 1981 in Sankt Petersburg (das damals noch Leningrad hieß) geboren, kommt mit ihrer Familie 1992 als russisch-jüdischer »Kontingentflüchtling« nach Deutschland. In ein fremdes Land voller Wunder, in dem man Fenster kippen und die echten Barbie-Puppen (im Gegensatz zum polnischen Billigimitat) im Kniegelenk beugen kann. Wo man ganze Salatblätter in einer Essigmarinade isst und nicht klein geschnitten mit Gurkenwürfel und Radieschen in Smetana tunkt. Wo ein selbstgeschneiderter beiger Parka nicht als letzter Schrei gilt und die Kinder bunte Fahrradhelme tragen.
Sprachlos hinter dem Stacheldraht
Dem ersten ungläubigen Staunen folgt schon bald ein Gefühl abgrundtiefer Fremdheit und Ausgegrenztheit. Besonders schwer für ein pubertierendes Mädchen, das mit der Familie in den beengten Verhältnissen eines stacheldrahtumzäunten Asylantenwohnheims landet und die hilflose Unterwürfigkeit der Eltern miterleben muss. »Ich sehe, höre, rieche, schmecke, taste ihre Unsicherheit, werde sie nie wieder los.« Nur die Großmutter lässt man im Glauben, ihr Jiddisch würde dem hier gesprochenen Schwäbisch weitgehend ähneln. Doch all die sorgsam gehorteten Diplome und Urkunden werden in Deutschland nicht anerkannt. Wie fühlt es sich wohl für die Mutter an, »die beinahe fünfzigjährige Ingenieurin, die Universität mit summa cum laude abgeschlossen, in einer fremden Sprache irgendwo anzurufen, um zu fragen, ob sie vielleicht ein fremdes Haus putzen darf?« Der einst selbstbewusste Vater verstummt fast gänzlich.
Magie der Sprache
Dass sich die junge Lena aus der Beklemmung des Andersseins zu emanzipieren vermag, ist letztendlich ihrem Ehrgeiz zuzuschreiben – und der Magie, der Macht, den Möglichkeiten der Sprache. Doch je enthusiastischer sich das Mädchen vorankämpft, desto weiter entfernt es sich von seiner Herkunft, fast wie eine Verräterin. »Das Wort Streberin lässt sich ins Russische nicht übersetzen.« Und noch drei Jahrzehnte später, als längst arrivierte Schriftstellerin (eines ihrer Bücher trägt den ironischen Titel »Sie sprechen aber gut Deutsch«), kostet es Lena Gorelik unermessliche Anstrengungen, das offensichtliche Sakrileg zu übertreten und unverschlüsselt über die Familie zu schreiben. Über die Scham, die Schmach, die erlittenen emotionalen Schmerzen.
Lena Gorelik weiß, wie es sich anfühlt, wenn die ehemals kompetenten Eltern aufgrund von Sprachschwierigkeiten zu entmündigten Bittstellern degradiert werden. Wenn man notgedrungen jeden Tag Pizza isst, weil das Wort Ofenkartoffel durch seine unberechenbare Abfolge von kurzen und langen Vokalen zu ungewollten Lachern führen könnte. Nicht umsonst werden den Lesern manche Episoden aus Wer wir sind so bekannt vorkommen wie ewig tradierte Familiengeschichten, die sich durch ständig wiederholtes Erzählen und Zitieren immer tiefer in die Erinnerung eingraben. Manchen Erlebnissen dürfte man bereits in Goreliks Erstlingswerk Meine weißen Nächte (2004) begegnet sein, damals noch der Protagonistin Anja zugeschrieben. Zahlreiche Romane, Preise und Würdigungen später kann die Fiktionalisierung aufgehoben werden. So lässt sich Wer wir sind wie eine stolze Liebeserklärung an Heimat und Herkunft lesen, letztendlich auch wie eine warmherzige Versöhnung mit den Eltern.
Titelangaben
Lena Gorelik: Wer wir sind
Berlin: Rowohlt 2021
316 Seiten. 22.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe