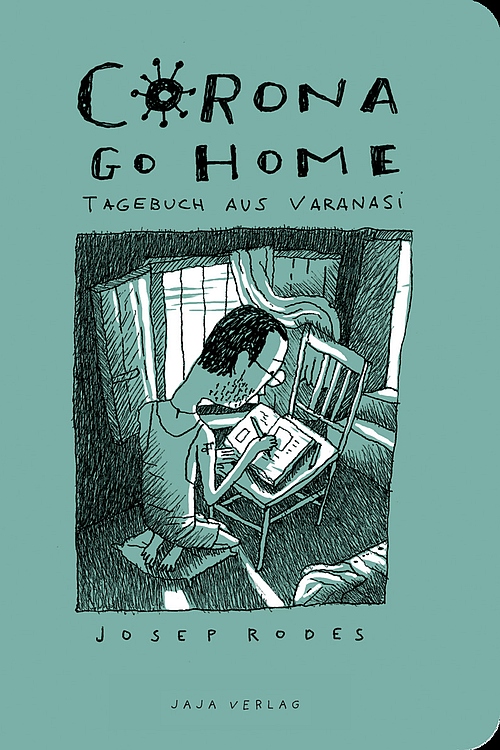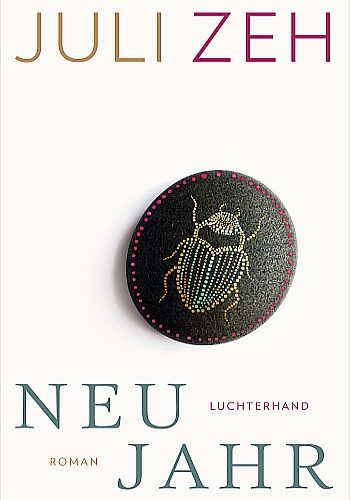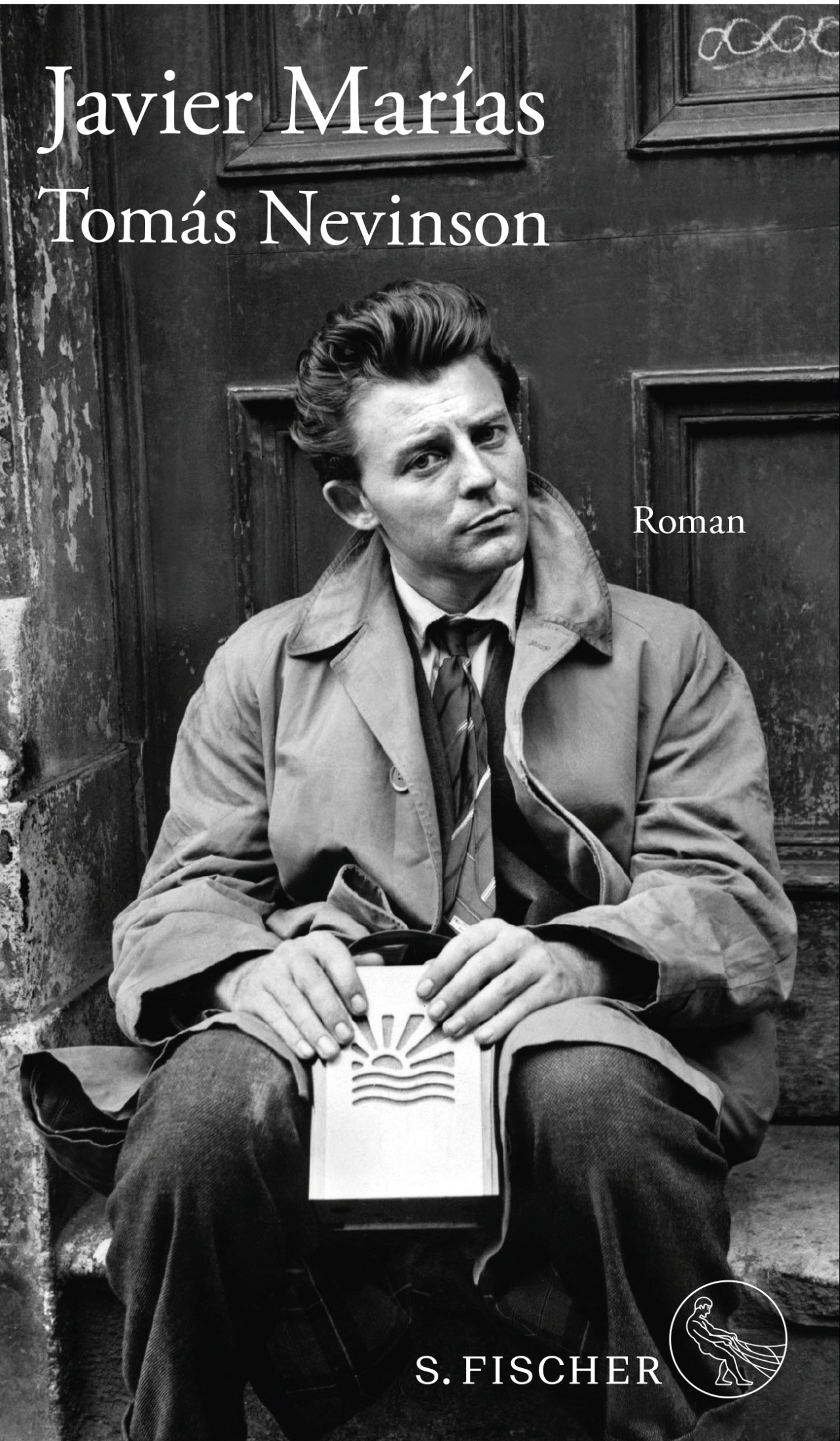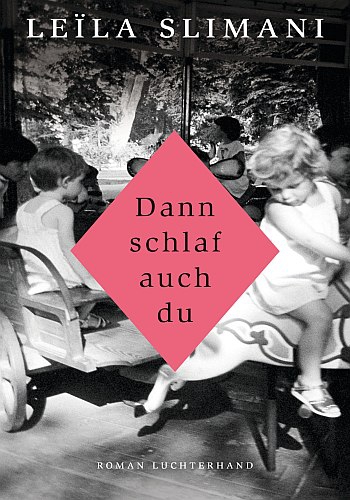Nach seinen drei hochgelobten Bänden um die blinde Elitepolizistin Jenny Aaron steht im Mittelpunkt von Andreas Pflügers neuem Roman Ritchie Girl erneut eine Frau. Paula Bloom – ausgebildet in Camp Ritchie in Maryland, daher der Romantitel – gehört zu den Angehörigen des Womans Army Corps (WAC), einer speziellen, 1943 gegründeten Armeeeinheit, in der Frauen, die die USA im Krieg gegen Hitlerdeutschland aktiv unterstützen wollten, ihren Platz fanden. Zumeist in der Etappe, als Schreibkräfte, in Lazaretten oder – wie in Paulas Fall – als Dolmetscherinnen eingesetzt, war ihre Stellung doch nicht unumstritten in Zeiten, in denen man den Platz von Frauen meist noch am heimischen Herd verortete. Von DIETMAR JACOBSEN
 Frühling 1945. An Bord der U.S.S. Coleman landet zusammen mit einem Schwesterncorps, das zur Verwundetenpflege nach Europa geschickt worden ist, die in Camp Ritchie ausgebildete Paula Bloom in Genua. Sie gehört nicht zu den »GI Nightingales«, sondern ist aufgrund ihrer Kenntnisse in mehreren Sprachen – nicht zuletzt der deutschen – als Unterstützung für den Geheimdienst der Armee CIC vorgesehen.
Frühling 1945. An Bord der U.S.S. Coleman landet zusammen mit einem Schwesterncorps, das zur Verwundetenpflege nach Europa geschickt worden ist, die in Camp Ritchie ausgebildete Paula Bloom in Genua. Sie gehört nicht zu den »GI Nightingales«, sondern ist aufgrund ihrer Kenntnisse in mehreren Sprachen – nicht zuletzt der deutschen – als Unterstützung für den Geheimdienst der Armee CIC vorgesehen.
Gleich ihr erster Auftrag konfrontiert Paula mit Major Walton Hyde, den sie später in Hessen wiedertreffen wird. In Mailand soll sie mit dem zu der Zeit noch umgänglichen Mann die Verhandlungen mit dem hohen SS-Offizier Walther Rauff, der sich nach der Kapitulation der Stadt mit 200 Getreuen in einem Hotel verschanzt hat, führen. In diesem Mann begegnet ihr zum ersten Mal ein Kriegsverbrecher, der genau weiß, dass Deutsche und Amerikaner über kurz oder lang gemeinsam gegen einen neuen Feind stehen werden, die Sowjetunion. Angst um sich und sein Leben glaubt er deshalb nicht haben zu müssen.
Im Maschinenraum des Kalten Krieges
Mit Ritchie Girl, seinem fünften Roman, wendet sich der 64-jährige, als Hörspiel-, Theater-, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer bekannt gewordene Andreas Pflüger den Anfängen des Kalten Krieges nach 1945 zu. Während in Nürnberg noch über die Strafen für die Spitzen des Dritten Reiches verhandelt wird, beginnt anderenorts schon längst wieder ein fatales Hand-in-Hand-Gehen von Siegern und Besiegten. Denn nach dem Krieg ist vor dem Krieg und wer sich als Erster das Know-how der Deutschen – auf technischem, nachrichtendienstlichem und personellem Gebiet – sichert, verfügt automatisch über eine gute Ausgangsposition für die abzusehenden Konfrontationen in naher Zukunft.
Nachdem sie einen Anschlag in Italien knapp überlebt hat, führt Paulas weiterer Weg nach Wien und schließlich ins hessische Oberursel nahe Frankfurt. Hier betreiben die Amerikaner ein Camp King genanntes Verhörzentrum für hochrangige Nazis, Wehrmachts- und Geheimdienstangehörige. Paula begegnet Hanna Reitsch, der »Paradepilotin des Reiches«, Hitlers »Leibzahnarzt« Hugo Blaschke und anderen dubiosen NS-Karrieristen, die hier gefangen gehalten werden. Vor allem aber um einen Mann soll sie sich kümmern: Johann Kupfer, Deckname »Sieben«, der von sich behauptet, der größte Spion des Zweiten Weltkriegs gewesen zu sein. Paulas Auftrag lautet, sein Vertrauen zu gewinnen und herauszufinden, ob er tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein, und inwieweit auf sein Angebot, in Zukunft für den CIC zu arbeiten, Verlass ist.
Feinde von gestern – Freunde von morgen
Allein Pflügers Heldin kann, obwohl ihre Vorgesetzten bemüht sind, sie von brisanten Dingen, die in Camp King vorgehen, fernzuhalten, die Augen nicht davor verschließen, dass hier ehemalige deutsche Top-Nachrichtendienstler von den Amerikanern hofiert werden, weil man in ihnen ein Versprechen auf die Zukunft sieht. Deshalb ist sie auch nicht verwundert darüber, dass sich sowohl Walton Hyde wie auch Walther Rauff, denen sie hier wiederbegegnet, verändert haben. Aus dem leutseligen Hyde ist ein verschlossener, wortkarger Mann geworden, der von Paula absolute Unterwerfung unter seinen Befehl verlangt und voller Misstrauen ihr gegenüber ist.
Rauff hingegen weiß inzwischen ganz genau, dass Männer wie er oder die unter den Nazis für die Auslandsspionage und Informationsauswertung zuständig gewesenen Arnold Gehlen und Hermann Baun von den neuen Herren nichts zu befürchten haben. Denn es gilt der Spruch von Paulas altem New Yorker Bekannten Allen Dulles, des späteren Gründers und Leiters der CIA: »Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein sauberes hat.«
Mit Paula Bloom hat Andreas Pflüger eine Figur erfunden, über deren exponierte Stellung in der Berliner Vorkriegsgesellschaft sowie ihren weiteren Weg, der sie letzten Endes als Angehörige des Womans Army Corps in das in Schutt und Asche liegende Deutschland und an die Seite jener führt, die bereits in den vergangenen Jahren, wenn es sich wirtschaftlich lohnte, mit den Nazis kooperierten, sich Zeitgeschichte relativ mühelos in Erzählstoff umwandeln ließ.
Es ist vielleicht manchmal etwas viel, was der Autor diese Frau erleben lässt – so ist sie kurz nach ihrer Ankunft in Italien dabei, wenn am 29. April 1945 auf der Mailänder Piazzale Loreto die Leichen Benito Mussolinis, seiner Geliebten Clara Petacci und anderer seiner Getreuen öffentlich zur Schau gestellt werden, und steht gut anderthalb Jahre später auch nur wenige Meter daneben, wenn sich Hermann Göring in der Nacht vor seinem Nürnberger Hinrichtungstermin mit einer Zyankali-Kapsel das Leben nimmt. Dass ihre Arbeit für den CIC sie in ein moralisches Dilemma stürzt, entwickelt sich nach und nach zu ihrem größten Problem. Die Suche nach ihrem Jugendfreund Georg Melzer, ihrer ersten großen Liebe aus den Tagen, als sie dank ihres Vaters, eines wohlhabenden amerikanischen Geschäftsmannes und Lobbyisten, zur Berliner Hautevolee zählte, führt allerdings letztlich in eine große Enttäuschung. Ob Sam Yaeger, der Mann, den sie von ihrer Ausbildung in Camp Ritchie her kennt und den sie in Deutschland wiedertrifft und schätzen lernt, Melzers Stelle an ihrer Seite einnehmen wird, lässt Andreas Pflüger offen. Vielleicht der Hinweis auf eine Fortsetzung?
Von Stefan Heym bis Henry Kissinger
Pflüger hat für seinen fünften Roman umfangreich und gründlich recherchiert. Herausgekommen ist ein Buch, das den Geist der Zeit atmet, in der es spielt. Mit viel Geschick und nicht ohne Humor hat der Autor seine erfundenen Figuren in den historischen Kontext der ersten Nachkriegsjahre eingefügt und für etliche Überschneidungen mit dem Leben von real existierenden Protagonisten der Zeitgeschichte gesorgt. So ist Paula beispielsweise mit den Ritchie Boys Stefan Heym und Klaus Mann bekannt, schaut Letzterem beim Tagebuch-Schreiben über die Schulter und bemerkt die große Traurigkeit am Grunde seines Wesens, während sie Heym als verschlossen und ganz in seinen kommunistischen Idealen aufgehend erlebt.
Sam Yaeger erinnert sich an Begegnungen mit dem Erfinder der Marvel-Comics Stan Lee und Walton Hyde erwähnt den Artikel eines »Observer«-Autors namens George Orwell: »unbekannt […], aber sehr gescheit«. Und wenn sich Henry Kissinger bei einem Essen in Frankfurt über den ebenfalls anwesenden Richard Nixon mokiert und behauptet, er wirke auf ihn »wie ein Vertreter für Unkrautvernichtungsmittel«, so weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht nur nicht, dass er gut zweieinhalb Jahrzehnte später dem 37. Präsidenten der USA Richard Nixon als Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister dienen wird, sondern heutige Leser dürfen hinter dem erwähnten »Unkrautvernichtungsmittel« auch eine Anspielung auf das unter Nixons Präsidentschaft im Vietnamkrieg eingesetzte, hochgiftige Entlaubungsmittel Agent Orange sehen.
Titelangaben
Andreas Pflüger: Ritchie Girl
Berlin: Suhrkamp Verlag 2021
464 Seiten. 24.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
reinschauen
| Leseprobe
| Mehr zu Andreas Pflüger in TITEL kulturmagazin