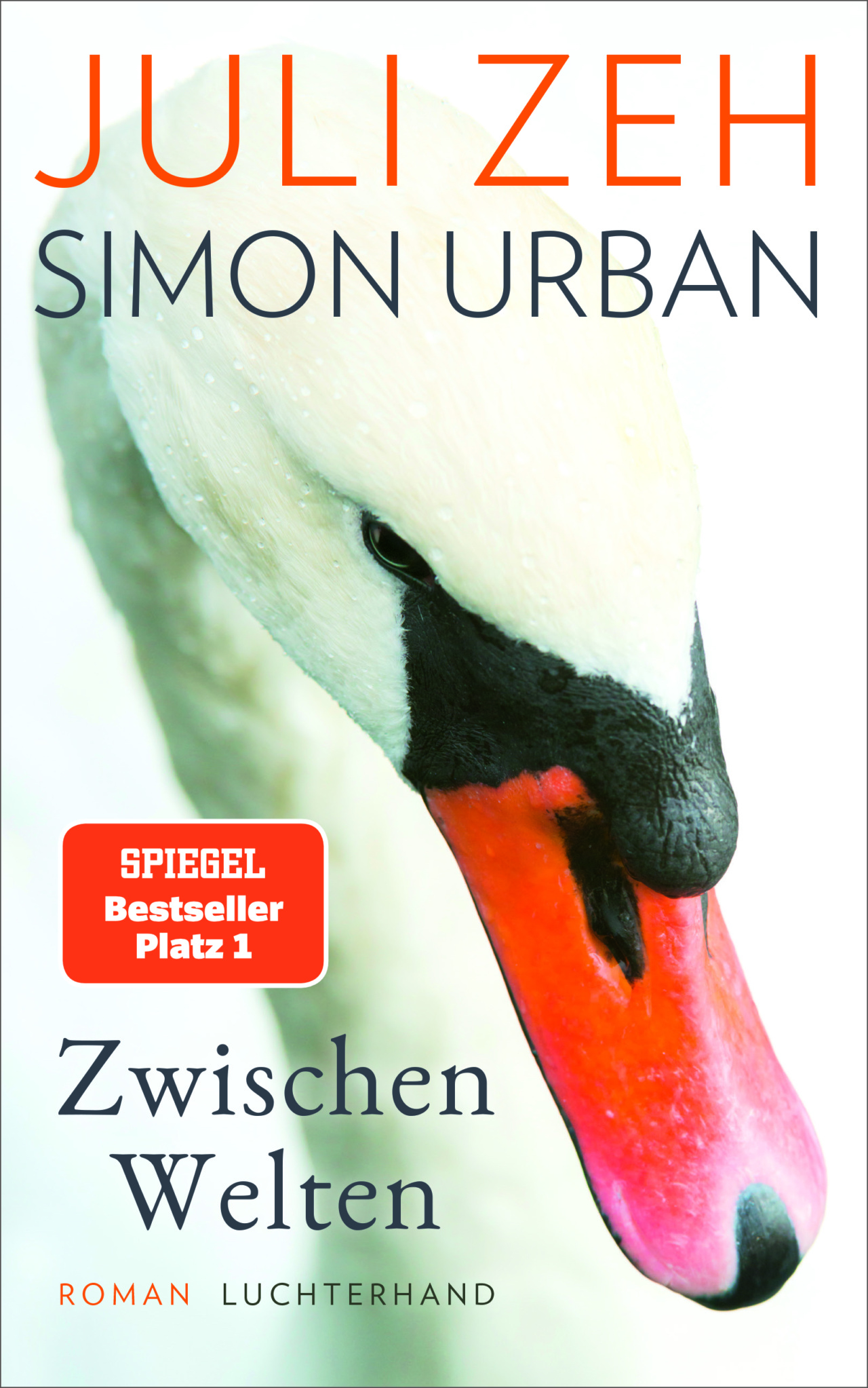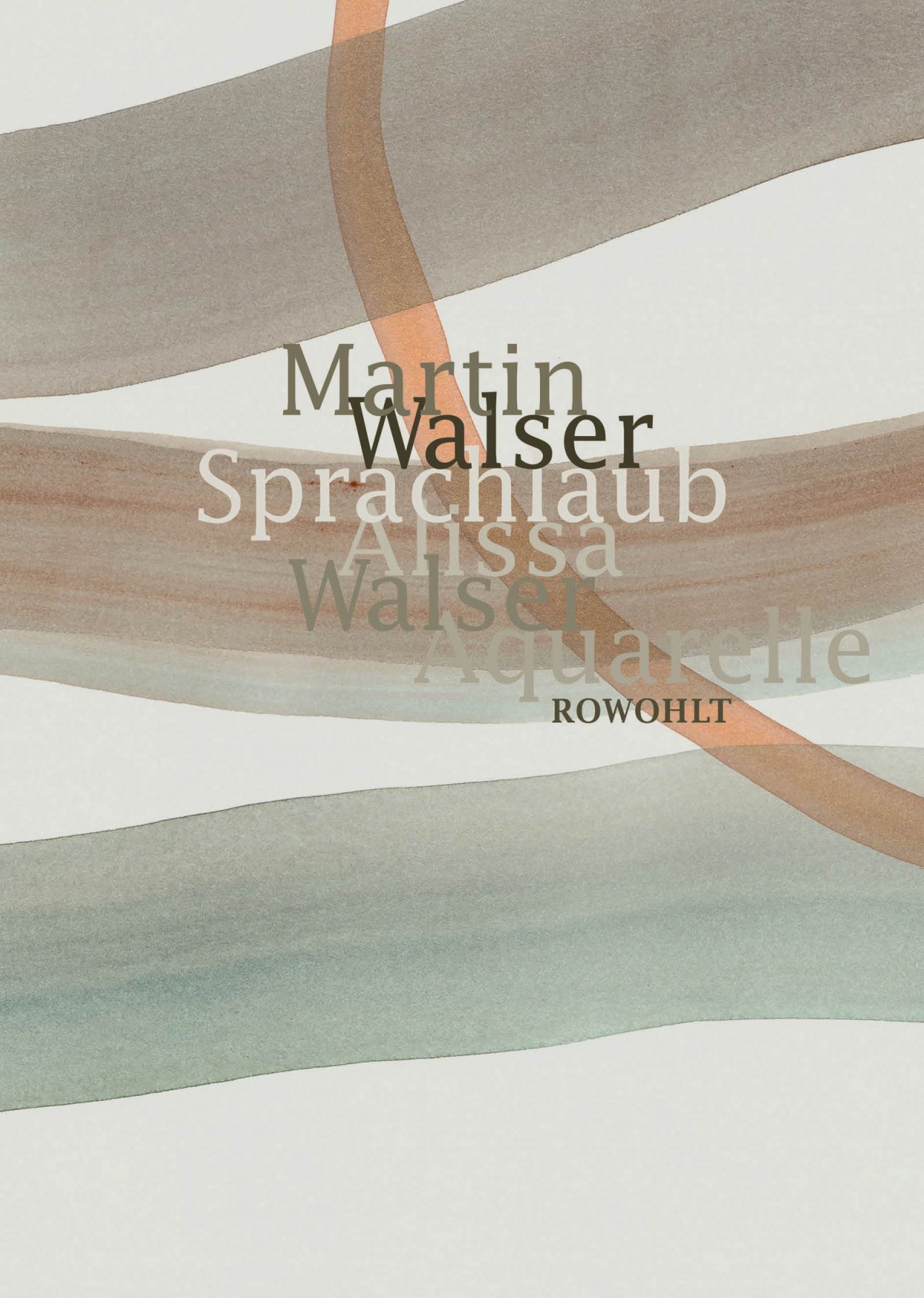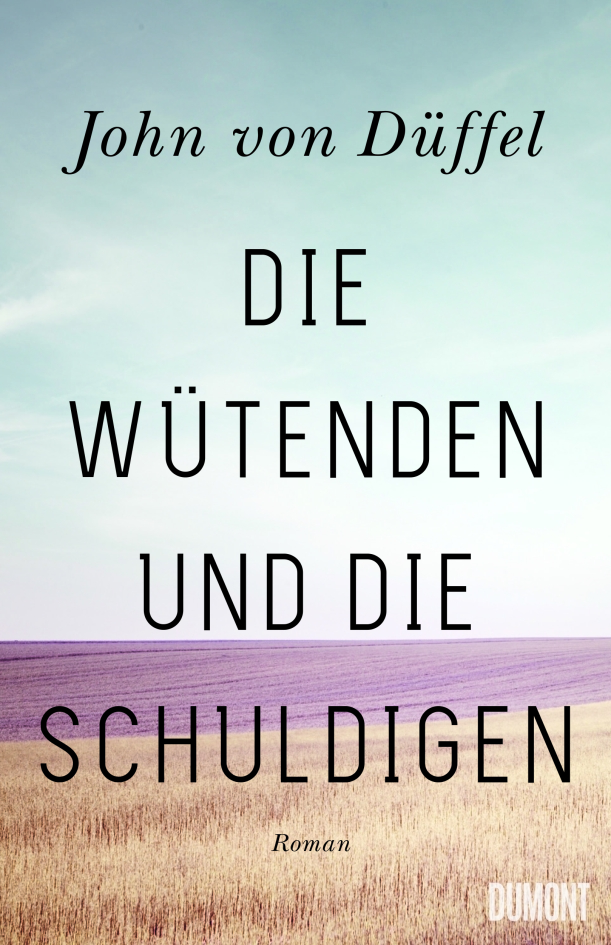Roman | Reinhard Kaiser-Mühlecker: Enteignung
Als der auf dem elterlichen Bauernhof im niederösterreichischen Eberstalzell aufgewachsene Reinhard Kaiser-Mühlecker vor elf Jahren mit dem schmalen Roman Der lange Gang über die Stationen debütierte, wirkte seine Prosa über das bäuerliche Leben in der Provinz wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Längst ist der 36-jährige Schriftsteller kein Geheimtipp mehr. Von PETER MOHR
 Seine Nachfolgewerke offenbarten ein herausragendes sprachliches Talent, und er erwies sich darüber hinaus als exzellenter (Natur)-Beobachter und subtiler Menschenkenner. Jetzt erschien sein neuer Roman Enteignung.
Seine Nachfolgewerke offenbarten ein herausragendes sprachliches Talent, und er erwies sich darüber hinaus als exzellenter (Natur)-Beobachter und subtiler Menschenkenner. Jetzt erschien sein neuer Roman Enteignung.
Kaiser-Mühlecker bewegt sich inhaltlich und formal immer deutlich abseits des literarischen Zeitgeistes, es klingt stets ein wenig melancholisch, wenn er sich im Spannungsfeld zwischen idyllisch anmutendem Landleben und unaufhaltsamen Veränderungen bewegt. Nicht anders verhält es sich in seinem jüngst erschienenen siebten Roman, in dessen Mittelpunkt ein Ich-Erzähler steht, der als Journalist einst für renommierte Zeitungen geschrieben hat, in der Welt viel herumgekommen ist, aber dann vor fünf Jahren in die ländliche Provinz zurück gekehrt ist – ins Haus seiner verstorbenen Tante.
Er lebt mehr oder weniger antriebs- und empathielos in den Tag hinein und arbeitet für ein anzeigenfinanziertes Lokalblatt. Schweinemast und Lokalpolitik prägen seinen ziemlich trostlosen Alltag. »Wie oft schon hatte ich darüber gestaunt, wie tief Menschen empfinden können; das ist eine Fähigkeit, die mir abging, was ich aber nie bedauert hatte«, bekennt der eigenbrötlerisch und extrem introvertiert gezeichnete Ich-Erzähler Jan zu Anfang der Handlung.
Irgendwann erwachen dann in ihm seltsame, kaum zu dechiffrierende Gefühle zur Lehrerin Ines und zur Bäuerin Hemma. Es ist kein »lupenreines« erotisches Begehren, was sich in Jan regt. Seine emotionalen Veränderungen deuten vielmehr daraufhin, dass er sein Alleinsein als Makel empfindet und latent »Besitzansprüche« anmeldet.
Reinhard Kaiser-Mühlecker beschreibt den Wandel in der ländlichen Provinz mit einer elegisch-melancholischen Hintergrundmelodie. Das Bauernpaar (Flor und Hemma) muss rund um die Uhr schuften. Expandieren oder aufgeben? Eine dritte Alternative scheint es nicht zu geben. Irgendwann droht ihnen die Enteignung. Auf einem Teil ihres Landes sollen Windräder installiert werden.
Jahrzehntealte Traditionen, Fixpunkte im Leben der Figuren stehen vor einem unaufhaltsamen Ende. Alles läuft hier unter dem Tempodiktat des vermeintlichen Fortschritts. Dem bäuerlichen Leben und dem seriösen Journalismus hat der Autor (gleichermaßen) diesen federleicht daher kommenden erzählerischen Abgesang gewidmet.
Reinhard Kaiser-Mühlecker, diese verwegene Mischung aus Adalbert Stifter und Peter Handke, ist ein Meister der leisen Aufschreie – einer, der nicht die Wucht der Posaune benötigt, sondern wie mit der Klarinette immer den feinen, den weichen Ton bevorzugt. Trotz seiner »Jugend« hat dieser Autor schon eine singuläre, unverwechselbare Stimme gefunden.
Und wenn er seinen Protagonisten grübeln lässt, bleiben die Leser wieder mit höchst ambivalenten Gefühlen und tief im Innern getroffen zurück: »Ich sah dem Wasser zu, wie es kam und ging und verspürte so etwas wie eine Sehnsucht nach etwas Ganzem in meinem Leben oder danach, dass mein Leben ein Ganzes sei. Nach einer Weile verflüchtigte sich diese Empfindung, und mir kam es nur folgerichtig vor, denn es gab nichts Ganzes.«
Titelangaben
Reinhard Kaiser-Mühlecker: Enteignung
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2019
222 Seiten, 21.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Peter Mohr über Reinhard Kaiser-Mühlecker in TITEL kulturmagazin