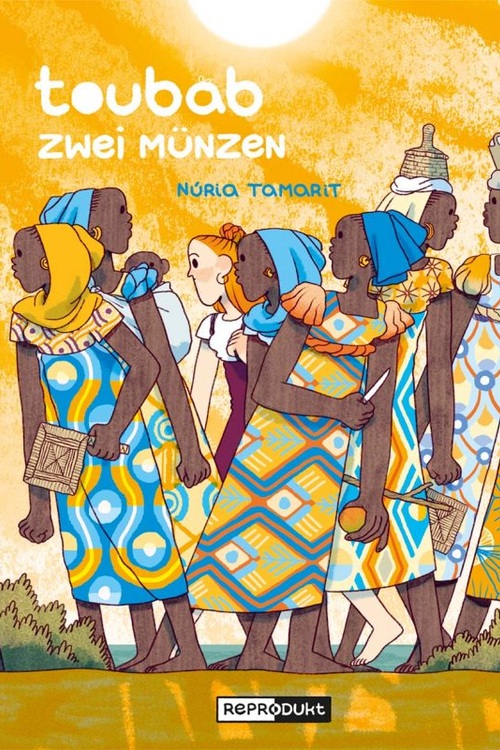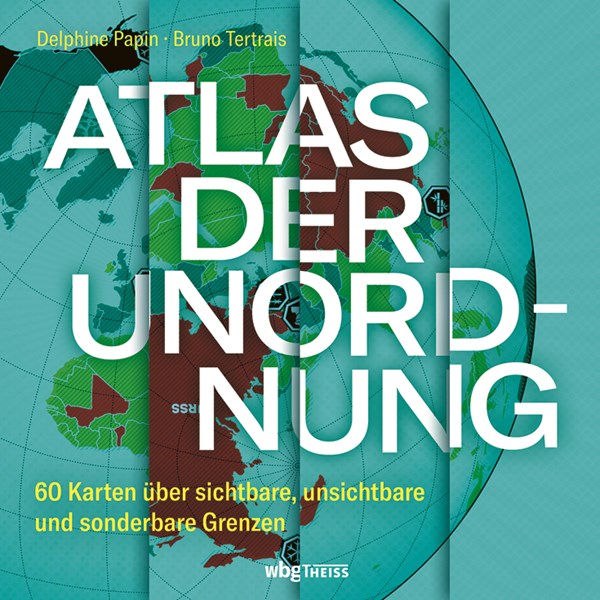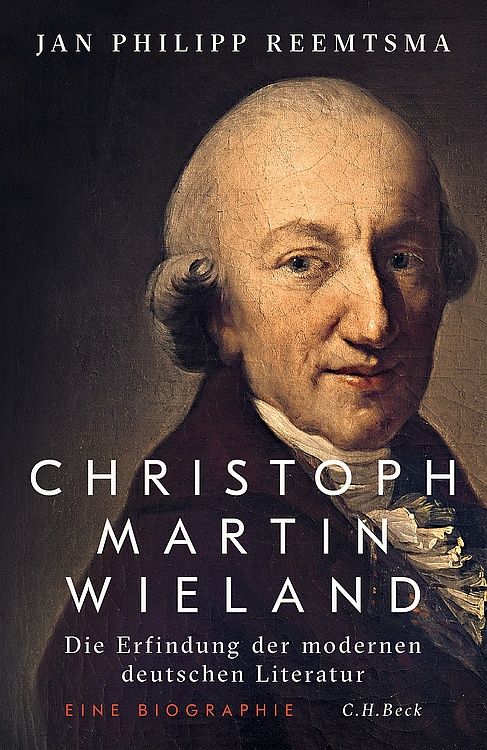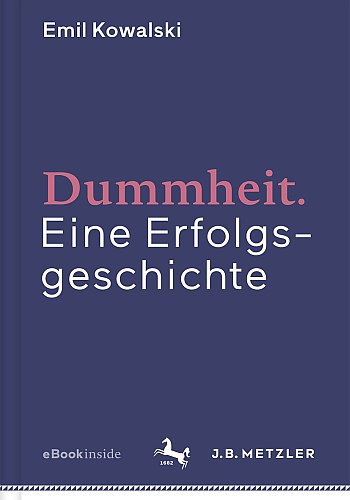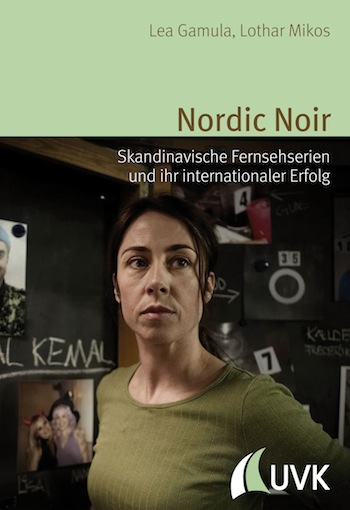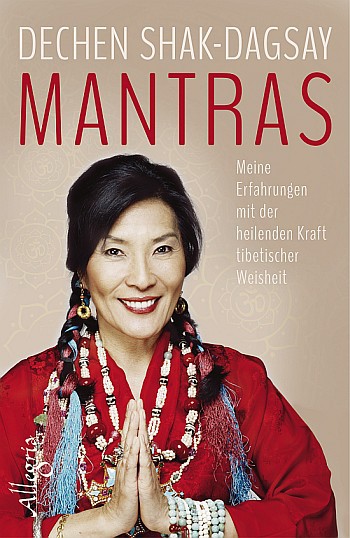Spitzbergen, damit assoziiert man schnell Kälte, polare Klimaverhältnisse, Einsamkeit, karge Landschaft, ewiges Eis, eben weit, weit weg. Befasst man sich etwas genauer mit diesem Ort, beziehungsweise mit dieser Inselgruppe, dann kann es noch so frostig sein, man ist fasziniert von der Geschichte, all dem, was die Inseln erzählen und den wenigen Menschen, die soweit nördlich über dem Polarkreis wohnen. BARBARA WEGMANN hat in dem Bildband geblättert.
 Es sind rund 400 Inseln und Schären im Nordatlantik und Arktischen Ozean, die zu der Inselgruppe Spitzbergen gehören, die größte von ihnen trägt denselben Namen. Die ganze Region gehört zu Norwegen, es leben rund 3000 Einwohner aus zig Nationen dort. Zum Nordpol sind es noch 1000 Kilometer. Soweit die Eckdaten. Was diese Region so ungemein spannend macht und mittlerweile auch in den Fokus internationaler Politik rückt, ist nicht nur die Klimaverschiebung, die Veränderung der Tierwelt und der wirtschaftlichen Verhältnisse rund um diese circa 1600 von niederländischen Seefahrern entdeckte Inselgruppe. Es ist der Kampf um Bodenschätze, um die, die es gibt und um die, die in großen Mengen vermutet werden. Wem gehört das Öl, wem das Gas. Einen Anspruch erheben Dänemark, die USA, Schweden, Norwegen und Kanada, aber eben auch Russland, das auf Spitzbergen lange Jahrzehnte eine russische Bergbausiedlung unterhielt und diese nun neu belebt und ausbaut. Eine, wie es heißt »neu erwachte Leidenschaft Russlands für diese Inselgruppe«. Noch hält der 1914 geschlossene und von 50 Staaten ratifizierte Spitzbergen-Vertrag jede Ordnung auf der Inselgruppe aufrecht, ist Norwegens Souveränität gesichert und garantiert. »Es gelten dort norwegische Gesetze.« Jegliche militärische Nutzung ist demnach untersagt.
Es sind rund 400 Inseln und Schären im Nordatlantik und Arktischen Ozean, die zu der Inselgruppe Spitzbergen gehören, die größte von ihnen trägt denselben Namen. Die ganze Region gehört zu Norwegen, es leben rund 3000 Einwohner aus zig Nationen dort. Zum Nordpol sind es noch 1000 Kilometer. Soweit die Eckdaten. Was diese Region so ungemein spannend macht und mittlerweile auch in den Fokus internationaler Politik rückt, ist nicht nur die Klimaverschiebung, die Veränderung der Tierwelt und der wirtschaftlichen Verhältnisse rund um diese circa 1600 von niederländischen Seefahrern entdeckte Inselgruppe. Es ist der Kampf um Bodenschätze, um die, die es gibt und um die, die in großen Mengen vermutet werden. Wem gehört das Öl, wem das Gas. Einen Anspruch erheben Dänemark, die USA, Schweden, Norwegen und Kanada, aber eben auch Russland, das auf Spitzbergen lange Jahrzehnte eine russische Bergbausiedlung unterhielt und diese nun neu belebt und ausbaut. Eine, wie es heißt »neu erwachte Leidenschaft Russlands für diese Inselgruppe«. Noch hält der 1914 geschlossene und von 50 Staaten ratifizierte Spitzbergen-Vertrag jede Ordnung auf der Inselgruppe aufrecht, ist Norwegens Souveränität gesichert und garantiert. »Es gelten dort norwegische Gesetze.« Jegliche militärische Nutzung ist demnach untersagt.
Die politischen Verhältnisse in den gemäßigten Breiten hier bei uns, der Ost-West-Konflikt, er findet also auch Zugang in den nördlichsten Zipfel dieses Globus, dorthin, wo es bis zu 30 Grad kalt werden kann, die Polarnächte Monate dauern. Der Kampf um jede Seemeile, jede mögliche Probebohrung und Nutzung der Ressourcen, er hat längst begonnen. Dabei ist das Problem so alt wie neu: »Die Menschen sind fast immer nach Spitzbergen gekommen, um etwas zu holen. Witterten noch in den unwirtlichsten aller Welten den Profit, suchten mehr oder weniger eitel nach außergewöhnlichen Abenteuern oder bahnbrechenden Erkenntnissen.«
In den vergangenen Jahrhunderten, als der Reichtum auch an Meerestieren üppig und verlockend war, gingen Holländer, Briten, Russen und Norweger auf Walfang. Auch an Land wurde heftig gewildert: Polarfüchse und Eisbären waren begehrte Beute. Am bedeutendsten aber war der Kohleabbau. »Spitzbergen war ein Land ohne Volk und Herrscher, jeder Einzelne, jede Nation konnte dort das Glück herausfordern.« Das klingt geradezu paradiesisch. Diese Zeiten sind vorbei. Heute macht sich die Region eher mit Tourismus und der Kreuzfahrt-Schifffahrt und insbesondere der Forschung einen Namen. Satellitenbodenstationen, Radarstationen, Observatorien, Messstationen und nach wie vor Kohleabbau.
Viele Informationen für einen Bildband, der schnell gefangen nimmt, in gigantisch entlegene Welten zu entführen scheint, einem aber dennoch schnell die Winzigkeit unserer Erde vor Augen hält: Spitzbergen ist so viel näher, als wir denken. Das macht der Bildband mit eindrucksvollen Fotografien und einem inhaltsreichen Vorwort unmissverständlich klar.
Paolo Verzones Fotografien dokumentieren all dies, die Stille, die Unendlichkeit dieser Landschaft, diesen »Zauber der Arktis«. Es sind Fotos fernab von touristischem Glanz, von Prospekt-Effekten, von werbenden Motiven oder in Szene gesetzten Menschen. Es sind auch nicht jene spektakulären Tier- oder Eisaufnahmen, die sonst ein Bildband versprechen könnte. Wer einmal auf Spitzbergen gewesen sei, so heißt es im Vorwort, werde auch jenes nicht vergessen, das sich schnell einstelle und mehr als eine Ahnung sei, ein Gedanke, der sich nicht mehr verdrängen ließe: »Der Mensch hat hier eigentlich nichts verloren. Abhalten konnte ihn das natürlich nicht.«
Verzones Bilder sind still, halten einfach nur den Atem an und dokumentieren, bilden nur ab. Die Geschichten dahinter, die internationale Problematik, die Fragilität der Natur, die Gefährdung ihrer extremen Schönheit, die Folgen des Klimawandels, diese Fakten und Geschichten werden schnell wach und belebt durch die scheinbar statischen Bilder. Mehrfach bereiste Verzone das »warme Herz der Arktis«, mehrfacher Preisträger des World Press Foto Awards ist er, seine Bilder bereichern Museen und Zeitschriften. Ein genialer Fotograf, voller kühler Distanz, voller Abstand, ein Außenstehender, so mag es den Anschein haben.
Ich halte Verzone für einen Fotografen voller Leidenschaft, der nicht ohne Grund und Überlegung eben jene Motive aussuchte, die er hier präsentiert. Spitzbergen pur sozusagen, unverstellt, ob es die Hinterlassenschaften alter Industrieanlagen sind, die mysteriös und fast außerirdisch erscheinenden Radarstationen vor dunklem Himmel, leere Zimmer und vermeintlich leerstehende Häuser, eine Kirche, die Idylle und Zuhause suggeriert und immer wieder Menschen, die in der eisigen Region ihren Job versehen.
Verzone geht es nicht nur um eine Region, die »geographisch und zivilisatorisch am Rande liegt«, es geht dem italienischen Fotografen darum, Aufmerksamkeit, Interesse und Anteilnahme zu wecken für eine Region, die zwar voller zeitloser Schönheit ist, die aber auch eine Zeit großer Veränderungen erlebt.
»Wer nach Spitzbergen reist, kann neuerdings ein besonderes Souvenir mitnehmen: geschmolzenes Gletschereis, in Flaschen abgefüllt. Eine kostet knapp 100 Euro, ihr Inhalt, so heißt es, sei 4000 Jahre alt und das reinste und wohlschmeckendste Wasser der Welt.«
Titelangaben
Paolo Verzone: Spitzbergen
Herausgeber: Nikolaus Gelpke
Essay: Martina Wimmer
Hamburg: Mare Verlag 2022
132 Seiten, 58 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander