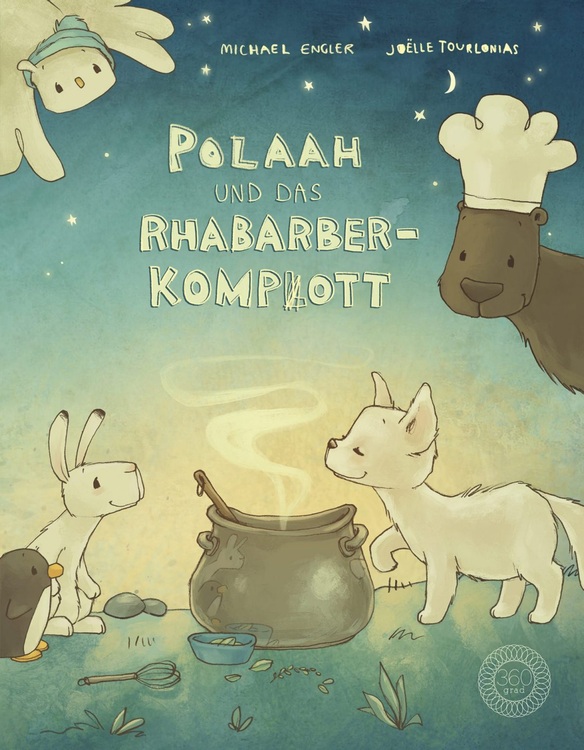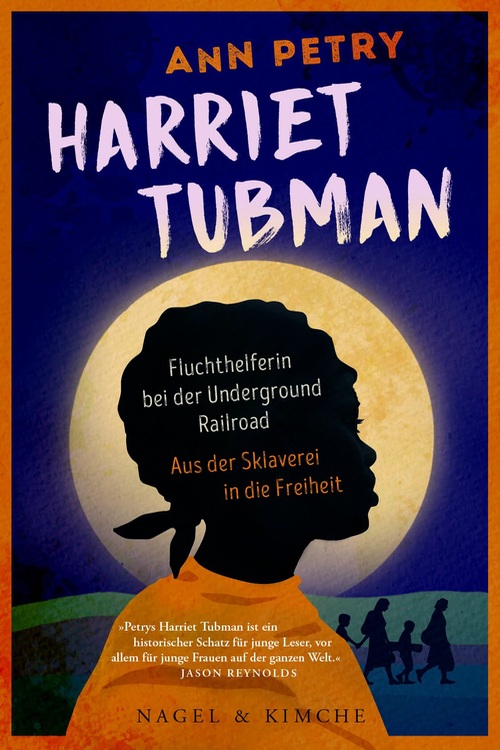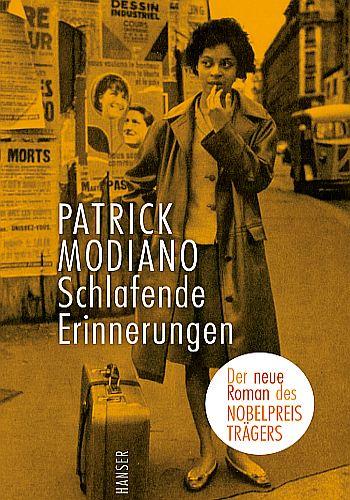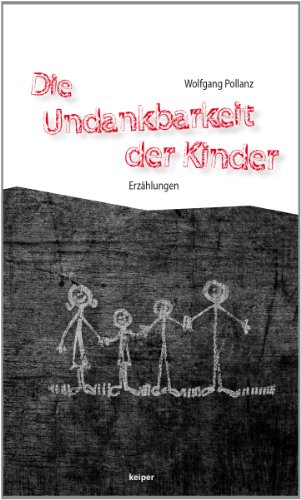Nobelpreisträger JMG Le Clézio schreibt in Bretonisches Lied über seine Kindheitserinnerungen an den Krieg. Von PETER MOHR
 »Als die Bombe explodierte, war ich noch ein Kind, das seine Gefühle nicht in Worte fassen konnte. Mein ganzes Wesen ist in diesem Schrei.« So beschreibt der inzwischen 82-jährige französische Schriftsteller Jean-Marie-Gustave Le Clézio Erinnerungen an seine Kindheit, die im zwei Erzählungen umfassenden Band Bretonisches Lied vorliegen.
»Als die Bombe explodierte, war ich noch ein Kind, das seine Gefühle nicht in Worte fassen konnte. Mein ganzes Wesen ist in diesem Schrei.« So beschreibt der inzwischen 82-jährige französische Schriftsteller Jean-Marie-Gustave Le Clézio Erinnerungen an seine Kindheit, die im zwei Erzählungen umfassenden Band Bretonisches Lied vorliegen.
Als Le Clézio im Oktober 2008 völlig überraschend der Nobelpreis für Literatur zugesprochen wurde, rühmte ihn die Stockholmer Akademie als »Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteuers und der sinnlichen Ekstase – ein Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation.«
Mit dem Roman Alma (2020) hatte er zuletzt eine verschachtelte, polyphone, biografische Grenzerkundung betrieben und die bittere Armut und den gigantischen Reichtum auf Mauritius, wo er lange lebte, gegenübergestellt.
Nun hat sich der Autor erneut an seiner eigenen Biografie abgearbeitet, die bretonischen Wurzeln seiner Familie erkundet und seine eigenen Ferienerlebnisse in dem kleinen Ort Saint-Marine (20 km südlich von Quimper) aus seinen Erinnerungen frei gelegt. Aus dem einstigen, abgeschiedenen Ferienparadies, in dem er einige Sommer (zwischen 1948 und 1954) verbrachte, ist ein Touristenmagnet geworden. Die Bilder aus seiner Kindheit decken sich überhaupt nicht mehr mit den Eindrücken, die der in die Jahre gekommene Autor im Süden der Bretagne macht. Viele prägnante Bauwerke sind verschwunden, jahrhundertealte Traditionen sind auf dem Altar des Tourismus geopfert worden, die bretonische Sprache scheint vom Aussterben ebenso bedroht zu sein, wie die für diese Region einst so typischen Fischer.
Le Clézios Erzählungen sind von einem elegischen Tonfall geprägt. Er klagt nicht über den Wandel, er konstatiert ihn leise und ohne Pathos – mutmaßlich mit einer Träne im Augenwinkel. Offenbar hat der Nobelpreisträger den Nerv vieler Landsleute getroffen, denn das schmale Bändchen avancierte in Frankreich im Nu zum Bestseller.
Ungewollt hat die zweite Erzählung »Das Kind und der Krieg« eine traurige Aktualität gewonnen. Unweigerlich denkt man sofort an die Ukraine, an das unsägliche Leid, das vor allem auch den Kindern widerfährt, an ihre traumatischen Konfrontationen mit Gewalt und Tod. Zwischen den Zeilen lässt uns Le Clézio – gespeist aus seiner eigenen Erfahrung – wissen, dass Krieg nicht nur auf den Schlachtfeldern stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Kinder.
Seine Eltern hatten sich einst in der Bretagne kennen gelernt. Als der Krieg ausbrach, war seine Mutter schwanger. Alles was er schreibt, habe seine Wurzeln in seiner vom Krieg geprägten Kindheit. Und die Erinnerungen an den Krieg bleiben für Le Clézio ein diffuses, kaum zu beschreibendes Gefühl (»Ich kann nicht objektiv darüber sprechen.«).
Er berichtet über einen rothaarigen Jungen, der etwas älter war als er selbst und sich früh der Résistance angeschlossen hat. Auch das eine traumatische Erinnerung. Dieser Junge starb durch eine Bombe, die er selbst gebastelt hatte.
Verluste ziehen sich wie ein roter Faden durch das Bretonische Lied. Die eigene Kindheit ein einziger Horror und eine ganze Region, die vom kulturellen Verfall bedroht ist. Kein Buch für den Nachttisch, sondern eines, das sich tief in die Seele seiner Leser eingräbt und Spuren hinterlassen wird. »Mein Körper schreit, nicht meine Kehle. Ich habe diesen Schrei nicht gewollt. Ich habe diesen Augenblick nicht gewollt.«
Titelangaben
J.M.G. Le Clézio: Bretonisches Lied
Zwei Erzählungen
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
Köln: Kiepenheuer und Witsch 2022
186 Seiten. 22 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Mehr zu J.M.G. Le Clézio in TITEL kulturmagazin