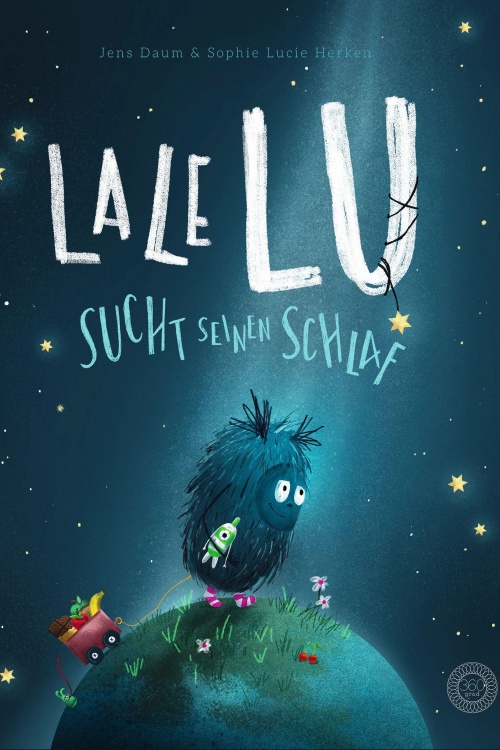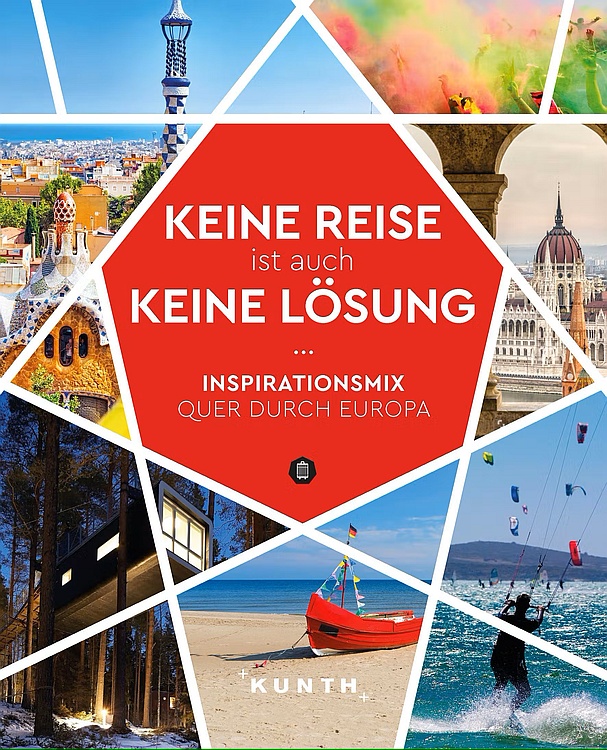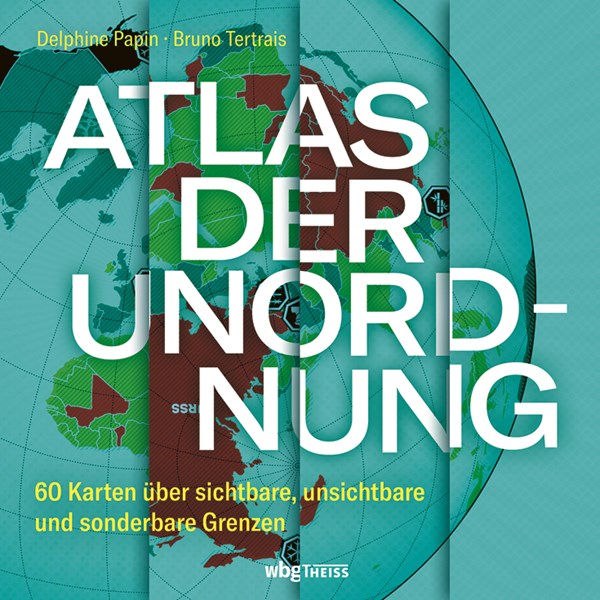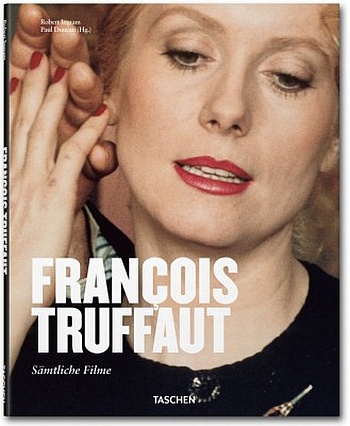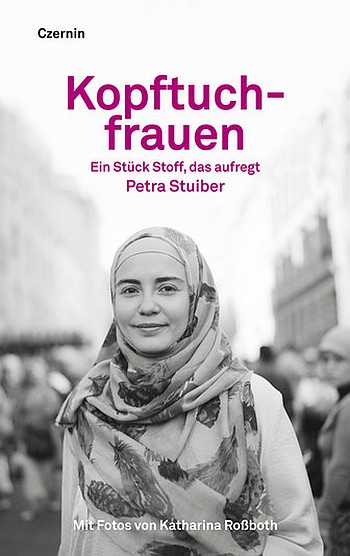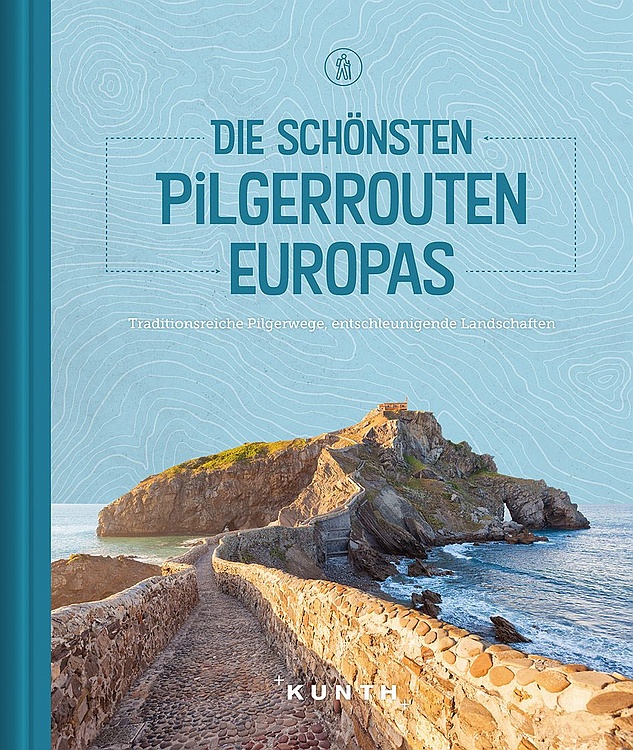Gleich vorneweg, in seinem Titel ist das Buch ›Die Kunst des digitalen Lebens. Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern‹ im Mindesten ungenau, vielleicht sogar »fake«. Das Buch hat nur am Rand mit digitalem Leben zu tun. Hauptsächlich geht es um die Nachrichtenflut, die den modernen Menschen überschwemmt und darum, diese Überflutung zu vermeiden. Insofern trifft der zweite Teil des Buchtitels den Inhalt viel besser. Doch da der Autor des Buchs zuvor die sehr lesenswerten Bücher ›Die Kunst des klaren Denkens‹ und ›Die Kunst des klugen Handelns‹ geschrieben hat, so ist der Titel aus Gründen des Marketings als Reihentitel zu verstehen. Dabei ist dieser zweite Teil des Titels inhaltlich richtig überzeugend geworden, findet BASTIAN BUCHTALECK
»News sind geistige Umweltverschmutzung«
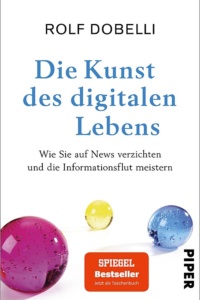 Zu Beginn seines Buchs schreibt Dobelli, dass er vom Teenager-Alter an ein News-Junkie war. Er las Zeitungen und war selig dabei. Dann kam das Internet und Dobelli war nie wieder fertig mit der News-Lektüre. Die Nachrichten kamen schneller nach, als er lesen konnte. Zugleich wurden die Nachrichten immer inhaltsärmer. »Das Jonglieren von News ist sinnleer geworden,« (S. 22) stellt Dobelli entsprechend fest. Für den Journalismus im Digitalen gilt: Zwei News sind doppelt so viel Wert wie eine – unabhängig von der Relevanz.
Zu Beginn seines Buchs schreibt Dobelli, dass er vom Teenager-Alter an ein News-Junkie war. Er las Zeitungen und war selig dabei. Dann kam das Internet und Dobelli war nie wieder fertig mit der News-Lektüre. Die Nachrichten kamen schneller nach, als er lesen konnte. Zugleich wurden die Nachrichten immer inhaltsärmer. »Das Jonglieren von News ist sinnleer geworden,« (S. 22) stellt Dobelli entsprechend fest. Für den Journalismus im Digitalen gilt: Zwei News sind doppelt so viel Wert wie eine – unabhängig von der Relevanz.
Dobelli vergleicht Nachrichten mit Alkohol oder Zucker, Fett und Fast Food. Alles ist im Überfluss vorhanden und macht träge, fett und abhängig. Erst vor nicht zu langer Zeit erkannte man die gesundheitsschädlichen Folgen dieser Stoffe. Folgen, die bei den News ähnlich sind und die darum von Dobelli als geistige Umweltverschmutzung bezeichnet werden.
Seit 2010 ist Dobelli abstinent. Er schaut keine Tagesschau, liest keine Tageszeitung und widersteht auch den nicht zu zählenden Angeboten im Internet. Seitdem geht es ihm besser denn je: »Meine Argumente wurden schärfer, das Lebensgefühl klarer, die Zeit elastischer, die Entscheidungen besser, die Seelenruhe tiefer.« (Buch, S. 202)
Was ist schon relevant?
Die meisten Menschen lesen, hören oder sehen Nachrichten, weil sie sie für relevant für ihr Leben halten. Doch die Relevanz der Nachrichten, so Dobelli, erschöpft sich in ihrem Neuigkeitswert und der veraltet schnell. Echte Relevanz unterscheidet sich von der unterhaltsamen Irrelevanz der Nachrichten.
»Was bedeutet Relevanz nun ganz konkret? Zwei Definitionen. Im engeren, harten Sinn ist etwas relevant, wenn es Ihnen erlaubt, bessere Entscheidungen zu treffen. Im weiter gefassten Sinn ist all das relevant, was Ihnen erlaubt, die Zusammenhänge der Welt besser zu verstehen.« (S. 53)
Hinter dieser Doppeldefinition steht die zentrale These des Buchs. Nachrichten führen nicht zu einem besseren Verständnis der Welt und ihrer Mechanismen. Im Gegenteil, sie stehen dem Verständnis im Weg. Hier zeigt sich eine Einschränkung des Gedankengangs des Schweizers. Denn für Dobelli ist nur relevant, was man für die Arbeit und den ökonomischen Erfolg verwerten kann. Das ist schade. Schließlich ist gut denkbar, dass man bloß nach individuellem Glück strebt.
Verzerrte Welt ohne Chance auf Einfluss
Die Nachrichtenflut verhindert allerdings nicht nur, dass man einen klaren Gedanken fassen kann. Regelmäßiger Nachrichtenkonsum führt zudem zu einer verzerrten Weltsicht. Denn wer sich regelmäßig den Nachrichten aussetzt, schätzt viele Risiken für sein Leben falsch ein. Nachrichten berichten meist über negative Ereignisse, Katastrophen, Krieg, Gewalt – in der Folge überschätzt man die Risiken und sieht das Leben negativer, als es ist.
Zudem ist es so, dass man auf die Geschehnisse, über die in den Nachrichten berichtet wird, keinen Einfluss hat. Wenn man bedenkt, dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit enorm wichtig für uns Menschen ist, dann verdichten sich negative Nachrichten, auf die man keinen Einfluss nehmen kann, zu unangenehmer Hilflosigkeit.
Wer sich von Nachrichten abwendet, wendet sich auch von dem Gefühl der Hilflosigkeit ab. Von nun an kann man die Dinge, die einen umgeben, beeinflussen und die Dinge, die einen umgeben, sind meist schöner, als das, worüber die Nachrichten berichten. Individuell betrachtet, ist der Verzicht auf Nachrichten also eine persönliche Win-Win-Situation.
Information ist Überflussware – Aufmerksamkeit Mangelware
Es ist paradox. Wir haben Dank Automatisierung und Digitalisierung mehr Zeit als je zuvor und zugleich sind wir derart gehetzt, dass wir schon lange keine Ruhe mehr finden. Die Nachrichten dienen zur Illustration dieses vermeintlichen Paradox. Dobelli rechnet in Arbeitszeit (8 Stunden am Tag) vor, dass man auf das Jahr gesehen einen knappen Monat mit Nachrichten verbringt. Zeit, die anderswo fehlt.
Gemeinsam mit Film- und Serienstreaming, Sportereignissen, Unterhaltungsshows und so vielen weiteren Dingen wird unsere Aufmerksamkeit überreizt. Wir lenken uns so sehr ab, dass keine Zeit mehr für Fokussierung bleibt.
Allerdings wird nicht nur die Aufmerksamkeit aufgesogen, sondern auch die Willenskraft gestresst. Ständig muss man entscheiden, worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt. Hierbei ist die Willenskraft gut mit einem Muskel zu vergleichen, der ermüdet, wenn er belastet wird. Das hat der amerikanische Psychologieprofessor Roy Baumeister herausgefunden. Zu viele Nachrichten führen zur Willenskrafterschöpfung (willpower depletion). Das dürfte jeder kennen: irgendwann am Abend kann man häufig einfach keine Entscheidung mehr treffen.
Was Dobelli außer Acht lässt
Bei allen überzeugenden Gedanken, eines berücksichtigt der Autor nicht. Nachrichten erzeugen häufig auch eine Form der Lust. Angstlust meist, manchmal aber auch die Freude darüber, dass jemand einen Erfolg erzielt hat, für den man votiert. Der Sport ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn der favorisierte Sportler oder Verein einen Erfolg erzielt, so freut man sich mit. Diese Stellvertretergefühle sind wichtig für Menschen und zwar nicht erst seit kurzem, sondern wahrscheinlich schon immer. Immerhin entstammt der Spruch von Brot und Spielen einer Zeit, die seit knapp 2000 Jahren vergangen ist. Nachrichten sind also auch ein Gefühlskatalysator. Zudem erzeugen Nachrichten ein Gemeinschaftsgefühl. Man weiß, was alle wissen, man ist informiert.
Dies hat für Dobelli jedoch keinen Wert, da es nicht für die Arbeit und somit nicht ökonomisch verwertbar ist. Die gewonnene Zeit, die nicht verschleuderte Willenskraft – beides zählt in »Die Kunst des digitalen Lebens« nur, wenn sich daraus Arbeit generiert. Zumindest entsteht dieser Eindruck beim Lesen. News sind nämlich dann erlaubt, wenn sie aus dem eigenen Arbeitsfeld kommen. Im Bereich der Arbeit will man schließlich informiert sein.
Die gute Nachricht: Halten Sie bloß 30 Tage durch
Wenn man Leben ändern will, dann muss man zu Beginn 21 bis 30 Tage Durchhaltevermögen aufbringen, hat die Wissenschaft herausgefunden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so lange dauert es, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert hat. Danach folgt der Mensch seiner neuen Gewohnheit deutlich leichter.
Darum schlägt Dobelli vor, dass man zunächst für 30 Tage komplett auf Nachrichten verzichtet. Nach dieser Zeit wird man merken, dass man nichts wichtiges verpasst hat. An einem einfachen Beispiel zeigt sich dies: man liest eine Zeitung, die schon 30 Tage alt ist. Eindrücklicher wird der Effekt noch, wenn man Nachrichten liest, die 30 Jahre alt sind. Sobald sich der Neuigkeitswert auflöst, verschwindet auch die vermeintliche Relevanz. Zurück bleibt unterhaltsame Irrelevanz.
Ein Erfolg für Dobelli
›Die Kunst des digitalen Lebens. Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern‹ liefert auf rund 200 Seiten sehr viele Argumente, warum man konsequent auf Nachrichten verzichten sollte. Das Buch ist mehr als nur ein Schlaglicht, es ist eine gelungene Streitschrift und zeigt einen Weg zu mehr Lebenszufriedenheit.
Titelangaben
Rolf Dobelli: Die Kunst des digitalen Lebens
Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern
München: Piper Verlag 2019
256 Seiten, 12 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander