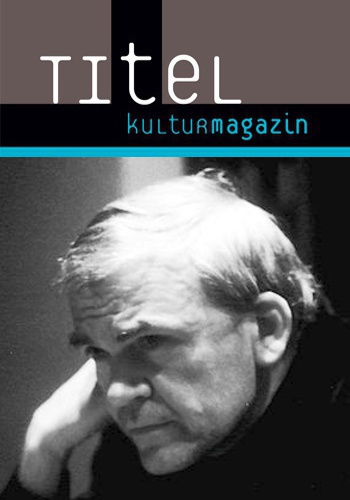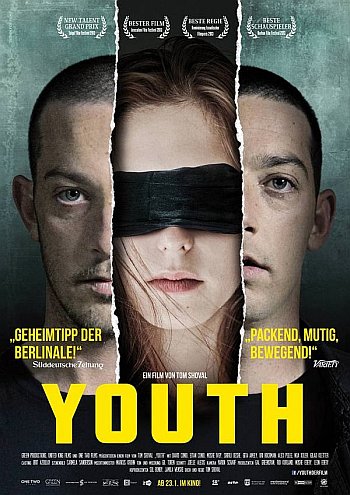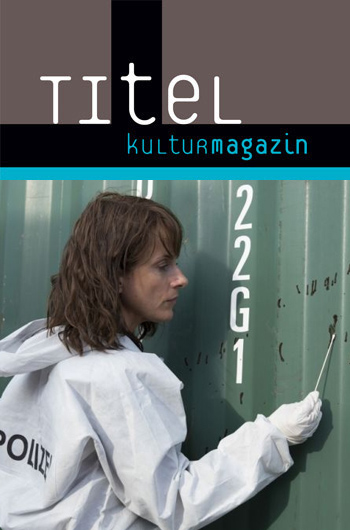SABINE MATTHES im Gespräch mit Barbara Off, Leiterin des Afrika-Fokus beim Internationalen Dokumentarfilmfestival München, zum zehnjährigen Jubiläum von DOK.network Africa
Sabine Matthes: Frantz Fanon sagte, zum Abschütteln der Kolonialzeit gehöre nicht nur, als Opfer darüber zu lamentieren, sondern auch, etwas Neues zu kreieren. Afrikanische Filmemacher demonstrieren solche Zutaten zu dem, was Filmkunst der Menschheit gegeben hat. Die Filmleinwand wurde kreative Arena für Befreiung, Selbstfindung und Empowerment. Der senegalesische Schriftsteller und Regisseur Ousmane Sembène gilt als »Vater des afrikanischen Films«. Geboren 1923, wurde er 1944 in die französische Armee eingezogen, um im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland zu kämpfen.


Copyright: © Mostra de Cinema
Barbara Off: Es ist tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, dass sich in den frankophonen Ländern des westlichen Afrikas eine umfassendere Filmkultur verfestigt hat. Mehr (Spiel-)Filme werden realisiert, da sie von Frankreich finanziell unterstützt werden. Langsam scheint sich dieses Erbe des Kolonialismus auszugleichen. Heute können Filmemacher*innen aus ganz Afrika vielfältige internationale Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel den HotDocs Blue Ice Fund des HotDocs Dokumentarfilmfestivals in Toronto, dem IDFA Bertha Fund des International Documentary Film Festivals in Amsterdam, oder dem DOHA Film Institut in Katar.
 Inzwischen gibt es auch erste afrikanische Filmförderungen wie den ostafrikanischen Filmförderfond DOCUBOX in Nairobi. Staatliche Filmförderungs-Institutionen wie zum Beispiel die National Film and Video Foundation (NFVF) in Südafrika, sind eher noch die Ausnahme.
Inzwischen gibt es auch erste afrikanische Filmförderungen wie den ostafrikanischen Filmförderfond DOCUBOX in Nairobi. Staatliche Filmförderungs-Institutionen wie zum Beispiel die National Film and Video Foundation (NFVF) in Südafrika, sind eher noch die Ausnahme.
S. M.: In den USA spiegelte sich das durch die Bürgerrechtsbewegung neu erlangte schwarze Selbstbewusstsein in den Blaxploitation-Filmen der 1970er-Jahre. Finanziell haben sicher deren herrliche Soul- und Funk-Soundtracks von Curtis Mayfield, Marvin Gaye oder Isaac Hayes geholfen, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Und es gab Solidarität zwischen den Künstlern, so unterstützte der etablierte Musiker Bill Cosby mit 50.000 Dollar Melvin Van Peebles ›Sweetback‹ (1971). Die afrikanischen Filmemacher dagegen scheinen eher von einer Nord-Süd-Finanzierung abhängig? Müssen sie sich entsprechend inhaltlich oder ästhetisch den Erwartungen der europäischen Geldgeber und Festivals anpassen?
B. O: Natürlich hat die Nord-Süd-Finanzierung einen Einfluss auf die Filme. Wir haben gerade wieder bei der diesjährigen African Encounters Podiumsdiskussion ›Honoring The Past To Inspire The Future‹ darüber gesprochen. Die kamerunische Filmemacherin Cyrielle Raingou beklagte sich darüber, dass sie den Eindruck habe, dass sie in ihrem Schaffen nicht frei sei. Die internationalen Filmförderinstitutionen hätten die Erwartungen, dass afrikanische Filme immer in einer gewissen Weise politisch sein müssen. Sie hingegen liebe die Kunst des Filmemachens: »I just want to seize a moment, a reality of what I feel.«
S. M.: Sie haben gerade mit Ihrer ›DOK.network Africa‹ Reihe beim Internationalen Dokumentarfilmfestival München Ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Gratuliere! Wie kam es zu diesem Afrika-Schwerpunkt?
B. O.: 2010 übernahm Daniel Sponsel die Festivalleitung des DOK.fest München. Neben anderen Neuerungen wollte er einen Schwerpunkt auf Afrika legen. Gleichzeitig wurden die Stimmen auf dem afrikanischen Kontinent in der Dokumentarfilmszene lauter, dass Afrikaner*innen ihre Geschichten aus eigener Perspektive erzählen wollen: »We need to tell our own stories by ourselves.«

Beim Aufbau des Afrika-Schwerpunktes war uns wichtig, Verbindungen zum afrikanischen Kontinent zu knüpfen, um mit der dortigen Dokumentarfilmbranche in Kontakt und dann auch in den Austausch zu kommen. Mit den Jahren haben wir enge Verbindungen zu Filmfestivals wie dem iREP Dokumentarfilmfestival in Lagos, dem Zimbabwe International Filmfestival in Harare und dem Encounters South African International Documentary Filmfestival in Kapstadt aufgebaut.
 Highlights waren, als 2022 zum ersten Mal ein Film einer Filmemacherin aus Subsahara-Afrika einen unserer Hauptwettbewerbe gewann: ›No Simple Way Home‹ (2022) der südsudanesischen Filmemacherin Akuol de Mabior. Das größte DOK.network Africa-Highlight jedoch gab es dieses Jahr, als die Kamerunerin Cyrielle Raingou mit ihrem Film ›Le spectre de Boko Haram‹ (2023) den DOK.horizonte Wettbewerb gewann. Über die Wegbereiter des afrikanischen Dokumentarfilms wie Safi Faye und Jean-Marie Teno weiß man so gut wie nichts. Diese Welt wollten wir unserem Münchner Publikum öffnen.
Highlights waren, als 2022 zum ersten Mal ein Film einer Filmemacherin aus Subsahara-Afrika einen unserer Hauptwettbewerbe gewann: ›No Simple Way Home‹ (2022) der südsudanesischen Filmemacherin Akuol de Mabior. Das größte DOK.network Africa-Highlight jedoch gab es dieses Jahr, als die Kamerunerin Cyrielle Raingou mit ihrem Film ›Le spectre de Boko Haram‹ (2023) den DOK.horizonte Wettbewerb gewann. Über die Wegbereiter des afrikanischen Dokumentarfilms wie Safi Faye und Jean-Marie Teno weiß man so gut wie nichts. Diese Welt wollten wir unserem Münchner Publikum öffnen.
S. M.: Deswegen zeigten Sie zum zehnjährigen Jubiläum eine Retrospektive. Einer dieser Filme war ›Caméra d´Afrique – African Cinema: Filming Against All Odds‹ (1983) des tunesischen Filmemachers Férid Boughedir, der nach seiner Filmpräsentation dem Münchner Publikum als flammender Erzähler zur Verfügung stand. Er hatte bei Fernando Arrabals ›Viva la Muerte‹ (1971) mitgewirkt, ist einer der bekanntesten Filmkritiker und Historiker des afrikanischen und arabischen Kinos und selbst afrikanischer Filmpionier.
Filmfestivals waren für ihn essenziell wichtige Katalysatoren. Seinen ersten »Befreiungsschock« erlebte er beim Karthago Filmfest 1966 in Tunis, wo der senegalesische Film ›Black Girl‹ (1966) von Ousmane Sembène den Hauptpreis gewann. Es zeigte ihm, dass große Filmkunst nicht nur mit Bergmann, Fellini oder Bunuel aus Europa kommen kann – sondern ebenso gut aus Afrika!
Der zweite Schock traf ihn beim FESPACO Filmfestival 1973 in Ouagadougou. Das erste Mal auf großer Leinwand, unter freiem Himmel, eine lokale afrikanische Sprache zu hören – eine elektrisierende Gemeinschaftserfahrung voller Freude und Stolz. Er spürte, wie kraftvoll und notwendig afrikanische Filme auf Augenhöhe sind, aus eigener Perspektive, als Spiegel.
Es war die Initialzündung, eigene Filme zu machen! Und sich auf eine faszinierende, zehn Jahre lange Entdeckungsreise zu begeben, um die afrikanischen Filmpioniere zu treffen und ihnen mit seiner Homage ›Caméra d’Afrique‹ ein Denkmal zu setzen. Einer seiner Favoriten ist der Senegalese Djibril Diop Mambéty, mit seinem Kultklassiker ›Touki Bouki‹ (1973). Schiffshörner im Hafen, Schlachthofbilder, Möwenschreie, schwarzer Funk, Wind, Sex and Crime verschmelzen zu einem phantasmagorischen Rausch – eine afrikanische ›Easy Rider‹ (1969)-Phantasie. »Es ist die Art, wie ich träume … Du musst verrückt sein bis an die Grenze zur Unverantwortlichkeit«, sagt Mambèty. »In einem Wort, ›Freiheit‹ ist das, was meine Arbeit charakterisiert.« Und, ganz im Sinne von Frantz Fanon: »Ich glaube, dass Afrikaner, im Besonderen, das Kino neu erfinden müssen.«

Copyright: © EZEF