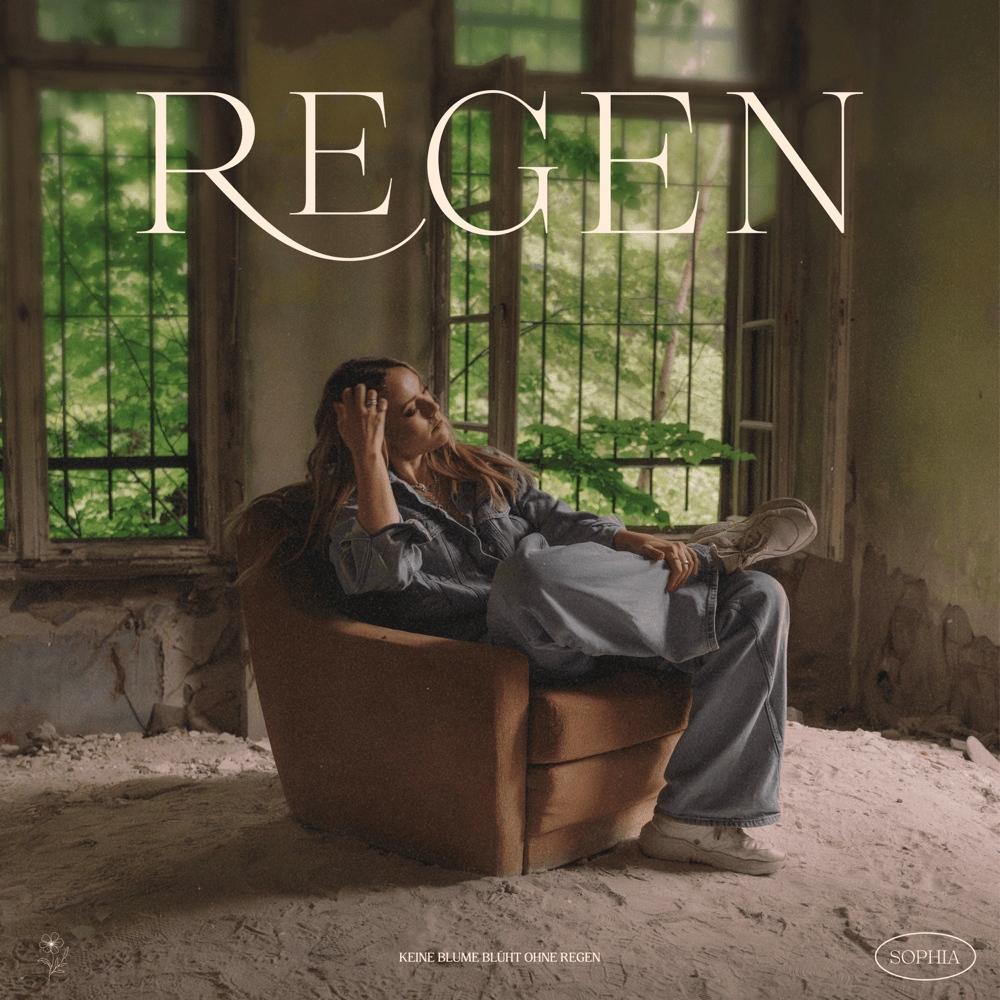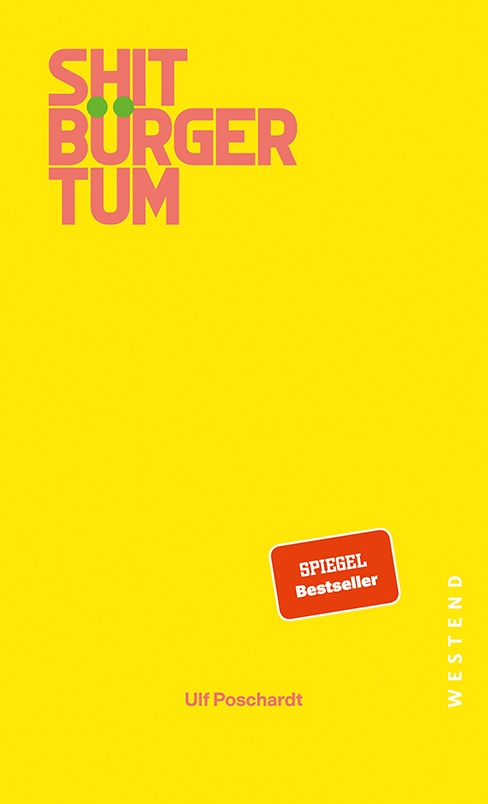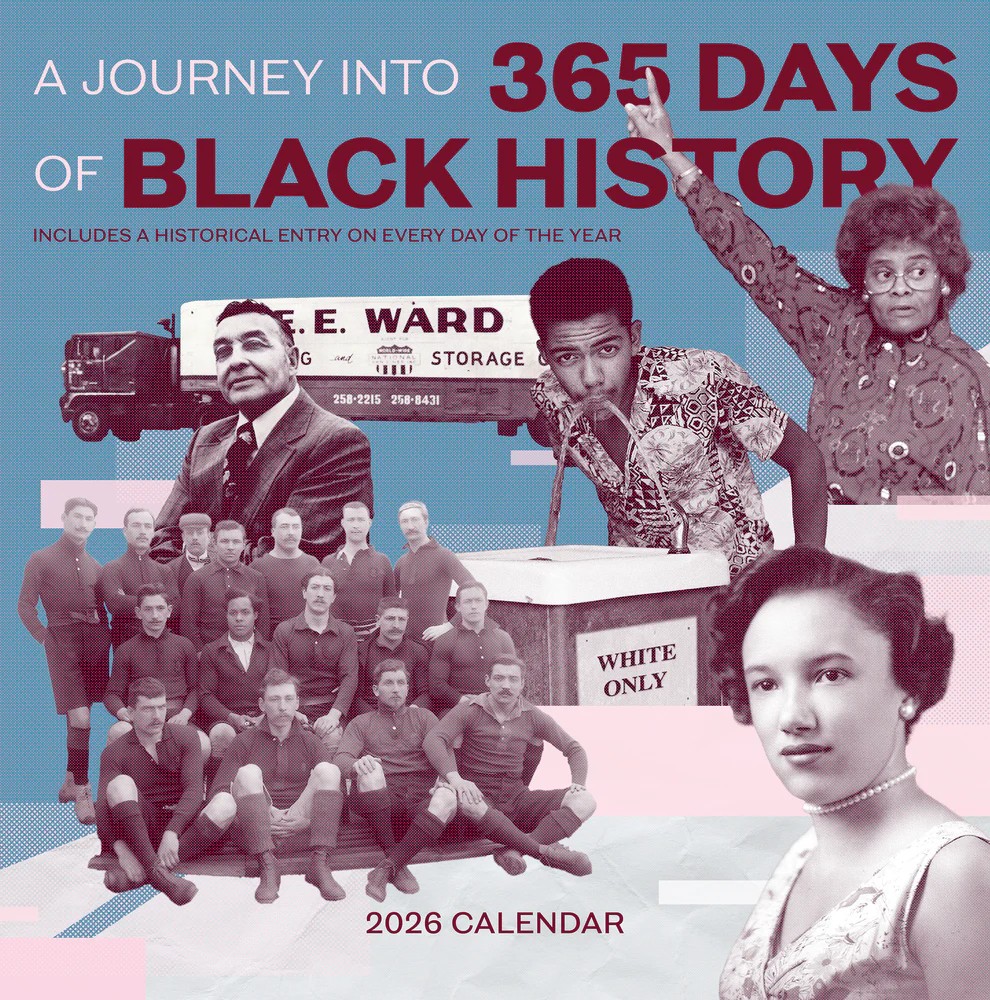Da sitzt man in der Oper und lauscht der schönen Musik – und auf einmal wird Israel überfallen und heroisch Menschen geköpft. Zumindest ist mir das in einer Händel Oper widerfahren. Wer sich von so etwas nicht überraschen lassen möchte, sollte vorbereitet in ein Konzert gehen. Viele Konzerthäuser bieten Einführungsveranstaltungen an, die vorab über ein Stück informieren und den Fokus auf gewisse Punkte lenken. Ist das überhaupt wichtig? Wird dadurch gar der unwiderrufliche erste Eindruck eines Musikstücks vernichtet? Muss Kunst aufgearbeitet werden, bevor sie rezipiert wird? Im Gespräch von MARC HOINKIS mit Professorin Elena Ungeheuer und Tabea Hilser wird einiges deutlich.
Das Geschenk des ersten Hörens
Elena Ungeheuer ist Professorin für Musik der Gegenwart und seit 2011 im Institut für Musikforschung in Würzburg tätig. Sie kennt die Musikgeschichte und ihre weitverzweigten Einflüsse. 2012 verfasste Sie den Essay »Das Geschenk des ersten Hörens«, in dem sie sich mit der unvoreingenommenen Begegnung mit Musik auseinandersetzt. Denn der erste Eindruck kann bekanntlich nicht ein zweites Mal erlebt werden. Würde man also einem Klangereignis mit Vorwissen begegnen, nehme man sich einen Teil der Selbst-Erfahrung weg. Ein Zitat des Komponisten Helmut Lachenmann bringt diesen Gedanken auf den Punkt: »Der Gegenstand von Musik ist das Hören, die sich selbst wahrnehmende Wahrnehmung.« Das leuchtet ein. Aber was ist denn nun mit einer Einführung? Sollte man generell davon absehen?

Gemäß der neueren Kommunikationstheorie fasst Elena Ungeheuer eine Konzerteinführung als sprachliche Handlung auf und kann so die Kriterien festlegen, die für die Bewertung einer solchen Handlung wichtig sind. Dabei erkennt sie die verschiedenen Erscheinungsformen, in denen eine Konzerteinführung stattfinden kann. Ob als Podcast, Beiheft, Fernsehbeitrag oder unmittelbar als Vortrag vor einem Konzert – allen gemein ist, dass sie »die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Wesentliche der angekündigten Darbietung« lenken. Dabei hängt der Anspruch an eine Einführung recht hoch, denn sie hat eine lange Tradition: In Folge einer »Kunstüberhöhung« habe das Bürgertum die Kunst und vor allem die Musik zu einem hohen Wert stilisiert, der nicht mehr das Bedürfnis nach Zerstreuung, sondern nach Bildung befriedigen sollte. So erscheint die Konzerteinführung unerlässlich für alle Hörenden, die sich in diese Tradition einreihen möchten.
So sei auch die Musikwissenschaft als Berufsbild »zeitgleich mit der Etablierung bürgerlicher Konzerte aus der gesellschaftspraktischen Notwendigkeit heraus entstanden, die öffentlichen musikalischen Darbietungen kenntnisreich verbal zu begleiten, zu bewerben und zu ihrer Distribution beizutragen.« Ebenso die Werkanalysen und Werkmonographien, die stets bemüht sind, die »Wahrheit« über ein Werk darzustellen. »Es ist der sich vermeintlich selbst erklärende Radius der sich „objektiv“ rühmenden Wissenschaft schlechthin«, bringt es die Professorin auf den Punkt.
Eine Konzerteinführung, die die Hörenden dazu auffordern würde, eigenen Interpretationen freien Raum zu lassen, würde diesen Radius sprengen und sich aus dem musikwissenschafltichen »Ur-Auftrag« herausnehmen. Und trotzdem sei aus einer gegenwartsorientierten Position heraus die Kunst- und Musikvermittlung keineswegs abzulehnen, vielmehr stehe sie in der eigenen Verantwortung der jeweiligen Institution. Daher hat Professorin Ungeheuer klare Worte: »Selbstverantwortung vereinfacht keineswegs das Geschäft. Selbstverantwortung ist aber ein nicht vernachlässigbarer Pfeiler individueller Freiheit, die einzufordern sich etliche Generationen abgemüht haben. Warum sollten Kunstvermittler dahinter zurückstehen? Seine eigenen Verfahren und Konzepte an einer geeigneten Stelle selbstreflexiv zu erläutern, also transparent zu machen, bleibt immer erstrebenswert für jeden und erscheint in den heutigen Zeiten trivialisierter Fake News, KI-Produktionen und Troll-Kulturen nachgerade obligat.«
Wiedererkennungsmomente schaffen, die das Hörerlebnis vertiefen
Tabea Hilser ist seit 2022 Konzertdramaturgin am Mainfranken Theater und organisiert Konzerteinführungen für verschiedene Konzerte. Sie beobachtet ein generelles Interesse an Einführungsveranstaltungen und kann auch die Besuchenden einschätzen. »Dass das Konzertpublikum älter wird, ist kein Geheimnis und wird durch viele Studien bestätigt. Diese Gruppe besitzt aber schon allein aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung viel Hintergrundwissen, insbesondere geschichtliche und politische Zusammenhänge«, weiß die studierte Musikwissenschaftlerin.
Sie ist der Meinung, dass der historische Kontext bei gewissen Werken durchaus eine Voraussetzung für das Verständnis eines Werkes ist, den es einzuführen gilt: »Nehmen wir beispielsweise die Sinfonien Schostakowitschs, ein Komponist, dessen künstlerische Freiheit in der Stalin-Diktatur massiv eingeschränkt war. Seine Musik ist oft doppelbödig. Vordergründig scheint sie angepasst und offiziellen Anforderungen zu entsprechen, aber dahinter befinden sich viel Ironie und Sarkasmus, die man durch das Wissen des Kontextes vielleicht besser erkennen kann.« Allerdings sei der historische Hintergrund bei anderen Werken weniger entscheidend, da ganz andere Aspekte viel spannender sind, beispielsweise das kompositorische Prinzip oder bestimmte musikalische Mittel.
Auch die Biographie einer Komponistin oder eines Komponisten könne relevant für das Werkverständnis sein, allerdings sei dies auch nicht immer der Fall: »Berlioz‘ Symphonie fantastique erzählt die Geschichte eines Künstlers, der von unerfüllter Liebe getrieben wird. Auslöser der Komposition war Berlioz‘ unerwiderte Liebe zu einer Schauspielerin. Es ist also ein autobiographisches Werk, aber für das Verständnis der Musik ist diese Information eigentlich nicht relevant. Der Fokus sollte eher auf der Geschichte liegen, die die Musik erzählt.«
Politische Kontextualisierung in den Einführungen findet Hilser an vielen Stellen sehr wichtig, denn »manche Dinge kann man einfach nicht unkommentiert so stehen lassen.“ Beispielsweise wurde Prokofjews 5. Sinfonie seinerzeit als »Kriegssinfonie« verherrlicht, sagt aber eigentlich das genaue Gegenteil und könnte sogar als »Anti-Kriegssinfonie« bezeichnet werden. Ohne Einordnung würde ein völlig falscher Eindruck entstehen.
Bei einer Konzerteinführung sei es vor allem wichtig, dass die Musik im Mittelpunkt steht. Dabei soll gar nicht eine Komposition in allen Facetten durchdrungen werden, vielmehr sei es wichtig, was das Werk besonders macht. In der begrenzten Zeit oder dem Platz im Programmheft müssen schließlich oft gleich mehrere Werke eingeführt werden, deswegen seien zentrale Punkte entscheidend, die bei der späteren Begegnung mit der Musik eine Verknüpfung erzeugen. »Ich bin der Meinung, dass man durch die Einführung Wiedererkennungsmomente schafft, die das Hörerlebnis nochmal vertiefen.«
Letztlich stellt Tabea Hilser fest, dass Konzerthäuser einen Bildungsauftrag haben. Und der gilt für das gesamte Publikum. Diese Vermittlungsangebote sollen nicht nur das Interesse an den Werken befeuern, sondern auch dazu anregen, über das Konzert hinaus über Werke nachzudenken und zu diskutieren.
In manchen Fällen geht das Mainfranken Theater sogar noch einen Schritt weiter. So zum Beispiel bei der Aufführung der Zauberflöte, in der im Libretto die Stelle »… weil ein Schwarzer hässlich ist«, umgeschrieben wurde.
Ist das vielleicht die bereits erwähnte »Selbstverantwortung der Kunstvermittler«, quasi in der Exekutiven? Ich finde diesen Ansatz auf jeden Fall nicht schlecht. Denn wieso sollte man Kunst nicht auch anpassen oder modernisieren dürfen? Die Werke bleiben ja trotzdem erhalten. Und das sogenannte »Canceln« ist sowieso nur ein Begriff von Menschen, die nicht verstanden haben, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass auch Betroffene sich äußern – und auch handeln – dürfen.
Und was nun?
Eine klare Antwort scheint es nicht zu geben, denn sowohl das unvoreingenommene Hören sowie der vorbereitete Konzertbesuch können sinnvoll sein – und der erste Höreindruck kann so oder so nicht wiederholt werden. Eine Art »Nachbereitung« hätte den Vorteil, dass man das Geschenk des ersten Hören in Empfang nehmen kann. Aber wer möchte sich nach einer zweistündigen Aufführung noch in den Hörsaal setzen? Vielmehr lauscht man doch danach in sich hinein und spürt die Resonanz oder prüft, was von den Klängen hängengeblieben ist. Die Einführung hingegen weist auf wichtige Stellen hin, um ein Werk in einem gewissen Sinne zu verstehen, so wie es eben die Wissenschaft propagiert. Außerdem können hier vorab Impulse gesetzt werden, die die Aufmerksamkeit auf gewisse Aspekte lenken. So weiß man zwar, wo man hinhören sollte und wie etwaige politische Statements zu verstehen sind, aber die eigene Reaktion auf etwas völlig Neues bleibt einem damit verwehrt. Letztendlich bleibt es wohl Hörenden nur selbst überlassen, doch sollte es allgemeiner Konsens sein, dass ein Werk reflektiert wird. Und zwar in Begleitung einer Instanz wie dem Mainfranken Theater, dessen Mitarbeitende wissen, was sie tun. Danke für eure Kulturarbeit!