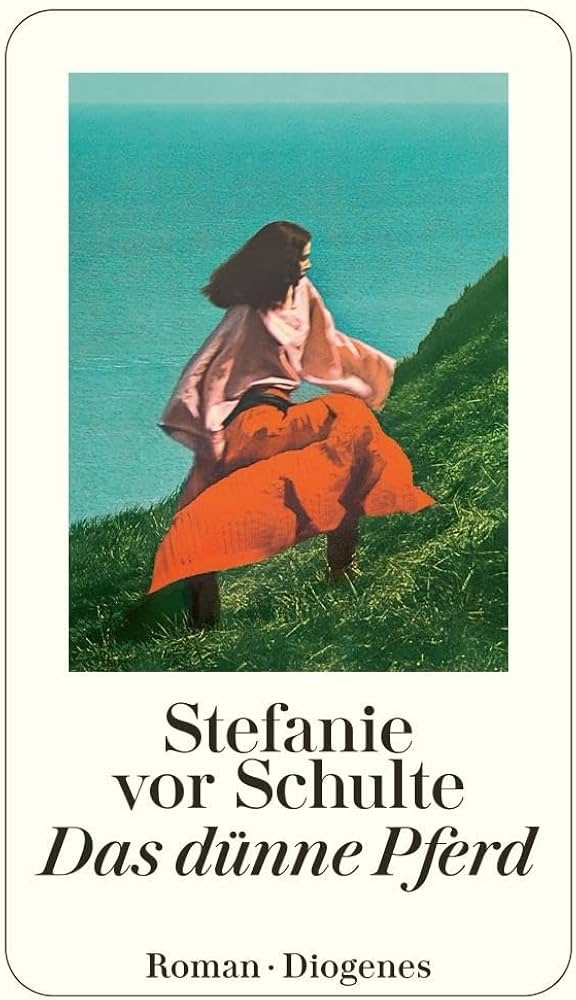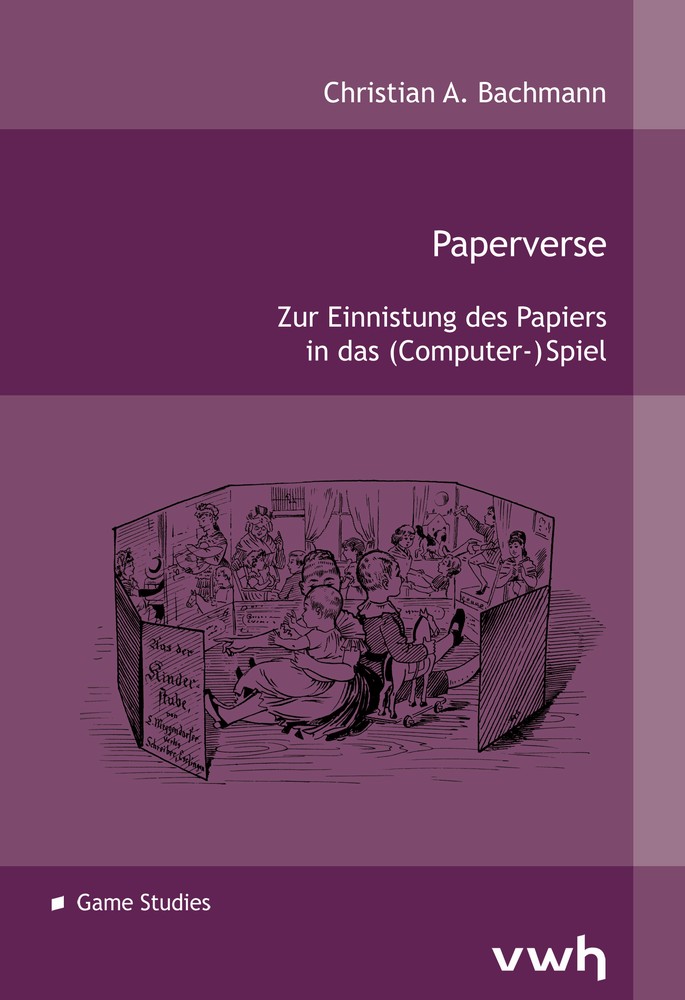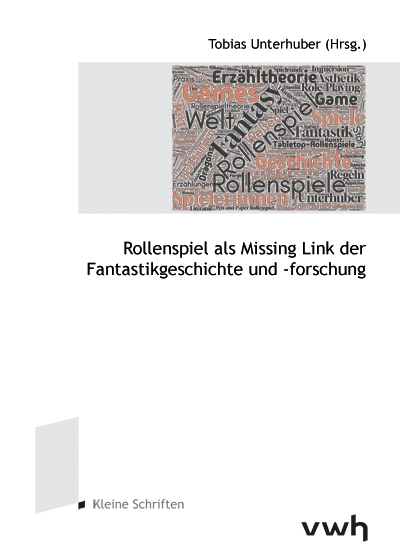Wie das Medium Spiel Lernräume öffnet, Lehrer:innen ausbildet und neue Prüfungsformate inspiriert: Dr. Christian Gebauer, Fachleiter und Seminarleiter am Zentrum für schulische Lehrer:innenausbildung in Solingen, spricht im Interview mit RUDOLF THOMAS INDERST über die Chancen und Herausforderungen des Game-based Learning. Er erklärt, wie digitale Spiele sinnvoll in Lehrpläne integriert werden können, warum Lehrkräfte die „Sprache des Gamedesigns“ lernen sollten und weshalb Schule das Medium Spiel endlich ernst nehmen muss – als Werkzeug für Lernen, Reflexion und Kreativität.
Rudolf Inderst: Guten Tag, Christian Gebauer. Es freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen für ein gemeinsames Nachdenken über das Medium Spiel und seine, nicht nur didaktischen, Potentiale. Vielleicht mögen Sie sich unseren Leser:innen zunächst einmal vorstellen? Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag in Ihrem Leben aus?
 Dr. Christian Gebauer: Guten Tag Rudolf Inderst, herzlichen Dank für Ihre Einladung und das Interesse an meiner Arbeit. Mein Name ist Christian Gebauer und ich bin ursprünglich Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte und ev. Religion. Mein Arbeitsschwerpunkt bildet aber seit einigen Jahren die Ausbildung von Referendar:innen. Ich bin Fachleiter und Kernseminarleiter am Zentrum für schulische Lehrer:innenausbildung in Solingen. Zu meinen Aufgaben gehört hier die fachliche und überfachliche Ausbildung der Lehramtsanwärter:innen und auch die Abnahme von Staatsprüfungen. Darüber hinaus bin ich Fachberater der Bezirksregierung Düsseldorf.
Dr. Christian Gebauer: Guten Tag Rudolf Inderst, herzlichen Dank für Ihre Einladung und das Interesse an meiner Arbeit. Mein Name ist Christian Gebauer und ich bin ursprünglich Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte und ev. Religion. Mein Arbeitsschwerpunkt bildet aber seit einigen Jahren die Ausbildung von Referendar:innen. Ich bin Fachleiter und Kernseminarleiter am Zentrum für schulische Lehrer:innenausbildung in Solingen. Zu meinen Aufgaben gehört hier die fachliche und überfachliche Ausbildung der Lehramtsanwärter:innen und auch die Abnahme von Staatsprüfungen. Darüber hinaus bin ich Fachberater der Bezirksregierung Düsseldorf.
Einen typischen Arbeitsalltag gibt es für mich eigentlich nicht, da meine Tagesstruktur sehr variabel ist. An den meisten Tagen pendle ich zwischen unterschiedlichen Schulen, schaue mir Unterricht an und berate die Referendar:innen vor Ort. Weiterhin gebe ich Unterricht an meiner eigenen Schule. Am Seminartag bin ich ganztägig im Zentrum für schulpraktische Lehrer:innenausbildung und unterrichte meine Referendar:innen im Fachseminar und Kernseminar. Dazu kommen noch Termine und Meetings in der Bezirksregierung Düsseldorf, wo ich mich mit unterschiedlichen Themen befasse, z. B. Aufgabenformate und Lehrpläne.
Ich möchte nun mit Ihnen über Ihr neues Buch ›Game-based Learning in der Schule‹ sprechen. Meine erste Frage kreist um den Komplex der didaktischen Integration. Wie lassen sich die im Buch vorgestellten Konzepte des Game-based Learning konkret in bestehende Lehrpläne integrieren, ohne dass traditionelle Lernziele oder Prüfungsformate darunter leiden?
Das ist eine gute und – aus Sicht der Kolleg:innen – auch eine existenzielle Frage. Mein Ansatz, den ich im Buch beschreibe und welcher sich durch praktische Erprobung in unterschiedlichen Jahrgangsstufen entwickelt hat, integriert die curricularen Vorgaben des Lehrplans von Beginn an. Zumeist ist es problemlos möglich, Digitale Spiele und inhaltliche curriculare Vorgaben in Einklang zu bringen. Wenn wir z. B. an Fächer der Geisteswissenschaften denken, dann bieten sich auf der Ebene des Storytellings und der literarischen Motivik sehr viele Digitale Spiele für eine Verwendung im Unterricht an. Aber auch im Bereich der Naturwissenschaften lassen sich zahlreiche Beispiele nennen, in welchen gerade Rätseldesign in Spielen, z. B. bei der Simulation von Schwerkraft nutzbar gemacht werden kann. Innerhalb einer Unterrichtsreihe mit einem Digitalen Spiel als mögliches Leitmedium lassen sich weiterhin auch traditionelle Lernziele und Prüfungsformate integrieren, z. B. als Leistungsüberprüfung in Form einer Klausur oder Klassenarbeit.
Wenn man die aktuellen Entwicklungen im Schulsektor rund um die Bedeutung und Nutzung von KI betrachtet, stellt sich meiner Meinung nach aber auch die Frage, ob alle althergebrachten Prüfungsformate noch die richtigen sind, um Leistungen von Lernenden beurteilbar zu machen. Meiner Auffassung nach ist es nötig, hier tätig zu werden und neue Formen von Leistungsüberprüfungen zu entwickeln, wie es gerade z. B. in NRW auch geschieht. In diesem Kontext bietet der Einsatz von Digitalen Spielen mittels Game-based Learning eine gute und nachhaltige Möglichkeit, Lernüberprüfungsformen zu gestalten, bei denen die Schüler:innen sowohl ihre Fach-Analyse- und echte Urteilskompetenz zeigen können.
Kommen wir zur Lehrer:innenqualifizierung. Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte, um die von Ihnen adressierte »Sprache des Gamedesigns« didaktisch sinnvoll einzusetzen, und wie kann eine entsprechende Aus- oder Fortbildung aussehen?
Die Lehrer:innenausbildung ist, könnte man sagen, zumindest in NRW, dem Bundesland, in dem ich arbeite, grundsätzlich auf dem Weg. Das Kerncurriculum, welches eine zentrale Grundlage für die Lehrer:innenausbildung darstellt, sieht gerade im Bereich der Digitalisierung explizit Medienreflexion als einen Schwerpunkt an. Um die »Sprache des Gamedesigns« und damit verbunden auch sachgerechtes Game-based Learning in Schule zu integrieren, bedarf es meiner Meinung nach einer Integration in die Lehrer:innenausbildung in der ersten und der zweiten Phase, d.h. sowohl im Bereich der universitären Ausbildung als auch im Referendariat. Wenn ich hier einen Vergleich ziehen darf: Ich denke, dass wir uns in der Didaktik gerade an einer ähnlichen Stelle befinden, wie zu der Zeit als man überlegt hat, ob es sich lohnen könnte, Filme als Lerngegenstand in den Unterricht zu integrieren. Auch hier hat es eine Zeit lang gedauert, aber heutzutage gehört eine Filmanalyse zum Unterrichtsalltag in der Schule. Wir sind gerade an dem Punkt, an dem diese Entwicklung auch für Digitale Spiele und vor allem für die »Sprache Gamedesign« beginnt. Der Weg führt hier über eine stetige Forschung und Weiterentwicklung. Ich weiß, dass wir, was die Methodik und auch die Integration von Game-based Learning angeht, noch nicht am Ende sind. Für mich ist meine Grundlagendidaktik die Basis für weitere Überlegungen und Entwicklungen wie z. B. Integration von generativer KI, Prüfungsformate etc. Ich möchte eine Verbindung herstellen, zwischen den Game-Studies, die Sie vertreten und der Medien- und Fachdidaktik und bin überzeugt, dass die genannten Disziplinen sehr viel gemeinsam haben und es Sinn ergibt, sie zusammen zu denken. Auf der Praxisebene führt der Weg natürlich über weitere Veröffentlichungen, Fortbildungsformate und die tägliche Überzeugungsarbeit mit Kolleg:innen, um auf diese Weise positive Resonanz, Akzeptanz und schlussendlich Aktivität zu erzeugen. Wenngleich ich ehrlich sagen muss, dass ich von zahlreichen Lehrenden sehr positives Feedback erhalten habe. Denn viele Kolleg:innen würden gerne mit Digitalen Spielen im Unterricht arbeiten, wussten bislang aber noch nicht, wie. Mit meinem Buch versuche ich einen kleinen Beitrag zu leisten, damit dieser Weg niederschwellig begehbar wird.
Lassen Sie uns für einen Moment eine medienkritische Perspektive einnehmen. Das Buch betont das Potenzial digitaler Spiele – wie wird zugleich mit problematischen Aspekten (zum Beispiel Kommerzialisierung, Suchtgefahr, Geschlechterbilder) umgegangen?
Ein Kapitel im Buch befasst sich am Beispiel von »Subway Surfers« explizit mit den Free-to-play- oder Live-Service-Games und bietet auch erste Perspektiven für den Alltagsunterricht, um auch in der Schule eine regulierte Mediennutzung von Schüler:innen zu thematisieren und besprechbar zu machen. Darüber hinaus erkläre ich in diesem Zusammenhang auch die Dark Patterns von Free-to-play-Games, d.h. die Glücksspielmechaniken, die eine Selbstregulation bei den Konsument:innen so schwierig machen. Bei dem Stichwort »Geschlechterbilder« möchte ich mich gern auf Ihre vorletzte Frage beziehen und hier noch einmal die Gemeinsamkeiten von den Kernlehrplänen in NRW, d. h. den Vorgaben für die Schule und Digitalen Spielen hervorheben. Gerade in den Geisteswissenschaften und hier vor allem in Fächern wie Deutsch, Englisch, Religion, Philosophie, Pädagogik, Sozialwissenschaften spielt das Themenfeld »Identität« eine hervorgehobene Rolle und wird in unterschiedlichen Jahrgangsstufen behandelt. Die Themenbereiche »Identität und Geschlechterbilder« sind gleichzeitig in der aktuellen digitalen Spielekultur sehr präsent, wenn man beispielsweise an ›Live is strange‹, ›Last of Us 2‹, ›Dragon Age: Veilguard‹, aus dem Triple- A-Segment oder ›Celeste‹ sowie ›If found…‹ als Vertreter aus der Indie-Sparte denkt. Es ist somit sehr niederschwellig möglich, dieses Thema mit Game-based Learning zu behandeln. Diese Verknüpfung zeigt somit ein weiteres Mal, dass Digitale Spiele als Leitmedium unserer Gesellschaft auch als selbstverständlicher Lerngegenstand ernst genommen werden sollten.
Bei der Lektüre dachte ich auch mehrfach an die fachübergreifende Anwendung und Sie zeigen entsprechende Praxisbeispiele aus verschiedenen Unterrichtsfächern. Welche Fächer eignen sich nach Ihrer Erfahrung besonders gut für den Einstieg, und wo bestehen noch methodische Grenzen?
Grundsätzlich lassen sich Digitale Spiele in jedem Fach anwenden und auch mein Ansatz für Game-based Learning ist hier universell aufgestellt. Gerade, wenn ich an einen überfachlichen Unterricht mit dem Ziel der Medienreflexion denke, ist es unerheblich, ob der/die Klassenlehrer:in jetzt Mathematik, Deutsch, Geschichte oder Englisch unterrichtet. Wendet man sich nun den unterschiedlichen Unterrichtsfächern zu, so lässt sich festhalten, dass gerade geisteswissenschaftliche Fächer hier vermeintlich einen kleinen Vorteil besitzen, da Aspekte wie Storytelling, Dramaturgie, Charakterzeichnung etc. etc. hier eine größere Rolle spielen als z. B. im Fach Chemie. Es gibt aber auch zahlreiche Spiele, gerade aus dem Genre der Science-Fiction oder Simulation, die sich zum Ziel gesetzt haben, z. B. die Evolution oder die Entwicklung einer Raumfähre nachbilden, andere Games »spielen« mit der Perspektive wie etwa »Viewpoint« und bieten mehrere Verwendungsmöglichkeiten für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Von methodischen Grenzen würde ich in diesem Zusammenhang vielleicht nicht sprechen.
Bitte verraten Sie uns, welche Entwicklung Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Hinblick auf Game-based Learning erwarten? Ich denke da insbesondere an das Spannungsfeld zwischen schulischer Institution und außerschulischer Spielkultur?
»Erwarten« ist ein großes Wort. Ich würde vielleicht eher »wünschen« präferieren. Ich denke, dass Schule an sich am Medium des Digitalen Spiels nicht vorbeikommt, da es in unserer Gesellschaft und vor allem in der Lebenswelt der Schüler:innen, die ja nun mal Adressaten des Unterrichts sind, eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Ich wünsche mir und dafür arbeite ich auch, dass »Digitale Spiele« als Lernmedium auch für die Schule ernst genommen und einerseits ihr Potential breitflächig erkannt und genutzt werden. Andererseits halte ich es für unerlässlich, gerade den Bereich der Medienreflexion in Schule zu stärken, da zahlreiche Schüler:innen Konsument:innen von Live-Service-Games sind und immer weniger aus eigenem Antrieb Medien selbst reguliert verwenden. Hier muss meiner Meinung nach die Schule auch tätig werden.
 Aus den genannten Gründen habe ich auch den Entschluss gefasst, eine Didaktik der Digitalen Spiele zu verfassen. Digitale Spiele sind zu wichtig auf zu vielen Ebenen, als dass sich die Institution Schule hier verschließen kann. Für Nordrhein-Westfalen kann ich sagen, dass dies auch von ministerialer Seite erkannt wurde. Gerade läuft in Kooperation mit der Stiftung Digitale Spielekultur und dem Schulministerium, begleitet von der PH Freiburg das Projekt ›Schule mit Games gestalten NRW‹, das sich auf eine Nutzung von Serious Games zur Demokratieförderung spezialisiert hat. Des Weiteren arbeitet ›Gameshift NRW‹ als Projekt der Pacemaker Initiative sehr erfolgreich mit Bildungsinstitutionen und leistet hier wertvolle Aufklärungsarbeit hinsichtlich des Medienkonsums.
Aus den genannten Gründen habe ich auch den Entschluss gefasst, eine Didaktik der Digitalen Spiele zu verfassen. Digitale Spiele sind zu wichtig auf zu vielen Ebenen, als dass sich die Institution Schule hier verschließen kann. Für Nordrhein-Westfalen kann ich sagen, dass dies auch von ministerialer Seite erkannt wurde. Gerade läuft in Kooperation mit der Stiftung Digitale Spielekultur und dem Schulministerium, begleitet von der PH Freiburg das Projekt ›Schule mit Games gestalten NRW‹, das sich auf eine Nutzung von Serious Games zur Demokratieförderung spezialisiert hat. Des Weiteren arbeitet ›Gameshift NRW‹ als Projekt der Pacemaker Initiative sehr erfolgreich mit Bildungsinstitutionen und leistet hier wertvolle Aufklärungsarbeit hinsichtlich des Medienkonsums.
Abschließend würde ich sagen, dass es jetzt wichtig ist, dranzubleiben und das Thema in die Breite zu bringen, d. h. in die Lehrer:innenausbildung und in die Schulen, damit die Schule als DIE Bildungsinstitution auch für zukünftige Generationen relevant bleibt.
Abschließen möchte ich unser Gespräch gerne mit einer persönlichen Frage: Mit welchem Spiel haben Sie bisher die meiste Lebenszeit verbracht?
Dies ist – mit Verlaub gesagt – eigentlich eine fast unbeantwortbare Frage an einen Menschen mit Gamer-Biographie, aber ich befürchte, das war Ihnen klar. :)
Auf die letzten Jahre bezogen, würde ich sagen, dass sich hier sicherlich ›Red Dead Redemption 2‹, ›Witcher 3. The Wild Hunt‹ und ›Baldur´s Gate 3‹ die Waage halten. Wenn ich weiter zurückblickte, wären es wahrscheinlich Titel wie ›Street Fighter 2 turbo‹, ›Master of Magic‹ sowie ›Contra 3‹, die mir da in den Kopf kommen würden. Ich hoffe für mich, dass Sie das als Antwort gelten lassen, auch wenn ich die Frage damit eigentlich nicht wirklich beantwortet habe.
Haben Sie herzlichen Dank für unsere Unterhaltung und alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es große Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
| RUDOLF THOMAS INDERST
Titelangaben
Christian Gebauer: Game-based Learning in der Schule
Eine interaktive Grundlagendidaktik Digitaler Spiele
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2025
166 Seiten, 23 Euro