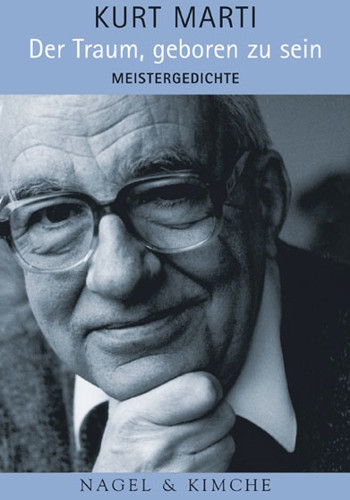Mit ›Die Laune eines Augenblicks‹ ist der zehnte Roman von Andrea De Carlo auf Deutsch erschienen. In seinem Heimatland Italien war schon sein erstes Buch ›Creamtrain‹ ein großer Erfolg. Spätere Werke wie ›Zwei von zwei‹ oder ›Wir drei‹ avancierten zum Bestseller und genießen regelrechten Kultstatus. Seine Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Der gebürtige Mailänder hatte zahlreiche längere Auslandsaufenthalte in den USA, Australien und pendelt heute zwischen Rom, Mailand und der Gegend nahe Urbino. De Carlo arbeitete in der Vergangenheit auch im Filmressort, unter anderem auch gemeinsam mit Fellini und Michelangelo Antonioni.
Anselm Brakhage unterhielt sich mit dem Endvierziger in Köln während seiner einwöchigen Lesereise durch Deutschland.
TITEL: Ich möchte mit einer Frage beginnen, die aus Ihrem Buch gestohlen ist: Kennen Sie jemanden, der glücklich ist, der »pure Freude« darüber empfindet, zu genau diesem Zeitpunkt an genau diesem Ort zu sein?
De Carlo (überlegt): Das ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt, das bei Menschen zu finden. Es ist selten, aber doch, manchmal begegne ich Menschen, die zumindest all die Voraussetzungen in sich vereinen, die notwendig sind, um glücklich zu sein oder sich zumindest diesem Zustand anzunähern.
Und Sie selbst? Sind Sie glücklich? Es ist ja eine bekannte These, dass es eines gewissen Leidensdrucks bedarf, damit Kreativität entsteht und sich entfaltet. Bleibt also nur die Alternative entweder ein guter Schriftsteller oder ein glücklicher Mensch zu sein?
Das ist bedauerlicherweise sehr wahr (lacht). Es ist tatsächlich so: wenn ich sehr zufrieden bin – oder Sie können es auch glücklich nennen – dann verspüre ich keinerlei Wunsch, zu schreiben. Ich brauche es dann nicht. Ich glaube tatsächlich, dieses innere Bedürfnis zu schreiben, stammt von einer Art Leiden oder Unglücklichsein mit dem realen Leben. Gute Schriftsteller gehören üblicherweise zu einer Kategorie Menschen, die Probleme damit haben, im Leben klarzukommen. Ich habe nie einen Autor getroffen, der besonders fähig gewesen wäre im Umgang mit dem alltäglichen Leben, der sehr praktisch veranlagt oder ein großartiger Organisator wäre. Insofern, es ist sicher ein Allgemeinplatz, aber es ist trotzdem wahr.
Wenn Sie an Ihre Anfänge des Schreibens zurückdenken und sie vergleichen mit der heutigen Situation, da Sie nun ein sehr populärer viel gelesener Autor sind: Hat sich Ihre Motivation zu schreiben, die Art des inneren Antriebs, im Laufe der Jahre verändert?
Nein, ich denke, es ist die gleiche Motivation geblieben. Der Unterschied ist nur: Heute weiß ich, dass das, was ich schreibe, auch gelesen wird. Aber ich habe während des Schreibens kein bestimmtes Bild von meinen Lesern, erwarte keine bestimmte Art von Reaktionen. Ich folge einfach meinen Gedanken und meinem Instinkt. Als ich begann zu schreiben, war es ein Weg, Bedürfnisse auszudrücken, es hatte damit zu tun, dass ich mehr beobachtete als zu leben, ich fühlte mich niemals als Teil einer Szene, sondern vielmehr als Beobachter, insbesondere als sehr junger Mensch. Und dann begann ich zu schreiben, ganz instinktiv, das entwickelte sich auf ganz natürliche Weise, dass ich all diese Beobachtungen zu Papier bringen wollte. Und das ist heute genauso. Ich mache Beobachtungen und habe Fragen, die ich zu Papier bringen muss. Das ist der einzige Weg zu verstehen; wie sich die Dinge verhalten, die ich beobachte.
Es ist schon selten genug, dass junge Schriftsteller ein glänzendes Debüt hinlegen. Noch viel seltener ist es aber meiner Ansicht nach, dass auch das zweite, dritte, fünfte, zehnte Werk noch voller Überraschungen ist. Viele wiederholen einfach das Geheimnis des ersten Erfolgs. Das ist der Grund, weshalb ich mich auf jedes neue Buch von Ihnen freue und nie enttäuscht werde, weil einfach die Risikobereitschaft zu spüren ist, sich wirklich auf Neues einzulassen. Soweit das Kompliment, nun die Frage: Haben Sie manchmal Angst, Ihre Inspiration zu verlieren?
Ja, ich habe Angst. Das ist eine Gefahr, die ständig präsent ist. Kein Schriftsteller ist immun dagegen. Diese Angst begleitet einen ständig: Ich beruhige mich dann damit, dass ja jederzeit auch aufhören und etwas ganz anderes tun könnte. Bei solch einer Arbeit wie dem Schreiben, die so von der Inspiration lebt, muss man darauf vorbereitet sein, dass die Inspiration auch mal ausbleibt. Man kann nicht erwarten, dass sie immer da ist, wie bei einem Wasserhahn, den man nur aufzudrehen braucht. Ja, manchmal ist einem der Zugang dazu tatsächlich verschlossen. Oft muss man nur warten, und dann kommt sie von alleine wieder zurück. Man kann sie auch günstig stimmen, das richtige Klima schaffen, so wie die Indianer, die durch Tanzen den Regen herbeirufen. Und dann kehrt sie vielleicht zurück, manchmal aber eben auch nicht. Es hängt davon ab, wie lange sie ausbleibt.
Natürlich, wenn man das Schreiben wie einen gewöhnlichen Job betreibt, kann man immer irgendetwas produzieren, weil man mit der Zeit einfach gewisse Fähigkeiten erworben hat. Aber das ist nicht das, was ich will. Es wäre blutleer, reine Kopfarbeit, ohne Herz. Es gibt eine Menge Schriftsteller, die das so handhaben. Aber ich will es lebendig, frei, instinktiv tun … ansonsten mache ich lieber etwas anderes. Auch Leser als Leser spüre ich das sehr genau. Nehmen wir zum Beispiel Milan Kundera; seine ersten Bücher mochte ich sehr gerne, sie waren voll von Leben und Humor, aber jetzt ist er sehr kopflastig geworden, sehr intellektuell, seine Bücher haben für mich an Inspiration verloren. Wahrscheinlich hatte er es einfach satt zu schreiben, oder vielleicht ist er auch glücklich mit der Art, wie er jetzt schreibt, oder es hat auch damit zu tun, dass er inzwischen nicht mehr in seiner Muttersprache Tschechisch, sondern auf Französisch schreibt.
Erleben Sie Schreiben als einen sehr einsamen Job? Pflegen Sie bewusst Kontakte zu anderen Schriftstellern?
Ja, es ist einsam. Und manchmal, meistens, wenn ich gerade mit einem Roman fertig bin, dann habe ich es richtig satt, will nichts mehr damit zu tun haben und möglichst weit weg sein von alledem. Dann schwöre ich mir, mich dem nie wieder auszusetzen, und unterbreche einfach mal für eine Weile! Ja, und manchmal brauche ich schon den Austausch mit anderen Autoren, aber unter meinen Freunden sind kaum Schriftsteller. Ich mochte es nie, in einer Umgebung von lauter Schriftstellern zu leben. Ich denke, es ist eine Gefahr – egal welchen Job du machst – nur unter deinesgleichen zu sein. Du hältst deine Arbeit dann zwangsläufig für das Wichtigste und das Einzige auf der Welt. Ich denke, es ist gesünder zu wissen, dass du nur eine von vielen möglichen Sachen tust, die Menschen tun können. Meine Freunde sind keine Schriftsteller, sie machen alles Mögliche, nur nicht schreiben.
In den Achtzigern haben Sie auch filmisch gearbeitet, unter anderem auch mit Fellini und Antonioni, und Sie haben selbst Regie geführt bei einem Film, der auf Ihrem ersten Buch ›Creamtrain‹ basierte. Aber Sie waren damals nicht sehr glücklich mit dem Ergebnis? Stimmt das?
Nicht sehr, nein. Denn es war eine sehr anstrengende Erfahrung. Es war ein Film mit einem mittleren Budget, also nichts, was du gerade mal so im Freundeskreis machst. Aber das Budget war nicht groß genug, um die Freiheiten zu haben wie z. B. ein Fellini, mit dem ich vorher gearbeitet hatte und der frei war wie ein Maler vor seiner Leinwand, er konnte improvisieren und Szenen über Nacht noch umschmeißen. Als ich den Film machte, spürte ich permanent den Druck des Geldes. Dieser Druck war so stark, dass ich jede Entscheidung, jede Auswahl verhandeln musste, jede Szene, die ich drehte, musste ich endlos mit dem Produzenten diskutieren, es war absolut ermüdend! Am Ende hatte ich das Gefühl, ich war der Kapitän eines Schiffes, das nicht meines war. Ich war die Verpflichtung eingegangen, es heil in den Hafen zu bringen, und hatte nur damit zu tun, es vor dem Sinken zu bewahren. Es machte keinen Spaß, ich konnte mich nicht wirklich bekennen zu dem Projekt, es war nicht meins.
Das heißt, die Gründe für Ihr Unbehagen lagen in den Bedingungen, unter denen Sie zu arbeiten hatten. Können Sie sich vorstellen, unter anderen Bedingungen wieder einen Film zu machen?
Ja, tatsächlich denke ich darüber nach, zum Film zurückzukehren. Ich war immer sehr fasziniert vom Film, vom Filmemachen. Wir sprachen vorhin über die Isolation beim Schreiben. Das Wunderbare beim Film ist, dass man auch eine Geschichte entwickelt, aber man tut es zusammen mit anderen. Man teilt die Lust und den Frust mit anderen. Das gibt einem einen großen Reichtum, man kann Ideen austauschen, man kann Freunde um sich herumhaben – das ist das, was ich am Filmemachen so schätze. Ich mag dieses Medium, es kann sehr frei sein, sehr spannend, wenn du nicht eingeengt bist von Geld und Produzenten. Deshalb schwebt mir eher eine Low Budget Produktion vor, die ich tatsächlich mit Freunden machen kann, vielleicht auch als Video oder auf 16mm.
Aber etwas Konkretes ist noch nicht geplant?
Doch, ich denke sehr viel darüber nach, aber im Moment bin ich noch sehr mit einem neuen Roman beschäftigt. Aber danach möchte ich das Filmprojekt angehen. Nächstes Jahr wird es vielleicht so weit sein. Aber ich möchte es als ganz eigenständiges Filmprojekt machen, nichts, was auf einer Romanvorlage basiert. Denn – das ist eine andere Lektion, die ich damals gelernt habe – es ist viel besser, etwas völlig Unabhängiges zu machen als eine Adaption einer Literaturvorlage, die ursprünglich als etwas ganz Anderes entstanden ist. Ein Buch ist einfach etwas Anderes, etwas ganz Spezifisches, mit ganz bestimmten Eigenschaften, die man nicht automatisch übertragen kann. Unter Umständen kann man es, aber es ist nicht notwendigerweise so. Oft geht der Geist eines Buches, die Essenz verloren – nur die Handlung bleibt erhalten und die Figuren, aber nicht der eigentliche Geist der Geschichte.
Der Titel Ihres neu erschienen Buches lautet zu deutsch ›Die Laune eines Augenblicks‹ – ein schöner, verheißungsvoller Titel. Er erinnerte mich an den Titel eines Buches von Stan Nadolny vor etlichen Jahren – ›Die Entdeckung der Langsamkeit‹ …
…Oh ja, ich habe das Buch gelesen. Ich mochte es sehr …
Ist es Ihre alleinige Entscheidung, den Titel zu wählen, oder nimmt der Verlag darauf Einfluss?
Nein, das bleibt ganz mir unterlassen. Ich muss manchmal sehr darum kämpfen, da der Verleger nicht immer von meiner Wahl überzeugt ist. Zum Beispiel beim Buch ›Zwei von zwei‹ kamen Einwände, dass etwa die Leute denken könnten, das beziehe sich auf zwei Kurzgeschichten, die in einem Buch zusammengefasst seien. Aber ich war absolut sicher, dass der Titel bleiben muss. Denn irgendwann ist der Titel so verbunden mit der Geschichte, dass es eben genau dieser Titel sein muss. Das ist nicht rational zu erklären, oft ist es mehr der Klang.
Wie kann man sich den Schaffensprozess bei der Entstehung Ihrer Bücher vorstellen? Haben Sie von Beginn an ein grobes Gerüst und arbeiten dann nach und nach die Einzelheiten aus? Oder beginnen Sie eher mit einer vagen Vorstellung, ohne den Verlauf der Geschichte schon genau zu kennen?
Letzteres ist der Fall. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einen Plan. Aber das ist nicht meine Art zu schreiben. Ich weiß nie im voraus, wohin die Geschichte führen wird, ich weiß nur den Anfang. Ich habe eine Grundidee und einen Hintergrund, vor dem die Geschichte spielt … und eine Figur oder mehrere; damit fange ich an zu schreiben. In vieler Hinsicht ist das schwieriger als einen festen Plan zu haben, aber es ist lebendiger und überraschender, wenn sich die Geschichte von Tag zu Tag entwickelt. Und man gibt seinen Figuren einfach mehr Freiheiten. Bis zu einem gewissen Grad führen sie einen tatsächlich dorthin, wohin sie wollen.
Wie würden Sie in kurzen Sätzen beschreiben, was Ihre künstlerische Zielsetzung ist, Ihre Maxime, woran Sie sich intuitiv orientieren? Deren Erreichen oder Annäherung daran den Ausschlag gibt, ob Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind oder nicht?
Das ist schwer. In jedem Fall ist es ein sehr persönliches Ziel, ich habe kein übergeordnetes Ziel, wie zum Beispiel bestimmte Autoren des 19. Jahrhunderts, die Menschen erziehen oder die Welt verbessern wollten. Sicherlich sollten und können Menschen durch Bücher bereichert werden, aber das ist sicher nicht der Grund, weshalb ich schreibe. Natürlich weiß ich, dass das was ich tue, nicht nur für mich selbst ist, aber der Grund, weshalb ich es tue, liegt in extremen Maß nur in mir selbst. Schreiben ist eine Art, über Erfahrungen zu reflektieren und sie zu erforschen. Manchmal sehe ich mich wie einen dieser Entdecker, die in ein unbekanntes Land gereist sind, um es zu erforschen. Das Leben ist immer unerforscht. Man kann nicht sagen, mein Vater war schon hier, deshalb kenne ich es. Ich denke, für jeden von uns ist es immer wieder eine neue Erkundung. Diese Erfinder wussten nichts von dem Land, das sie erforschten, deshalb brauchten sie Karten und gaben den Plätzen Namen, die sie fanden, wie Blue Mountains Region, Yellow River etc. Einen Roman zu schreiben ist wie so eine Namensgebung für Erfahrungen, die man macht, und man versucht sie so gut zu beschreiben, wie man kann. Das ist das, was man tun kann. Ich kann keine Antworten geben auf die Fragen, die ich habe, aber ich kann sehr wohl die Fragen formulieren.
Ihr Buch beginnt mit einem Reitunfall, der den Protagonisten buchstäblich wachrüttelt. Beruht dieser Einstieg auf einer eigenen schmerzlichen Erfahrung? Es ist ja bekannt, dass Sie ein Faible für Pferde haben.
In der Tat. Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit Reiten, und ich mag es noch immer sehr. Aber mein Zugang war vielleicht etwas naiv, ich wollte den Pferden nicht soviel Freiheit lassen, wie sie wollten; und deshalb akzeptierten sie es anfänglich nicht, von mir geritten zu werden. Ich bin tatsächlich mehrmals abgeworfen worden. Man denkt, man hat Kontrolle über diese Tiere, die sehr dynamisch und sehr stark sind, aber gleichzeitig auch sehr scheu und sanft. Wenn sie sich erschrecken, können sie unkontrollierbar werden. Dieses Bild eines Unfalls steht für Kontrollverlust, ich denke, das ist ein Thema, das viel mit der Einstellung zum Leben zu tun hat. Man denkt, man hat alles im Griff, wir fühlen uns als der Herrscher über alles, aber in Wirklichkeit sind wir das ganz und gar nicht.
| ANSELM BRAKHAGE